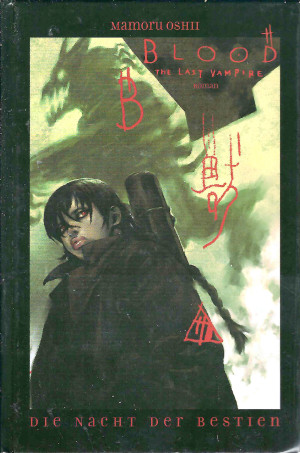Japan im Frühjahr 1969: Schüler- und Studentenunruhen erschüttern das Land, die politisch radikalisierte Jugend rebelliert gegen die bestehenden Verhältnisse und ist dabei nicht immer zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Auch Rei Miwa, Oberschüler an einer städtischen Oberschule in Tokio, ist Teil der Protestbewegung und träumt mit seinen Kameraden von großen Veränderungen. Als er aber eines Tages am Rande einer Demonstration Zeuge einer schrecklichen Begebenheit wird, verändert dieses Ereignis sein Leben nachhaltiger, als er sich das jemals hätte träumen lassen. Über Nacht wird der Schüler in einen Kriminalfall verwickelt, der immer mysteriösere und bedrohlichere Züge annimmt und in dessen Mittelpunkt ein ebenso faszinierendes wie furchteinflößendes Mädchen mit Namen Saya steht. Hin und hergerissen zwischen Neugier und Furcht beschleicht Rei schon bald eine Ahnung; dass er nicht mehr nur ein unbeteiligter Zeuge ist, sondern selbst in Gefahr geraten könnte. Zu dumm nur, dass die Dinge, deren unfreiwilliger Zeuge Rei geworden ist, so überaus bizarr waren, dass er sich aus Angst, für verrückt erklärt zu werden, niemandem mitteilen kann. Umso überraschter ist Rei, als eines Tages ein zwielichtiger Mann, der mehr über den Fall zu wissen scheint, an ihn herantritt. Widerstrebend willigt Rei ein, den Mann bei seinen Ermittlungen zu dem Fall zu unterstützen. Für den jungen Aktivisten beginnt damit eine spannende und lehrreiche Entdeckungsreise durch einige der düstersten Episoden der Menschheitsgeschichte. Aber gerade als sich die Nebel um das rätselhafte Mädchen Saya endlich zu lichten scheinen, muss Rei feststellen, dass seine Nachforschungen eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt haben, die ihn selbst und andere in tödliche Gefahr bringen...
In unserer Erinnerung vermischt sich die Realität, von der wir glauben, dass wir sie erlebt haben, stets mit unserer Phantasie. Und ganz egal, ob es sich bei etwas um das eine oder das andere gehandelt haben mag, begreifen wir seine Bedeutung immer erst im Nachhinein.
Das, von dem er glaubte, er habe es in jener Nacht gesehen hatte er es tatsächlich gesehen, oder glaubte er lediglich, es gesehen zu haben, weil diese Szene sich immer und immer wieder in seiner Erinnerung abspielte? Lange Zeit quälte er sich mit dieser Frage herum. In dieser von Blutspritzern und einem animalischen Geruch eingefassten Szene war nur eines scharf und deutlich zu erkennen - das bleiche, aus der Dunkelheit auftauchende Gesicht eines Mädchens mit großen Augen, die ihn urverwandt anstarrten. Augen, die wie bleiche Flammen in der Finsternis flackerten. Erst sehr viel später wurde ihm klar, dass es die Augen eines wilden Tieres waren.
REPORT
Der Augenzeuge
Der Augenzeuge
Die Flammen der Molotowcocktails breiteten sich auf dem vom Wasser der Wasserwerfer durchnässten Asphalt der Straße aus und tauchten mit ihrem Lodern die Unterseite der Stadtautobahn, die sich als Brücke hoch oben über die Köpfe spannte, in ein kräftiges Rot. Eine Gruppe von Demonstranten, die als Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit gleichfarbige Helme trugen, rannte die Straße hinunter, während weiter vorne die zuvor geworfenen Molotowcocktails immer wieder neue Flammen hochschlagen ließen. Dabei ging jedes mal ein heftiges Raunen durch die Menge, die den Bürgersteig in Beschlag genommen hatte.
Es war der 28. April 1969. Seit den Mittagsstunden hielten Truppen der Studenten und Arbeiter, die den »Anti-Yoyogi-Kräften« zuzurechnen waren, wichtige Straßenkreuzungen, Bahnhöfe und andere strategische Punkte im Gebiet der Hauptstadt Tokio besetzt. Immer wieder kam es zu heftigen Zusammenstößen mit den mobilen Einsatzkommandos der Polizei, die versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Ein Polizeiposten in der Nähe der Universität, die den Studenten als Stützpunkt diente, war angegriffen worden und in Flammen aufgegangen. An zahlreichen Stellen in der Stadt hatte man auf den Hauptverkehrsadern Barrikaden errichtet und »befreite Bezirke« ausgerufen. Zwischen den Studenten und den mobilen Einsatzkommandos der Polizei, die zur Niederwerfung der Unruhen ausgerückt waren, wogte seitdem ein erbitterter Kampf, der auf der einen Seite mit Steinen und auf der anderen mit Tränengasgeschossen geführt wurde.
Auch nach Anbruch der Dunkelheit gab es keinerlei Anzeichen für eine Beruhigung der Lage. Die Besetzung eines Teils der Bahnhöfe hatte zum Ausfall des Zugverkehrs auf den Strecken der nationalen Eisenbahn und der U-Bahnen in Tokio geführt. So waren die Straßen voller Menschen, die auf dem Nachhauseweg von der Arbeit steckengeblieben waren. Ein Teil von ihnen verwandelte sich in eine vom Verlangen nach Krawall umher getriebene Masse. Ohne ein bestimmtes Ziel, nur in der Erwartung, dass irgend etwas passieren könnte, strömte diese Masse wie eine Herde von Tieren durch die von einer Atmosphäre des Aufruhrs erfüllte Hauptstadt.
Reis »Einheit« umfasste gut 200 Mann und hatte sich vor etwas mehr als fünfzehn Minuten auf einer großen, achtspurigen Straße niedergelassen, genauer gesagt auf der Fahrspur, die sich am nächsten zum Bürgersteig befand. Beim Aufbruch von der Kundgebung im Park hatten sich etwas mehr als zwanzig ähnliche Einheiten zusammengefunden und eine Formation von insgesamt mehr als 4000 Mann gebildet. Während diese Formation (unter Abweichungen von der geplanten Route) durch die Straßen marschierte, wurde sie allerdings stark in die Länge gezogen und schließlich in mehrere Gruppen aufgetrennt, so dass es bald sehr schwierig geworden war, einen Überblick über die Position und Verteilung des gesamten Demonstrationszuges zu behalten.
Die »Einheiten« bei einer Demo waren beileibe nicht alle gleich. Manche von ihnen bestanden aus gemäßigten Leuten, die in Begleitung ihrer Familien marschierten und sich genau an die Route hielten, die man bei den Behörden beantragt hatte, andere aus weitaus gefährlicheren »Militanten«. So unterschieden sich die Demonstranten je nach Einheit in ihrem Auftreten ebenso wie in ihren tatsächlichen Absichten und Zielen. Wann immer aber klar vorherzusehen war, dass die Behörden versuchen würden, eine Demonstration zu unterbinden, war man gezwungen, eine bestimmte Marschordnung zu befolgen, die auf Erfahrungen der Vergangenheit beruhte und die Formation und das Verhalten des Demonstrationszugs regelte.
Um das Auseinanderfallen einer Einheit zu verhindern, griffen sich die Teilnehmer unter den Armen und bildeten fest zusammenhängende Querreihen, deren Aneinanderreihung in Marschrichtung schließlich eine Gruppierung in rechteckiger Form ergab. Das Verhältnis zwischen Länge und Breite einer Einheit konnte dabei je nach Umfang variieren. Um das Sichtfeld der anderen Teilnehmer nicht zu sehr einzuschränken, durfte eine Querreihe aber aus höchstens sechs bis acht Personen bestehen. Weil eine zu große Ausdehnung in der Länge ein Aufbrechen der Einheit durch die Polizei begünstigte, war es zweckmäßig, die Größe einer Einheit auf etwa 200 Mann zu beschränken. Die vordersten Reihen dieser Einheit bildeten die mit Fahnenstangen ausgerüsteten »Bannerträger«, an deren Spitze ein Kommandeur stand, der die gesamte Einheit dirigierte. Allerdings konnte der einzelne Teilnehmer im Inneren in der Praxis gerade bei »Zicke-Zack-Demos« und anderen sehr eng geführten Demonstrationen kaum mehr als die Rücken seiner Vorderleute sehen, geschweige denn die Anweisungen des Kommandeurs hören. Deshalb hatte der Kommandeur jeweils einige Subkommandeure an den Seiten, weIche die Einheit mit Brüllen, Schreien, Schieben und Zerren zusammenhielten und lenkten. Man kann sie sich am einfachsten wie Hirtenhunde bei einer Schafherde vorstellen oder Rinderhirten, die eine Herde Rinder antreiben.
Natürlich waren alle, die soIche Aufgaben übernahmen, in besonderem Maße der Gefahr einer Festnahme ausgesetzt. Deshalb wurde von ihnen auch ein besonderes Maß an Entschlossenheit verlangt. Eine Festnahme durfte ihnen nichts ausmachen. Speziell für die Träger der Banner, deren Stangen von der Polizei als Bewaffnung eingestuft wurden, war das Risiko einer Verletzung mindestens ebenso groß wie das heroische Gefühl, das sie dem Träger bescherten.
Bei der Formierung seiner Einheit musste der Kommandeur nicht nur Rücksicht auf den Grad der Entschlossenheit der Teilnehmer nehmen, sondern auch auf ihre körperliche Voraussetzungen. An die Flanken der Einheit, dort, wo man am ehesten dem Prügeln,Treten und Stoßen der mobilen Einsatzkommandos der Polizei ausgesetzt war, wurden vor allem kräftige Männer positioniert, während Frauen und weniger robuste Männer ins Innere oder ans Ende der Formation gehörten. Gerade bei einer Demo mit vielen Neulingen war es notwendig, im voraus Informationen zum Verhalten bei einer Festnahme und Tipps für die Flucht zu geben.Wenn die Truppe dann in Aktion war, musste entsprechend der Situation die Spannung innerhalb der Truppe aufrecht erhalten werden, indem man die Teilnehmer mit Parolen aufwiegelte oder sie Sprechchöre skandieren ließ.
Natürlich waren die Umstände völlig andere, sobald die Teilnehmer einer Einheit aus überzeugten Parteimitgliedern bestanden oder es sich gar um eine Truppe handelte, die von vornherein auf den bewaffneten Kampf eingestellt war. Dann hatten die Teilnehmer ihre Entschlossenheit schon allein durch ihr Mitmachen bekundet. Folglich musste der Anführer bei der
Formierung seiner Einheit lediglich darauf achten, dass alle physischen und taktischen Erfordernisse für einen erfolgreichen AbSchluss der Mission erfüllt waren. Die Mitglieder einer soIchen Truppe wurden im Vorfeld an ihrem Stützpunkt (normalerweise ein Gebäude der Universität) diversen taktischen Drills unterzogen, wozu auch anspruchsvollere Gruppenbewegungen wie etwa die »Spiral-Demo« gehörten.Je nach Notwendigkeit bewaffnete man sich zudem mit Holzlatten und Eisenrohren, und auch zu Steinen und Molotowcocktails wurde ohne Zögern gegriffen. Die »Bannerträger« hatten den Status einer Vorhut und waren deshalb relativ zahlreich. Ein Blick in die Geschichte lehrt, dass heroische Aufmärsche mit Fahnenmeeren seit jeher zum beliebten Repertoire vieler politischer Gruppierungen links wie rechts gehören. Doch hier ging es um weitaus mehr als nur um eine Demonstration der Macht. Wenn die Truppe nämlich auf Kommando ihre Fahnen einrollte, die Spitzen der mächtigen Fahnenstangen senkte ( dabei packten die weiter hinten stehenden Teilnehmer mit an) und wie schwer bewaffnete Legionäre des Altertums in einer Phalanx von Lanzen vorrückte, waren sie ein ernstzunehmender und schwer zu beherrschender Gegner für die mobilen Einsatzkommandos der Polizei.
SoIche im Straßenkampf und auf Demos aktiven Trupps unterstanden in der Regel dem Kommando eines Komitees einer übergeordneten politischen Gruppierung und umfassten außer den eigentlichen Straßenkämpfern auch noch Personal, das sich speziell um Aufgaben wie Lage Sondierung, Nachrichtenübermittlung und Versorgung kümmerte. Zudem gab es Strukturen, die für die Rechtshilfe von Festgenommenen sorgten. Es waren demnach Kampfeinheiten mit einem übergeordneten Entscheidungsgremium und verschiedenen Hilfsstrukturen. Sie besaßen damit die grundlegendsten Bestandteile dessen, was eine Armee ausmachte, und tatsächlich schreckten einige der politischen Gruppierungen nicht davor zurück, sie öffentlich als ihren »militärischen Arm« zu bezeichnen und in ihnen nichts anderes als den Vorläufer einer zukünftigen »Armee der Partei« zu sehen. Kurzum, soIche Einheiten mochten zwar den auf einer Kundgebung nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelten Trupps äußerlich ähnlich sehen, ihrem Wesen nach waren sie aber etwas völlig anderes.
Bei der Einheit, in der Rei marschierte, handelte es sich um das klassische Beispiel eines mehr oder weniger zusammengewürfelten Haufens. Normalerweise war es so, dass Gruppen, die an einer Demo teilnehmen wollten, aber keiner Partei oder Fraktion angehörten, im Vorfeld von einem Kampfkomitee der betreffenden Schule, Universität oder des Betriebs zu einer gemeinsamen Kampforganisation« zusammengefasst wurden. Gemäß den dort getroffenen Absprachen formierte man sich vor Ort dann zu Einheiten. Im Falle von Schülern war es allerdings so, dass die Teilnehmerzahl an einer einzelnen Schule meist so gering war, dass derartige Verbünde (abgesehen von den Unterorganisationen der Parteien) gar nicht existierten. Man hatte deshalb meist keine andere Wahl, als sich irgendeiner anderen Truppe, auf die man bei der Auftaktkundgebung traf, einfach anzuschließen.
So verhielt es sich auch mit dem »Kampfkomitee für Demokratisierung der Städtischen K-Oberschule«, dem Rei angehörte. Sie waren kaum mehr als ein mühsam zusammengekratzter Haufen von etwa einem Dutzend Sympathisanten. Nicht einmal im Traum war für sie daran zu denken, bei einer Demo eine eigenständige Einheit zu bilden. Das galt um so mehr an Tagen wie heute, wenn die diversen Parteien und gemeinsamen Kampforganisationen eine Einheitsfront bildeten und im Vorfeld den bewaffneten Kampf ausgerufen hatten. Dann ließen sich kaum mehr als sieben oder acht Leute mobilisieren, so dass man eigentlich von individuellen Teilnehmern sprechen musste.
Nach SchulSchluss hatten Rei und seine Schulkameraden sich am Bahnhof im benachbarten Stadtteil getroffen.Von dort ging es in ein Apartment, das auf den Namen eines Aktivisten aus dem Bekanntenkreis angemietet war und wo man sich Helme, Fahnenstangen und sonstige Ausrüstung holte. Damit war man einsatzbereit und konnte sich mit dem Zug auf den Weg ins Stadtzentrum machen. Rei und seine Leute besaßen freilich nicht die Dreistigkeit der großen Parteikampfgruppen, die einfach so mit Helm und voller Kampfmontur in den Zug stiegen. So blieb es denn dabei, dass sie jedes mal, wenn sie im Vorüberfahren aus dem Zug eine Kampfgruppe auf einem Bahnsteig erspähten, mit einem kaum hörbaren Aufschrei gegrüßt hatten.
Im Stadtgebiet standen gleich eine ganze Reihe von Kundgebungen mit jeweils unterschiedlicher politischer Ausrichtung zur Wahl. Rei und seine Kameraden fühlten sich zwar rein gefühlsmäßig zu den »Anti-Yoyogi-Kräfte« genannten Parteien und Fraktionen hingezogen und lehnten deren bewaffneten Kampf keineswegs grundsätzlich ab. Sie hatten sich aber letztlich für eine Versammlung entschieden, die sich von diesen Kräften klar abgrenzte, weil sie von (wie die Parteileute gesagt hätten) »kleinbürgerlichen Gruppen« veranstaltet wurde.
Als Rei und seine Kameraden dort eintrafen, war der Park, in dem die Kundgebung stattfand, bereits von Helmen mit den unterschiedlichsten Farben, Beschriftungen und Zeichen bevölkert, und ebenso unterschiedlich waren die Banner, die in großer Zahl herumstanden. Parolen, von billigen Megaphonen in ein unverständliches Kauderwelsch verwandelt, brandeten an allen Ecken und Enden aufeinander. Wenn du Schutz suchst, wähle einen mächtigen Baum. Dieses Sprichwort ging Rei unwillkürlich durch den Kopf, als er diese bunt zusammengewürfelte Schar sah. Aber sobald er seinen Helm trug und die für den Transport zerlegte Fahnenstange zusammengesetzt hatte, hellte seine Stimmung sich schlagartig auf. Während Rei noch eine Zigarette rauchte und in der Umgebung nach einer geeigneten Gruppe Ausschau hielt,hatten sich schon wie von Geisterhand geführt eine Reihe von Gruppen mit irgendwie ähnlichen Leuten zusammengefunden. Unter Vermittlung eines Mannes in ihrer Mitte, der wie eine Art Manager für Bürgerrechtsgruppen aussah, besprachen sich die Vertreter der einzelnen Gruppen und begannen, eine Einheit zu formieren. Zum Kommandeur der Einheit hatte man einen schwarz behelmten, zierlichen Mann bestimmt, der einer etwa zwanzig Mitglieder umfassenden Gruppe namens »Allianz des Protestes« vorstand.
Jetzt, zwanzig Minuten später, begannen die Leute, Druck auf den zierlichen Mann mit dem schwarzen Helm zu machen. »Wie lange sollen wir hier denn noch herumsitzen«, maulte ihn ein Mann an, der einen weißen Helm mit dem Schriftzug »Nippon Pro-Wrestling« trug.
»Sag uns endlich, was der Plan ist«, jammerte auch sein Nachbar, ein Rothelm, auf den die Schriftzeichen für das Wort »Vernichtung« geschrieben waren.
Die Mitglieder der Einheit waren dem Befehl, sitzen zu bleiben, gefolgt, aber die Unklarheit, in der man sie beließ, verärgerte und ermüdete sie. Alle waren gespannt und warteten auf eine erlösende Antwort.
»Also, wie ist die Lage? Worauf warten wir? Los, sag schon!« »Scheint, die Bullen haben vorne auf der Kreuzung einen Sperrgürtel errichtet. Ich muss mich erst mal mit den Kommandeuren der einzelnen Einheiten besprechen, wie wir darauf rea...«
»Besprechen? Du willst dich mit denen besprechen, ohne uns vorher zu informieren? Was wird da aus unserem Selbstbestimmungsrecht?«
»Das ist Bossokratie!«
Bossokratie. Das war eigentlich ein Ausdruck dafür, wenn Gewerkschaftsfunktionäre über die Köpfe von Betroffenen hinweg eigenmächtig mit der Geschäftsleitung oder dem Chef einer Firma verhandelten, und solches Verhalten war bei den sogenannten Parteilosen ganz besonders verhasst. Rei hielt sich selbst nicht gerade für einen überzeugten Demokraten, aber er hatte dieses Verhalten schon oft bei Parteimitgliedern beobachtet und war der Meinung, dass allein die Existenz von Wörtern wie »innerparteiliche Demokratie« schon Beweis genug dafür war, wie es im Innern dieser Organisationen wirklich zuging. Trotzdem war Rei enttäuscht, dass Mr. Nippon Pro-Wrestling und Mr. Vernichtung, der so etwas wie sein Nachbeter zu sein schien, inmitten der Revolte diese Art von Diskussion provozierten.
Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder man würde vorrücken oder man würde die geplante Route ändern, wobei es eine alles andere als alltägliche Herausforderung war, eine so große Formation auf einer geänderten Route zu führen. Zumal es keine Garantie gab, dass dort nicht neuerliche Gefahren auf sie lauem würden. Andererseits war es schwer vorstellbar, dass es irgendeinen Sinn machte, noch länger hier herumzusitzen.
Eine sich ständig verändernde Lage und ein entscheidender Mangel an Informationen. Das waren genau die Bedingungen, unter denen ein Kommandeur sich beweisen konnte. Der zierliche, schwarz behelmte Mann, der Reis Truppe kommandierte, mochte ein begabter Koordinator und Vermittler zwischen
Organisationen sein. An der für einen Kommandeur im Feld nötigen Urteils- und Entscheidungskraft schien es ihm aber zu fehlen. Unter Parteiangehörigen waren Leute mit soIchen Begabungen, sogenannte »Militärs«, häufiger zu sehen, aber zu Reis Leidwesen schienen sie in den Reihen der Parteilosen zu fehlen.
Es war zwar schon Ende April, aber mit dem Einbruch der Nacht wurde es empfindlich kalt. Der Asphalt der Fahrbahn, auf der sie seit einer Weile saßen, fühlte sich bereits wie eine kalte Eisenplatte an. Rei hatte Hunger. Die süßen Brötchen, die er als Notration mitgenommen hatte, waren schon während der Versammlung im Park in seinem Magen verschwunden. Am schlimmsten aber war, dass dieses unentwegte Herumsitzen und die Unsicherheit über die Lage weiter vorne eine unerträgliche Angst in ihm auslösten.
»Marschieren wir einfach weiter! Wenn wir hierbleiben, finden wir doch nie raus, wie die Lage ist!« Mr. Nippon Pro Wrestling warf dem Kommandeur Unfähigkeit vor und ging hart mit ihm ins Gericht. Mr. Vernichtung schloss sich ihm widerspruchslos an und auch vom Rest der Einheit kam vereinzelte Zustimmung.
»Einen Moment! Was ist, wenn wir auf die Bullen treffen?
Ich glaube, unter uns hier sind einige, die nicht soweit gehen wollen. Unser Grundsatz ist es, möglichst keine Festnahmen zu riskie...«
Plötzlich,als ob jemand Schwarzhelm bei seinen Ausführungen ins Wort fallen wollte, waren aus den hinteren Reihen ihrer Truppe Schreie zu hören. Rei, der von den Schreien auf die Füße geholt worden war, sah, wie auf der mittleren Fahrspur ein gutes Dutzend Männer angerannt kamen. Sie trugen rote Helme mit einem weißen Strich über den Scheitel. Diese Helme wurden »Mohikaner« genannt und zeichneten sie als Militante und Angehörige einer Kampfgruppe aus, die für ihre besondere Stärke bekannt war. Fast alle waren mit Eisenrohren bewaffnet und gut die Hälfte von ihnen trugen in der Hand Gegenstände, die nach Molotowcocktails aussahen. Obwohl sie keinen einzigen Laut von sich gaben, versprühten die Mohikaner in ihrer Umgebung so etwas wie Kampfgeist, als sie an Reis Einheit vorbeirannten und schließlich irgendwo vorne in der Dunkelheit verschwanden.
Rei musste sich eingestehen, dass dies ein auf merkwürdige Weise bewegender Anblick war. Rei spürte, wie etwas in seiner Brust urplötzlich anschwoll, und als ob er von diesem Gefühl übermannt worden wäre, begann er aktiv zu werden. Er sprang über die Leitplanke und landete auf der anderen Seite auf dem Gehweg. Dort hob er einen Betondeckel der Abflussrinne an und schlug ihn auf die Gehwegplatten. Die Schaulustigen um ihn herum sprangen aufgeregt zur Seite, als der Betondeckel mit beinahe enttäuschender Leichtigkeit zerbarst. Rei wählte einige passende Brocken aus, die er in die Taschen seiner Jacke schob, während er die größeren Stücke noch einmal zerschlug. Einige Männer aus Reis Einheit schnellten plötzlich hoch und kamen auf den Gehweg hinüber, um sich an Reis Arbeit zu beteiligen. Im Nu war ein kleiner Berg von Betonbrocken in Wurfgeschossgröße angehäuft. Es war gar nicht Reis Absicht, die anderen zu etwas zu provozieren oder anzustiften, aber in dem Moment, in dem er begann, sich ganz dieser primitiven Arbeit zu widmen, war die unerklärliche Angst, die er eben noch gespürt hatte, spurlos verschwunden, ja, er fühlte sich sogar befreit, so als ob er eine Art von Schwelle für immer überschritten habe.
Während er die raue Schärfe und das Gewicht des zerbrochenen Betons in seiner Faust spürte, fragte Rei sich, ob er denn auch bereit sein würde, diesen Stein ohne zu zögern zu werfen, wenn sich eine Gelegenheit dafür ergab. Rei wusste sehr gut, wie gefährlich das Steinewerfen war. Das war nicht nur theoretisches Wissen, er hatte es oft genug mit eigenen Augen gesehen. Die Arbeiter, Schüler und Studenten hatten das Steinewerfen nicht für sich gepachtet. Wenn die Mitglieder eines mobilen Einsatzkommandos mit Steinen beworfen wurden, warfen sie oft genug zurück, auch wenn das natürlich offiziell verboten war. Bei einem Volltreffer konnte ein faustgroßer Stein mühelos eine Windschutzscheibe zerschmettern oder eine Kühlerhaube wie Papier zerdrücken. Extrem war der psychologische Effekt von Steinen nachts, wenn man die Flugbahn der Geschosse nicht nachvollziehen konnte. Plötzlich und ohne jede Vorwarnung wurde ein Körperteil zerquetscht oder ein Knochen zertrümmert. Selbst die mit Fieberglashelmen und Schilden aus Duraluminium ausgerüsteten Mitglieder der mobilen Einsatzkommandos mussten schon mehr als mutig (nämlich tollkühn) sein, wenn sie es wagten, gegen die von oben auf sie herab prasselnden Steine vorzurücken.
Das Werfen von Molotowcocktails machte zwar rein optisch mehr her, konnte aber in seiner Wirkung im Vergleich zu dem Schrecken, den Steine verbreiteten, relativ leicht beherrscht werden.Was für eine fürchterliche Waffe Steine sind, war nicht zuletzt daran zu erkennen, dass die archaische Taktik des Widerstandes mit Wurfsteinen in den zahllosen Bürgerkriegen und Konflikten, die diese Welt heimsuchen, sogar gegen Soldaten mit Feuerwaffen immer wieder eingesetzt wurde.
Rei empfand die bloße Nichtablehnung, also die passive Duldung des Gebrauchs von Gewalt als Mittel im politischen Kampf als irgendwie heuchlerisch. Aber dem Hochgefühl, das er empfand, wenn er Phrasen wie »bewaffneter Kampf« oder gewaltsame Revolution« in den Mund nahm, stand die Tatsache gegenüber, dass er in Wahrheit ein Mensch mit einer tiefverwurzelten Abscheu vor Gewalt war. So war es für Rei unverzeihlich, wenn er selbst oder irgend jemand durch nicht gerechtfertigte Gewalt verletzt wurde. Noch schwerer erträglich war für ihn die Vorstellung, selbst jemanden zu verletzen. Er wusste, dass er hier seine Grenzen hatte und nahm das als eine hoffnungslose Schwäche war. Er würde diese Abscheu gegenüber Gewalt überwinden müssen, ja er empfand das sogar als seine Pflicht. Und das hatte nichts mit dem leeren Gerede der Parteimitglieder von irgendeinem »historischen Auftrag« oder von der »Selbsterneuerung zum Revolutionär« und all dem zu tun. Zumindest dachte Rei das. Noch mehr Abscheu verursachte ihm allerdings der Gedanke, er könne aus Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, ein großes Unrecht hinnehmen und sich damit an ihm mitschuldig machen.
Die »Selbstverleugnung, von der Rei und die Leute in seinem Bekanntenkreis so gerne erzählten, war ihrem Wesen nach genau das. Oder um es mit den Worten der Parteileute zu sagen, es handelte sich hierbei bloß um Reis »kleinbürgerliche Beschränktheit«. Tatsächlich hatte ein Freund von Rei, der einer radikalen Partei angehörte, ihn einmal scharf kritisiert und ihm gesagt, dass das, was er betreibe, keine Politik, sondern lediglich »Literatur« sei. Aber genau deshalb fiel es Rei so schwer, den-Menschen zu vertrauen, die sich als Parteimitglieder bezeichneten ... Heute Nacht ,heute Nacht würde er den Stein werfen, dachte Rei.
Willentlich einen anderen Menschen zu verletzen, war eine Handlung, die nicht mehr rückgängig zu machen war. Und eben deshalb war sie notwendig. Der Mensch kann sich selbst nur verändern, indem er Situationen heraufbeschwört, in denen es kein Zurück mehr gibt. Rei glaubte, dass das zumindest für ihn selbst zutraf. Oder vielleicht war es auch lediglich so, dass die ungewöhnliche Atmosphäre des Ortes Rei diesem Irrtum erliegen ließ, aber so weit vermochte er nicht zu denken. Zweifellos überschritt Rei in jener Nacht eine Grenze, von der es kein Zurück mehr gab. Aber die Umstände, unter denen das geschah, waren völlig andere, als die, die Rei erwartet hatte.
Der Zusammenbruch kam aus heiterem Himmel. Das Vorzeichen einer drohenden Katastrophe, die sich irgendwo vorne in der Dunkelheit ereignet hatte, durchlief Reis Einheit wie das Kräuseln einer Welle von vorne nach hinten und veränderte den Gesichtsausdruck aller Anwesenden in gleicher Weise. Weit entfernt, aber dennoch sehr klar, ertönte das eindrucksvolle, an dumpfe Schläge erinnernde Knallen abgefeuerter Gasgranaten. Kurz darauf verdichtete sich das Geräusch trampelnder Schuhe auf dem Asphalt zu einer immer näher rückenden Masse .Jemand rief, »sie kommen!« Reis Einheit war mit einem Mal auf den Beinen. Der gellende Schrei einer Frau war zu hören, die vermutlich zwischen der von der Straße auf den Gehweg drängenden Menge und der Leitplanke eingeklemmt worden war. Augenblicklich begann die große Flucht. »Hinsetzen!«, »zusammenrücken!« wurde kreuz und quer gerufen, und das schneidende Geräusch einer Trillerpfeife ertönte, nur um im Nu von den Schreien und dem Gebrüll der übereinander stürzenden Menschen übertönt zu werden.
Auch Rei wurde von der auf dem Gehweg flüchtenden Masse mitgerissen und begann zu laufen. Plötzlich war vor ihm und hinter ihm alles voller wild durcheinander hetzender Menschen. Rei rannte und als er sich nach ungefähr einem Block umsah, war das mobile Einsatzkommando mit seinen dunkelblauen Nahkampf uniformen schon so nah, dass er sich furchtbar erschrak. Der Helm eines neben Rei laufenden Mannes gab unter dem Schlag eines Polizeistocks ein fürchterliches Geräusch von sich, und der Mann stürzte zu Boden. In diesem Moment schossen Rei alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Angst vor nackter, ungezügelter Gewalt versetzte ihm einen Schub vorwärts, und während Rei um sein Leben rannte, betete er, dass der nächste, den sie einholen, umreißen oder umstoßen würden, nicht er selbst wäre. Er tat das, was ihm ein animalischer Instinkt tief in ihm befahl. Er war der Pflanzenfresser auf der Flucht vor einem Raubtier.
Ohne eine genaue Ahnung, wie oder wo entlang er geflüchtet war, hatte Rei sich auf einmal in eine schmale Seitenstraße gerettet, in der sich eine Anzahl kleiner und mittelgroßer, unbeleuchteter Häuser dicht aneinanderreihten. Rei unterdrückte seinen schwer gehenden Atem und lauerte auf mögliche Verfolger. Als er erkannte, dass ihm die Flucht geglückt war, verließ ihn mit einem Mal alle Anspannung. Er drückte seinen Rücken gegen eine rau verputzte Wand und lehnte sich an. Die Erleichterung tauchte seinen ganzen Körper in ein warmes Bad. Am liebsten hätte er alles vergessen und sich einfach hier hingesetzt, aber das war natürlich ausgeschlossen. Im Stadtzentrum würde es jetzt nicht nur von mobilen Einsatzkommandos, sondern auch von Polizisten und Staatsschutzleuten in Zivil nur so wimmeln. Der unmittelbaren Gefahr war er entronnen, aber in Sicherheit wiegen durfte er sich deshalb noch nicht. Halt, da war doch etwas!
Rei griff hektisch in seine Jackentaschen und entleerte den Inhalt. Als die Betonbrocken alle zu seinen Füßen lagen, stieß er sie zur Sicherheit mit dem Fuß in die nächste Abflußrinne. Falls er mit den Steinen in den Taschen in eine Personenkontrolle geraten wäre, hätte er sich alle Erklärungsversuche sparen können. Rei ärgerte sich über seine eigene Fahrlässigkeit. Er setzte den Helm ab, legte das Handtuch, mit dem er sich vermummt hatte, und seine Handschuhe hinein und warf alles in einen engen Spalt, der sich zwischen zwei Häusern auftat. In den Taschen seiner Jeans fand er ein paar zusammengefaltete Flugblätter, wie man sie auf der Kundgebung verteilt hatte.
Auch die warf er weg, nachdem er sie fein säuberlich zerkleinert hatte. Damit waren alle Beweise, die Rei mit der Demo in Verbindung bringen konnten, beseitigt.
Was hast du hier zu suchen? Was fällt dir ein? Willst du etwa gaffen? Hm ... ein Oberschüler also ... Hat deine Schule nichts dagegen, wenn du in so einer Gegend herumlungerst? Noch feucht hinter den Ohren, aber lange Haare wie ein Mädchen! Los, Abmarsch nach Hause!
Während Rei sich von dort entfernte, musste er sich unwillkürlich und beinahe selbstquälerisch diese Fragen aus einer polizeilichen Vernehmung vorstellen. Das heroische Gefühl tragischer Entschlossenheit von eben war wie weggeblasen. Das Wort »Feigheit« kam Rei nicht gerade in den Sinn, aber zumindest dachte er, keine allzu gute Figur abgegeben zu haben.
Bei den Häusern in der Gegend hier schien es sich um kleine Bürogebäude und Lager zu handeln, und zu nächtlicher Stunde verlor sich offenbar keine Menschenseele mehr hierher. Rei lief die menschenleere, in das Licht der Straßenbeleuchtung getauchte Straße entlang. Er kreuzte eine kleine Querstraße nach der anderen und verlor sich in Gedanken daran, dass er am liebsten so alleine immer weiterlaufen würde.
Auch wenn Rei den Schlagzeilen wie »Tokio gehört uns!« oder »Besetzt Kasumigaseki!«, die im Vorfeld in den Parteizeitungen zu lesen gewesen waren, keinen Glauben schenkte, hatte er es doch für seine selbstverständliche Pflicht gehalten, auch als parteiloser Aktivist an dem Straßenkampf heute teilzunehmen. Er besaß Selbstvertrauen und hätte auch eine Verhaftung nicht gescheut. Zumindest hatte er bis vor kurzem noch so gedacht und gehandelt. Aber jetzt war sein Inneres nur noch von der Erinnerung an seine Flucht und das von ihr verursachte Gefühl der Schmach erfüllt. Vor Rei tauchte eine Mauer aus Beton auf. Aber es war keine Sackgasse, sondern die Außenmauer einer Lagerhalle oder etwas ähnliches, und nach rechts und links zweigte eine schmale, abschüssige Straße ab. Rei bliebt mitten auf der T-förmigen Kreuzung stehen und schaute nach links und rechts. Der Weg links schien zu einer Hauptstraße zu führen. Die Straße führte sanft abwärts und machte weiter vorne eine große Biegung, hinter der ab und zu das Licht vorbeifahrender Autos aufleuchtete. Rei hatte das Gefühl, dass diese Straße ihn auf die Hauptstraße zurückführen würde, von der er vorhin geflohen war. Rechts erstreckte sich eine ziemlich steil abfallende, nur spärlich beleuchtete Straße, deren weiterer Verlauf sich irgendwo in der Dunkelheit verlor. Rei zögerte einen Moment und wandte sich dann nach rechts. Und dann sah er es.
Das Erste, was ihm in die Augen fiel, waren rote Spritzer auf einer Mauer. Es war die Mauer eines abgerissenen Gebäudes, die ein weit offenes, brachliegendes Grundstück umfasste. Fast wie bei einem avantgardistischen Gemälde beschrieben die Spritzer auf der Wand einen weiten Kreisbogen, der im Licht der Quecksilberdampflampe rot und feucht glänzte. Ein Teil erstreckte sich bis weit in die Höhe des angrenzenden Gebäudes, und Rei fragte sich unwillkürlich, wie so etwas möglich war. Mit dem Rücken zu diesem unheilverkündenden Muster stand ein Mädchen.
Aber war »Mädchen« überhaupt das richtige Wort? Sie trug zwar die klassische dunkelblaue Schuluniform einer Oberschülerin, und ihre schlanke Gestalt zeigte, dass sie noch ein Teenager war, aber der Ausdruck in ihrem Gesicht, dem die lose auf die Wangen herunterhängenden schwarzen Haare eine eigenartige Bleichheit verliehen, grenzte sie deutlich von anderen Mädchen ihres Alters ab. Aber mehr als alles andere waren es ihre Augen, die Reis Blick fesselten. Wie konnte man sie beschreiben? Vielleicht als in der Dunkelheit flackernde bläuliche Flammen ... Ähnlich wie bei manchen nachtaktiven Raubtieren reflektierten die weit geöffneten Pupillen das einfallende Licht, während ihr Blick ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Blutdurst durchbohrte. Jetzt wandte das Mädchen sich langsam Rei zu. Ein langer, flacher Gegenstand, den es gesenkt in der Hand hielt, zeigte ein mattes Glänzen. Es war ein japanisches Schwert. Als Rei das schwer von der Klinge tropfende Blut sah, durchschoss ihn der Gedanke, dass das Mädchen ihn gleich töten könnte, und noch im gleichen Augenblick wurde ihm dieser Gedanke zur Gewissheit. Weshalb musste oder wozu sollte er hier sterben? All das war einfach völlig irreal, genau wie die Gestalt des Mädchens, wie es mit dem Schwert in der Hand unmittelbar vor ihm stand. Beherrscht von einem Gefühl, als ob irgend etwas das Innere seines Schädels lähmte, nahm Rei undeutlich wahr, wie das Mädchen sich langsam auf ihn zubewegte. Hinter seinem Rücken ertönte eine tiefe Stimme. Das Mädchen hielt für einen Moment inne, und es war leise zu hören, wie sie die Klinge in ihrer Hand drehte. Noch einmal ertönte ein tiefes und diesmal sehr dumpfes Brüllen.
»Saya!«
Rei konnte den Namen deutlich hören. Das Mädchen zeigte nicht die geringste Regung, nur das merkwürdige Leuchten in ihren Augen erlosch. Mit einer ebenso vollkommen leichten Bewegung, wie jene, mit der sie eben noch auf ihn zugegangen war, wandte sie sich kurz darauf von Rei ab. Als der seinen völlig erstarrten Körper mit Gewalt dazu zwang, sich umzuschauen, sah er eine schwarze Limousine und zwei Ausländer, die auf ihn zukamen. Beide trugen die gleichen dunklen Anzüge. Der eine war mittleren Alters und von kräftiger Statur, der andere dürfte an die Sechzig gewesen sein und war eher hochgewachsen. Der jüngere der beiden ignorierte Rei und ging auf das Mädchen zu. Über der Schulter trug er einen großen
Sack, der aus einem gummiartigen Material gefertigt zu sein schien.
»Was hast du hier zu suchen?« fragte der ältere Mann Rei in erstaunlich flüssigem Japanisch. Seine Stimme klang freundlich, aber zugleich auch autoritär. Eine Stimme, die es gewohnt war, anderen Befehle zu geben und keinen Widerspruch zu dulden. Als ob er eine Antwort von ihr erhoffte, wandte sich Rei mit einem verzweifelten Blick wieder dem Mädchen zu. Im fahlen Licht der Quecksilberdampflampe hielt das Mädchen sich das Schwert vor die Augen und betrachtete aufmerksam die Klinge. Als Rei klarwurde, dass sie die Klinge nach Scharten absuchte, durchfuhr ihn ein Schaudern. Das Gesicht des Mädchens zeigte keinerlei Regung. Sie verhielt sich wie ein Handwerker, der nach getaner Arbeit sein Werkzeug ordnet, und diese Unbekümmertheit machte Rei Angst.
Der jüngere der beiden Männer kniete neben dem Mädchen nieder und begann, etwas in den schwarzen Sack zu stopfen. Als Rei erkannte, um was es sich handelte, wurde er von einer heftigen Angst gepackt, die seinen ganzen Körper übermannte.
»Was hast du hier zu suchen?!«
Ein merkwürdiger, ihm selbst unverständlicher Zorn ergriff Rei und versetzte ihm einen Stoß.
»Was ich hier zu suchen habe?! Ich frage mich gerade, was ihr hier zu suchen habt«, brüllte er. Aber diese Worte ertönten nur noch in Reis Kopf. Ein schwerer Schlag traf Rei von hinten ins Genick und warf ihn zu Boden. Das letzte, was in seiner Erinnerung haften blieb, bevor er das Bewusstsein verlor, war ein Geruch. Der Geruch einer blutrünstigen Bestie.
DIE ORGANISATION
Überzeugen
ERSTER TEIL
Überzeugen
ERSTER TEIL
Als Rei die Augen öffnete, befand er sich zu seiner Verwunderung im Inneren eines Krankenwagens. Nach Auskunft des Kripobeamten, der seinen Fall untersuchte, hatten Passanten den bewusstlosen und blutüberströmten Rei auf der Straße gefunden und die Behörden verständigt. Eine ärztliche Untersuchung in der Notaufnahme war zu dem Ergebnis gekommen, dass Reis Kleidung zwar äußerlich mit großen Mengen Blut beschmiert war, dass sein Körper aber keinerlei ernsthafte Verletzungen aufwies. Das wiederum rief die Kriminalpolizei auf den Plan. Da es sich nicht um Reis eigenes Blut handelte, war nicht auszuschließen, dass er in die Verletzung oder gar Tötung einer anderen Person verwickelt war. Angesichts der allgemeinen Umstände in jener Nacht sollte eine Person, die blutüberströmt auf der Straße lag, eigentlich nichts allzu Außergewöhnliches darstellen, aber die Tatsache, dass er weit weg vom Ort der Straßenkämpfe in einer unbelebten Seitenstraße und noch dazu in bewusstlosem Zustand entdeckt worden war, verschlechterten Reis Karten bei der Polizei entscheidend. Rei wurde, wie es hieß, zum Zwecke der polizeilichen Vernehmung, vorläufig festgenommen. Während des Verhörs verweigerte Rei jede Aussage. Selbstverständlich war es ein ehernes Gesetz unter Aktivisten, im Falle einer Verhaftung absolutes Stillschweigen zu bewahren, aber allein die Irrealität der Dinge, die er dort gesehen hatte, nötigte ihn zum Schweigen. Eine Oberschülerin, die ein blutiges Schwert in der Hand hielt. Zwei Ausländer, die so etwas wie Kollegen zu sein schienen Am allermeisten aber das, was er gesehen hatte, kurz bevor man ihn niederschlug ... Diese Leiche ... All das lag weit außerhalb dessen, was man der Vorstellungskraft irgendeinem dieser staubtrockenen Realisten bei der Polizei zumuten konnte.
Die Telefonnummer der »Krisenzentrum« genannten Hilfsorganisation wusste Rei auswendig, auch das war für einen Aktivisten wie ihn selbstverständlich. Absolutes Schweigen zu bewahren und über einen Anwalt die Kameraden zu informieren, dazu war man verpflichtet, um seine Organisation vor Polizeiaktionen wie etwa Hausdurchsuchungen zu bewahren. Aber Rei wagte es nicht, nach einem Anwalt zu verlangen und beteiligte sich auch nicht an den Diskussionen der mit ihm zusammen inhaftierten Aktivisten. Für ihn war es um ein Vielfaches leichter, jegliches Gespräch, auch das mit den eigenen Gesinnungsgenossen, abzulehnen und sich in ein Schneckengehäuse zurückzuziehen, als zu erzählen, was er in jener Nacht gesehen hatte und außerdem zu behaupten, es sei wahr.
Bei einer »vorläufigen Festnahme« wurde man normalerweise wegen des Verdachts auf eine Straftat festgenommen, polizeilich verhört und dann innerhalb von 48 Stunden nach der Festnahme der Staatsanwaltschaft überstellt. Wenn der Untersuchungsrichter entschied, dass Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestand, konnte er Untersuchungshaft, also die Inhaftierung des Verdächtigen, beantragen. Ein Antrag auf Untersuchungshaft musste innerhalb von 24 Stunden nach der Über-
Stellung an den Untersuchungsrichter, also innerhalb von 72 Stunden nach der Festnahme erfolgen. Wenn eine sehr große Zahl von Personen festgenommen worden war, etwa bei Demonstrationen oder Ausschreitungen, war es üblich, dass der Untersuchungsrichter in den meisten Fällen auf eine Anklage verzichtete oder diese vorläufig aussetzte, so dass die meisten entlassen wurden. Deshalb nannte man eine vorläufige Festnahme unter Aktivisten scherzhaft auch »Drei Tage Urlaub«.
Wurde dem Antrag auf Untersuchungshaft stattgegeben, war der Untersuchungsrichter befugt, den Verdächtigen, gerechnet vom Tag des Antrags an für weitere zehn Tage zu inhaftieren. Eine Verlängerung um bis zu zehn weitere Tage war möglich, wenn zwingende Gründe vorlagen. Bei inneren Unruhen und ähnlichem war eine Verlängerung der Haft um weitere fünf Tage möglich.Wenn innerhalb dieser Frist eine Anklage durch den Untersuchungsrichter zustande kam, ging die Amtsgewalt über die Haft des Angeklagten von der Staatsanwaltschaft auf ein Gericht über. Sie dauerte zunächst zwei Monate vom Zeitpunkt der Anklageerhebung und konnte bei Bedarf um einen weiteren Monat verlängert werden.
Bei Kapitalverbrechen und politisch motivierten Straftaten sowie bei Personen ohne festen Wohnsitz konnte die Haft monatsweise verlängert werden. So zumindest wollte es das Gesetz, aber in der Realität war es so, dass eine Untersuchungshaft praktisch unbegrenzt ausgedehnt werden konnte, und zwar häufig nicht in normalen Haftanstalten, die dem Justizministerium unterstanden, sondern im Polizeigewahrsam. Bei einem kleinen Fisch wie Rei, der zum ersten mal polizeilich in Erscheinung trat und auch nicht Mitglied einer radikalen Partei war, hatte sich die Sache normalerweise mit dem »Drei Tage Urlaub« erledigt. Rei war tatsächlich noch nie polizeilich in Erscheinung getreten, aber aufgrund seiner blutigen Kleidung, seines allgemein verdächtigen Verhaltens und nicht zuletzt aufgrund seines beharrlichen Schweigens war nicht damit zu rechnen, dass man ihn auf die Schnelle in die Freiheit entlassen würde.
Rei war sich also bewusst, dass seine Inhaftierung länger dauern könnte, aber der Gedanke daran löste bei ihm weder Angst noch Reue aus. Eines war sicher. Reis Verhaftung durch die Polizei hatte ihn eine Linie überschreiten lassen, etwas, das er willentlich vielleicht niemals hätte schaffen können. Er begrüßte es, weil er damit die Erwartung verband, dass es eine Art entscheidende Wendung in sein Leben bringen würde, dieses Leben, das er aufgrund der Unausgegorenheit und Unklarheit seiner ganzen familiären und schulischen Situation als unangenehm empfand.
Das Problem war nur, dass die Umstände, die ihn zu diesem Schritt genötigt hatten, völlig andere waren, als die, mit denen er gerechnet hatte. Jetzt plagten ihn Ängste. Er fragte sich, ob die Tatsache, dass er Zeuge dieser unglaublichen Szene geworden war, nicht möglicherweise sein Leben in einem ganz anderen Sinne entscheidend verändern könnte und ob er da nicht vielleicht etwas gesehen hatte, was er gar nicht hätte sehen dürfen. Mit derlei Ängsten wurde Rei nach drei Tagen aus der Haft entlassen. Der Erkennungsdienst der Polizei kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem an seiner Kleidung gefundene Blut nicht um das eines Menschen handelte. Das war der Grund. Damit wurde seine schwache Hoffnung, dass alles ja vielleicht doch nur ein Traum oder eine Sinnestäuschung am Ende einer panischen Flucht gewesen war, nachhaltig enttäuscht. Mit Schritten, die ganz und gar nicht denen eines gerade Freigelassenen entsprachen, verließ Rei die Polizeistation und kehrte in sein Alltagsleben zurück.
»Keine Ahnung, ob das Hundeblut war oder was, aber ich frag mich, was du da getrieben hast!« Die verächtlichen Worte, mit denen der Kripobeamte ihn beim Abschied bedacht hatte, hallten jetzt ihn Reis Kopf wider, begleitet von einem merkwürdigen Dejä vu Gefühl.
Rei wurde mit einer dreiwöchigen Suspendierung vom Unterricht gemaßregelt. Als seine Mutter die Mitteilung erhielt, verlor sie die Fassung und eilte auf direktem Weg in die Schule. Ihr Sohn sei ja gar nicht verhaftet worden und Anklage sei auch keine erhoben worden. Er habe sich bloß aus Sorge um einen Freund, der an der Demonstration teilnehmen wollte, auf den Weg ins Stadtzentrum gemacht. Dort sei er in die Ausschreitungen verwickelt und dabei blutig geschlagen worden, weshalb er kein Täter, sondern Opfer sei. Mit diesen zum Teil erfundenen Erklärungen bestürmte sie zunächst den Klassenlehrer, jammerte dann vor dem Konrektor herum und verschaffte sich am Ende sogar noch eine Audienz beim Schuldirektor, aber der Gegner blieb standhaft. Obwohl die Schüler an jenem Tag eigens angewiesen worden seien, sich nach Schul Schluss direkt auf den Nachhauseweg zu machen, habe ihr Sohn dem zuwidergehandelt und sich ins Stadtzentrum begeben, wo Ausschreitungen zu befürchten gewesen waren. Die Suspendierung vom Unterricht sei nicht wegen der Festnahme ausgesprochen worden, sondern allein weil er diese Anweisung der Schule missachtet habe. Das wurde wieder und wieder vorgebracht, um die Argumente der armen Mutter zu entkräften. Die hatte immer noch kein Einsehen und lärmte noch einige Stunden weiter herum, bis sie schließlich erkannte, dass alles umsonst war und nach Hause ging. Sie stürmte in Reis Zimmer, wo sie mit Heulen und Toben weitermachte. Was sie da so von sich gab, war eine langatmige, umständliche Litanei voller Vorwürfe, Selbstkritik und bitteren Wehklagen, in der sich all ihre angestauten Gefühle unkontrolliert einen Weg nach außen bahnten.
Offen gesagt verstand Rei nicht viel von dem, was sie sagte.
Die wesentlichen Punkte der Litanei ließen sich ungefähr wie folgt zusammenfassen. Aus Sicht der Mutter hatten die Lehrer und Direktoren in der Schule sich nicht wie Pädagogen, sondern wie Bürokraten gebärdet und dabei nicht die geringste Spur guten Willens gezeigt, was sehr ärgerlich sei. Besonders Reis Klassenlehrer X sei als Lehrer der Allerletzte. Er habe Rei nur ans Messer geliefert, um selbst fein raus zu sein. Trotzdem müsse Rei Geduld haben und die Widrigkeiten hinnehmen, das schwer Erträgliche ertragen, um am Ende doch noch irgendwie den Ober Schulabschluss zu schaffen. Außerdem müsse er die Affäre zum Anlass nehmen, sich endlich von seinen gefährlichen Freunden zu distanzieren. Und seine dummen Lehrer würden sich schon noch über ihn wundem, später, wenn er es dann im Leben doch noch zu etwas gebracht hätte, und soviel sei sicher. Sie habe ihn doch nicht unter Schmerzen und Qualen auf diese Welt gebracht, ihn mühsam großgezogen und nebenbei noch anstelle des Lebemanns von Vater mühsam das Geld verdient, damit ihr Sohn eines Tages Revoluzzer werde. Eines sei klar, falls Rei vom mobilen Einsatzkommando zu Tode geprügelt worden wäre, könne sie sich darauf einstellen, den Rest ihres Lebens als Küchenhilfe für den Allgemeinen Studentenbund zu verbringen. Sie sei eine unglückliche Mutter. Rei vertrieb die Mutter schließlich mit den Worten, sie könne seinetwegen machen, was sie wolle, sie solle ihn aber endlich alleine lassen, aus seinem Zimmer und verkroch sich in sein Bett.
Und die Reaktion des Vaters?
»Weil du so nachsichtig mit ihm bist, ist aus meinem Sohn ein verdammter Roter geworden! Der bleibt keinen Tag länger auf der Schule! Ich zahle keine Schulgebühren mehr! Gleich morgen früh sucht er sich eine Arbeit!« brüllte der Vater in der Gegend herum. Als die Mutter dem Vater hier widersprach, kam es zu einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden. Anscheinend drohte der Vater sogar ganz altmodisch damit, Rei zu enterben und aus der Familie zu verstoßen.
Das Gezanke der Eltern darüber, wie mit Rei zu verfahren sei, dauerte gut zwei Tage an. Am Ende trug die Mutter mit ihrer Ansicht, die Sache erst einmal auf sich beruhen zu lassen, den Sieg davon. Womöglich, weil auch der Vater befürchtete, dass der Sohn in seiner Verbohrtheit sonst aus Verzweiflung etwas noch viel Schlimmeres anstellen könnte.
In den meisten Familien waren derartige Auseinandersetzungen um die politischen Aktivitäten (unter den politischen Aktivisten in Reis Freundeskreis sprach man gerne vom »innerfamiliären Kampf) der Kinder meist hoffnungslos festgefahren. Solche Konflikte waren auch die häufigste Ursache dafür, dass jugendliche Aktivisten abtrünnig wurden. Sich mit radikalen Äußerungen unter den Kameraden hervorzutun war leicht, aber am Ende waren die meisten von ihnen doch nur Oberschüler, die auf ihre Eltern angewiesen waren und die außerhalb von Familie und Schule keine Heimat hatten. In der Schule waren sie eine verschwindend kleine Minderheit. Man stempelte sie als »Problemkinder mit schlechtem Lebenswandel« oder »bösartige Agitatoren« ab.
Den unverhüllten Drohungen und heimlich-subtilen Einschüchterungen, denen man sie unter dem Deckmantel der pädagogischen Fürsorge aussetzte, konnten sie sich nur als Einzelne widersetzen. Zu Hause erwarteten sie immer wiederkehrende Schlachten und Tragödien, die sich oft tagelang hinzogen und auf Basis einer kompromisslosen Ideologie namens »elterliche Sorge um die Zukunft des Kindes« mit Mitteln wie Drohung, Bestechung und tränenreicher Überredungskunst geführt wurden. So wurde die von den Wortgefechten zwischen den Blutsverwandten zerrüttete Familie zu einer Art Kriegsschauplatz, auf dem sich ein regelrechter Zermürbungskrieg abspielte. Schule und Familie. Wer an diesen beiden Fronten tagtäglich seinen Mann stehen und die Verteidigungslinie halten musste, kannte bald nur noch einen einzigen Ort der Ruhe und Erholung, und das war die Straße. Erst wenn sie Schule und Familie verlassen hatten und auf der Straße eine Clique bildeten, waren sie keine machtlosen Individuen mehr. Dann konnten sie sich bewusst werden, wer sie selbst waren und spüren, dass sie selbst auch eine Macht waren, welche die Welt nicht einfach ignorieren konnte.
Immer wenn Rei sich nach der Abschluss Kundgebung einer Demo auf den Nachhauseweg machte und die mit fröhlichem Gesichtsausdruck an ihm vorbeiströmenden Universitätsstudenten betrachtete, empfand er eine Mischung aus Sympathie und merkwürdiger Ablehnung. Egal, ob es sich um Parteimitglieder oder Parteilose handelte, die studentischen Aktivisten (von denen die meisten eine eigene Bude besaßen) hatten wenig Verständnis für die Motive der Oberschüler, die aktiv am Straßenkampf teilnahmen, und umgekehrt hatte Rei letztendlich auch kein Vertrauen zu ihnen.
»Deren Kampf ist für heute vorbei, aber unser Kampf fängt jetzt erst richtig an«, hatte einer seiner Kameraden einmal gesagt, und das traf ziemlich genau die Gründe für Reis ablehnende Gefühle. Denn auch heute Abend würden die Eltern einen wieder ins Kreuzverhör nehmen, wo man so lange gewesen war und mit wem. Und egal, ob man darauf mit der Wahrheit antwortete oder log, der übliche nervenaufreibende Familienstreit war unausweichlich. Denn letztendlich war es das einzige Zuhause, das sie hatten.
»Diese Studententypen quatschen zwar hochtrabend vom Kampf am Produktionsort und was weiß ich noch, ignorieren aber völlig unseren innerfamiliären Kampf Die Typen haben doch keinen blassen Schimmer, um was es bei unserem Kampf überhaupt geht!« So hatte sich einmal der Kader einer Schülerorganisation einer gewissen Partei gegenüber Rei geäußert, und so oder so ähnlich empfunden es eigentlich auch Rei und alle seine Kameraden an der Schule. Deshalb fühlte sich ein parteiloser Aktivist wie Rei auch einem Schüler, der Parteimitglied war, rein emotional sehr viel enger verbunden, als einem Studenten, der wie er selbst ein Parteiloser war. Es verhielt sich eben anders als beim Kampf mit Barrikaden oder Molotowcocktails. Auf ihrem Hauptkampfplatz tobte eine permanente Schlacht, von der es immer nur für kurze Zeit Entrinnen gab. dass sie dort ausharrten, war eher ein moralisches als ein politisches Bekenntnis.
Mit seinen Gedanken an einem Ort weit entfernt von all diesen Kämpfen, döste Rei vor sich hin. Rei schlief gerne und stellte deshalb gewöhnlich sicher, dass er wenigstens zehn Stunden am Tag darauf verwendete. dass die Eltern ihn jetzt mit großer Vorsicht anpackten, nutzte er aus, indem er, abgesehen von den Mahlzeiten und dem Gang zur Toilette, die gesamte Zeit auf seinem Zimmer verbrachte. Er führte ein Leben beinahe wie ein Kranker in der Isolierstation eines Krankenhauses. Nur einmal nahm ein jüngerer Sympathisant, den die Eltern noch nicht kannten, unter dem Vorwand eines »Krankenbesuchs« Verbindung zu ihm auf und berichtete von den Plänen der Kameraden, gegen Reis Schulsuspendierung auf die Barrikaden zu gehen. Aber Rei wies ihn mit dem Hinweis ab, dass sowohl sein Ausgehen als auch sein Telefon und seine Post von den Eltern überwacht würden. Alles, was mit den Ereignissen jener Nacht zusammenhing, war ihm lästig.
Schließlich, als ungefähr eine Woche vergangen war, wurde es selbst Rei unangenehm, in seinem Zimmer eingeschlossen zu sein. Er teilte den Eltern mit, dass er in die Bibliothek zu gehen gedenke. Als Rei das Haus verließ, warfen die Eltern ihm misstrauische Blicke zu, und ihre Augen verfolgten ihn hartnäckig, bis seine Gestalt hinter einer Ecke verschwunden war. Aber Rei ging tatsächlich in die Bibliothek. Er lieh sich die Zeitungen der letzten zehn Tage und vertiefte sich in die Lektüre. Nachdem er mehrere unterschiedliche Blätter penibel untersucht hatte, musste er feststellen, dass nirgendwo ein Artikel zu finden war, der über etwas berichtete, was mit den Vorkommnissen jener Nacht zu tun hatte. Rei gab die Zeitungen zurück und ging ins Foyer. Es war ein Wochentag und in der Bibliothek war es einsam und ruhig. Als er sich zwischen ein paar ältere, scheinbar wenig beschäftigte Leute auf eine Bank setzte, erschien es ihm so, als ob die verschiedenen Ereignisse bloß Geschehnisse in einer von ihm weit entfernten Welt seien.
Natürlich wusste Rei besser als irgend jemand sonst, dass das kaum mehr als ein frommer Wunsch und eine Illusion war. Die Blutspuren auf seiner Jacke waren Beweis genug, dass sich wirklich etwas ereignet hatte. Und wenn man dem Polizisten glauben mochte, dass es sich dabei nicht um menschliches Blut handelte, dann bedeutete das auch, dass diese Leiche, die Rei zum Schluss gesehen hatte, real war. Wieso hatten die beiden Männer ihn zurückgelassen? Rei war auf der Straße zusammengebrochen, und Passanten hatten einen Notruf gemacht. So hatte es der Polizist dargestellt. Falls er an diesem Ort des Schreckens gefunden worden wäre, hätte man auch die Spritzer an der Mauer entdecken müssen. Und da seine Kleidung über und über blutverschmiert gewesen war, musste es dort auch Blutlachen auf der Straße gegeben haben. Die Bedeutung dieses schrecklichen Anblicks hätte jedem klar sein müssen und es war völlig undenkbar, dass die Ermittlungen diesem Punkt keine Beachtung geschenkt hätten.
Wenn das so war, musste Rei also, nachdem er bewusstlos geschlagen worden war, von jemand an einen anderen Ort gebracht worden sein. Und dieser jemand konnten nur die beiden Männer gewesen sein. Und vielleicht waren sie selbst ja auch die angeblichen Passanten, die den Notruf abgesetzt hatten. Aber weshalb all das und wieso? In der Nacht hatte der ältere der beiden Männer das Mädchen mit dem Schwert zweimal zurückgepfiffen. Und der andere der beiden war ganz damit beschäftigt gewesen, die Leiche in den schwarzen Sack zu tun. Er hatte Rei keines Blickes gewürdigt. Wenn sie Rei als unbequemen Zeugen loswerden wollten, wieso hatte der eine der beiden dann das Mädchen gestoppt? Als die Blicke des Mädchens Rei durchbohrten, hätte sie ihn problemlos niedermetzeln können. Er wäre gar nicht in der Lage gewesen zu schreien, geschweige denn sich zu wehren. Und wenn sie den Tatverdacht auf Rei hatten lenken wollen, war es unlogisch, dass sie ihn an einem anderen Ort ablegten, die Polizei riefen und zudem noch die Leiche einsackten, denn ohne Leiche gab es keinen Fall.
Überhaupt, schon was die Auswahl seiner Person betraf, war Rei wohl kaum der geeignete Verdächtige, auf den man den Verdacht für die Tat hätte schieben können. So sehr Rei auch nachdachte, er konnte es nicht begreifen. Nicht nur, dass man ihn an einem anderen Ort abgelegt hatte. Auch dass die Zeitungen offensichtlich keine einzige Zeile darüber verloren, war ja eigentlich ein Zeichen, dass sie mit dem Vertuschen Erfolg hatten. Es fragte sich bloß, mit welchen Mitteln sie es geschafft hatten, einen so spektakulär zugerichteten Tatort geheimzuhalten. Also, wer waren diese Kerle überhaupt? Und das Mädchen mit diesen schrecklichen Augen? Wenn eines an der ganzen Sache nachvollziehbar war, dann das Motiv, weshalb sie versucht hatten, die Leiche zu beseitigen. Soviel war sicher. Daran, so eine Leiche einfach auf der Straße herumliegen zu lassen, konnte wirklich absolut niemand Interesse haben ...
Als Rei aus seinen Gedanken erwachte, schickte die Bibliothek sich bereits an, zu schließen. Ein starkes Hungergefühl bemächtigte sich seiner und er stand auf. Wenn er jetzt direkt nach Hause ginge, käme er genau rechtzeitig zum Abendessen. Aber er konnte der Versuchung, seit langem mal wieder auswärts zu essen, nicht widerstehen und machte sich auf den Weg zu seinem Stammladen für Ramen. Rei bestellte eine große Portion Ramen und eine Portion Reis. Kurz darauf standen die Nudeln vor ihm. Er würzte die Einlage (gebratenes Gemüse) mit Sojasoße und Chiliöl und verputzte sie zusammen mit dem Reis. Über die übriggebliebene große Menge Nudeln machte er sich anschließend her. Noch während Rei sich dem Glücksgefühl hingab, das sich in seinem Körper ausbreitete, bezahlte er seine Rechnung und trat nach draußen.
Die Straße war bereits in Dämmerung gehüllt. Es war die Tageszeit, die Rei am liebsten mochte. Er hatte keine seiner Fragen klären und keines seiner Probleme lösen können, aber wenigstens war wieder mal ein Tag geschafft. Jetzt musste er nur noch zu Abend essen und schlafen. So dachte er und die geheimnisvollen Vorgänge, in die er da geraten war, begannen, ihm als das Problem eines unbekannten Fremden zu erscheinen. Aber natürlich ist es so, dass die objektiven Umstände stets unabhängig von den subjektiven Wünschen des Individuums existieren. Und vom Grad der Sattheit eines Magens lassen sie sich erst recht nicht beeindrucken. Das musste auch Rei schmerzlich erfahren, als er nach der Erfahrung des Freiheitsgefühls, das ihm sein Ausflug nach draußen für eine kurze Weile beschert hatte, wieder nach Hause zurückgekehrt war.
ZWEITER TEIL
»Hi, wie geht's?« - Rei hatte gerade die Tür zu seinem Zimmer geöffnet und erschrak sehr, als ihm der Gruß eines Unbekannten entgegen tönte. Der Mann, der auf seinem Bett saß, war mittleren Alters, nicht sonderlich groß gewachsen und wirkte von seinem Körperbau her eher schmächtig. Mit seinem abgetragenen grauen Anzug und dem ausgebeulten Mantel wirkte er wie ein Bilderbuchdetektiv, aber in seinem Blick, der Rei ohne jede Zurückhaltung musterte, lag eine merkwürdige Gier, die eher an einen herrenlosen Mischlingshund denken ließ.
»Wer sind Sie?« Reis Stimme wurde schriller. »Und wie sind Sie hier reingekommen?« Reis Eltern besaßen ein kleines vierstöckiges Mietshaus. Im Erdgeschoss befand sich der Frisörsalon, den die Mutter leitete, im zweiten Stockwerk die Wohnung der Eltern. Die Räume der beiden darüber liegenden Stockwerke waren als Büros vermietet, wobei sich Reis Zimmer im vierten Stock befand. In den Büros gab es oft Kundenverkehr, weshalb die Familie es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, alle privaten Räume verschlossen zu halten. Rei war sich sicher, auch heute beim Weggehen abgeschlossen zu haben.
»Du bist also Rei Miwa, Schüler der 12. Klasse der städtischen K-Oberschule?« Der Mann stellte sich selbst vor, in dem er aus der Innentasche seines Mantels ein schwarzes Notizbuch zog. Rei hatte diese Art von Polizeinotizbuch schon oft genug im Fernsehen und in Kinofilmen gesehen, aber hier sah er zum ersten Mal eines in Wirklichkeit. Als Rei begriff, dass es sich um einen echten Polizisten handelte, ging sein Blutdruck augenblicklich hoch, und sein Körper versteifte sich. Einen Moment lang war er sich unschlüssig, ob er fliehen sollte oder nicht, aber dann wurde ihm klar, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar keinen vernünftigen Grund gab, ihn zu verhaften oder seine Wohnung zu durchsuchen. Rei entschied, dass es Zeit war, in die Offensive zu gehen. »Dann zeigen Sie mir mal den Durchsuchungsbefehl!«
Die Polizei musste einen Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss durch einen Staatsanwalt bei Gericht beantragen lassen. Ohne ein solches Dokument war es illegal, einen Verdächtigen festzunehmen oder in seine Wohnung einzudringen.
»Es gibt keinen.«
»Dann ist es Hausfriedensbruch! Raus hier, aber sofort! Wenn Sie nicht abhauen, dann ...« An dieser Stelle geriet Rei überraschend ins Stocken.
»Na, was machst du dann, wenn ich nicht abhaue?« entgegnete der Mann und zeigte ein merkwürdig zutrauliches Lächeln. »Falls du die Polizei rufen willst - die ist schon hier. Oder willst du deinen Eltern Bescheid sagen?«
Prügele ich Sie hier raus, hatte Rei eigentlich sagen wollen, aber sein Gegenüber war immerhin ein Kripobeamter, wenn auch ein eher schmächtiger. Zudem hatte Rei nicht allzu viel Vertrauen in seine eigenen körperlichen Kräfte. Geschweige denn, dass er schon ein einziges Mal irgend jemanden geschlagen hätte. Das Vorgehen des Mannes war offensichtlich illegal, und man hätte es berechtigterweise der Polizei melden können. Aber andererseits hatte Rei seinen Stolz als (wenn auch nur unbedeutender) politischer Aktivist, der antiautoritäre Ideen vertrat. Und so etwas Schändliches wie Petzen bei den Eltern kam schon überhaupt nicht in Frage.
»Ich vermute mal, deine Eltern sind nicht begeistert, wenn sie erfahren, dass du Besuch von der Polizei hast«, sagte der Mann, als wollte er Rei damit aus der Klemme helfen. »Hör mir mal zu. Deine politischen Überzeugungen interessieren mich nicht und auch nicht, was du draußen auf der Straße so treibst. Ich möchte mit dir über etwas ganz anderes sprechen.«
»Ich wüsste nicht über was.«
»Ich schon. Wie wär's denn...« Der Mann musterte Rei mit leicht zusammengekniffenen Augen und fuhr dann mit gesenkter Stimme fort. »Wie wär's denn, wenn du mir erzählst, was du in dieser Nacht vor zehn Tagen beobachtet hast?« Als der Mann den völlig fassungslosen Gesichtsausdruck seines Gegenübers sah, entfuhr ihm ein merkwürdiges, hyänenartiges Lachen. »Na los, komm schon rein. Schließlich ist es dein Zimmer.«
Reis Niederlage war perfekt. Mit einem wütenden Blick betrat er das Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
»Gar nicht schlecht, deine Bude«, sagte der Mann, während er sich betont auffällig in dem engen Zimmer umsah.
Das Zimmer war die Frucht eines Kompromisses zwischen einem lästigen Sohn, der beabsichtigte, bei der ersten Gelegenheit das Haus zu verlassen, um auf eigenen Beinen zu stehen und seinen Eltern, die genau das verhindern wollten. Das sechs Matten (1 Matte = 1,80 m x 0,95 m) große Zimmer war von einem Tisch, einem Bett und einem relativ großen Bücherregal schon fast vollständig ausgefüllt, aber in einer Ecke fand sich ein kleines Spülbecken, und auch ein Gas- und ein Wasseranschluss waren vorhanden. Die Toilette befand sich wie in den anderen Stockwerken am Treppenabsatz im Flur, was es (abgesehen vom Baden und Essen) ermöglichte zu leben, ohne den Eltern zu begegnen. Die Haustür wurde abends nach Büroschluss abgesperrt, aber selbstverständlich hatte sich Rei längst heimlich einen Nachschlüssel machen lassen, um nachts nach Lust und Laune kommen und gehen zu können. Schon oft hatte er tief in der Nacht das Haus verlassen, sich in die Schule geschlichen und in den Klassenräumen auf den Schreibtischen Flugblätter verteilt. Wieder zu Hause hatte er dann eine Unschuldsmiene aufgesetzt und mit den Eltern gefrühstückt, um sich danach wieder auf den Weg in die Schule zu machen.
»Du wohnst also bei deinen eigenen Eltern zur Untermiete.
Über was beschwerst du dich eigentlich?« Dafür, dass er gerade ungebeten in eine fremde Wohnung geplatzt war, redete der Mann in einem geradezu erschreckend entspannten Tonfall.
»Was geht Sie das an?« entgegnete Rei. Er hatte sich demonstrativ im Schneidersitz auf den Stuhl gesetzt, wie um zu zeigen, wer hier der Herr im Haus sei »Sag du mir lieber ... « »He, seit wann werden ältere Leute nach Belieben geduzt?« »Seit sie nicht mal ihren Namen sagen.« Rei hatte seine Fassung und damit seine Schlagfertigkeit wiedergewonnen. »Ich
dachte, der Anstand gebietet es, dass man seinen Namen nennt, bevor man andere Leute blöd anmacht.«
»Hab ich meinen Namen etwa nicht genannt?« Unter dem strengen Blick von Rei kratzte sich der Mann wie zum Spaß am Kopf, schaute zur Decke und tat so, als ob er angestrengt nachdenken würde. Dann fuhr er fort, »also... Wie wär's mit Gotoda?« Das klang so, als ob er Rei auf die Nase binden wollte, dass der Name falsch sei.
»Herr Gotoda also...«, wiederholte Rei ohne einen Anflug von Lächeln.
»Ja, ich würde sagen, belassen wir's dabei.«
Ganz allgemein gesagt, lehrte die Erfahrung, dass bei einem mit Beschimpfungen und Drohungen geführten Wortgefecht eine Reihe von Regeln zu beachten waren, wenn man psychologisch die Oberhand behalten und die Sache zu seinen Gunsten entscheiden wollte. Bei einem Gegenüber, der eine konsequent einschüchternde Haltung einnahm, galt zum Beispiel die Grundregel, dass man eine mindestens ebenso einschüchternde Sprache benutzen musste wie er, um dagegenhalten zu können. Wenn aber klar war, dass man selbst der mentalen und stimmlichen Belastung des Dagegenhaltens nicht gewachsen sein würde, war es viel einfacher, statt dessen eine übertrieben gelassene Haltung einzunehmen und damit den enthusiastisch argumentierenden Gegenüber zu einem Gefühlsausbruch zu verleiten. Sobald der Gegenüber seine Beherrschung verlor, war auch seine Überlegenheit dahin, und wenn er sich dann auch noch zu Handgreiflichkeiten hinreißen ließ, war das nichts anderes als ein objektiver Beweis für seine Niederlage.
Bei einem Gegenüber, der mit logischen Argumenten zu überzeugen versuchte, war es hingegen von Vorteil für die Situation, einfach mehr als der Gegenüber zu erzählen und so die Initiative an sich zu reißen. Weil das aber eine ungeheure mentale Belastung mit sich brachte, war es mitunter geschickter, den Gegenüber einfach reden zu lassen, sich widersprüchliche Punkte herauszugreifen, diese zu attackieren und die daraus resultierende psychische Verunsicherung als Hebel zu nutzen, um sich selbst in die Position des Überlegenen zu bringen. Am aller wichtigsten war in allen Fällen ein pragmatisches Verständnis dafür, dass es bei dem, was man erzählte, nicht darauf ankam, ob der Inhalt sinnvoll war, sondern nur darauf, ob er wirkungsvoll war. »In einem Wortstreit gibt es objektive Sieger und Verlierer«, »miteinander reden heißt verstehen« und ähnliche demokratische Träumereien waren nicht nur aus psychologischer Sicht schädlich, sondern auch völlig wirklichkeitsfremd. Notwendig war deshalb (bedauerlicherweise) die Moral und Glaubensstärke eines politischen Überzeugungstäters, der kein Problem damit hatte, eine völlig auf Zweckmäßigkeit hin ausgerichtete Strategie anzuwenden, und sonst gar nichts.
All diese empirischen Regeln waren in ihrer Gültigkeit natürlich auf den Bereich der Auseinandersetzung mit Worten beschränkt. Immer dann, wenn eine Situation jederzeit in die Anwendung von Gewalt ausufern konnte - etwa beim Streit mit Mafiosi und Kleinkriminellen auf der Straße oder während eines polizeilichen Verhörs sah die Sache ganz anders aus. Wenn es um Gewalt ging, war Rei zu nichts zu gebrauchen. Solange es aber um Kniffe und Taktiken in einem Rededuell ging, besaß er ein sonderbares Selbstvertrauen. Vielleicht hatten ihn die ständigen Drohungen und Einschüchterungen der Lehrer ja soweit abgehärtet. Jedenfalls erwachte in Rei immer dann, wenn er einen älteren Gegner vor sich hatte, eine Kühnheit, die schon an Hochmut grenzte.
Unter seinen Kameraden war Rei bekannt dafür, wie er vor einem schimpfenden Lehrer plötzlich knallhart sein konnte, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Sein Ruf unter den Lehrern war freilich ein anderer. Er galt als einer, der keinerlei Spur von Reue für seine Missetaten ( etwa das Verbreiten von verleumderischen Schriften über die Schule) zeigte und den Argumenten der Lehrer nur mit grenzenlosem Hochmut und kaltblütigen Lügen begegnete. Kurzum, Rei war ein Nichtsnutz. Und Reis Erfahrung als Nichtsnutz sagte ihm, dass bei Typen wie diesem Mann mittleren Alters, der sich Gotoda nannte, besondere Vorsicht geboten war.
Rei nahm eine weiße Zigarettenschachtel der Marke »Long Peace« aus der Schublade seines Schreibtisches. Mit einer geschickten Handbewegung ließ er aus der Schachtel eine Zigarette springen, nahm sie zwischen die Lippen, zündete sie mit dem Benzinfeuerzeug an und atmete den Rauch langsam so aus, als wolle er sich in einen Nebelschleier hüllen. Gotodas Gesicht versteinerte sich. Als ob er sich dieser Veränderung vergewissern wollte, nahm Rei einen zweiten, diesmal sehr tiefen Lungenzug. Ein leichtes Rauschgefühl hüllte seinen ganzen Körper ein, und er blies den Rauch schnell und kräftig wieder hinaus in Richtung Zimmerdecke. Sein Blickfeld engte sich geringfügig ein und Nachwehen durchströmten seine untere Körperhälfte. Rei umklammerte die Lehne seines Stuhls, um gegen dieses Gefühl anzukämpfen. Falls er sich selbst außer Gefecht setzte, noch bevor er beim Gegenüber eine Reaktion provozieren konnte, würde er sich einen Bärendienst erweisen.
So wie die meisten politischen Aktivisten unter den Oberschülern waren auch Reis Kameraden fast alle Raucher, aber Rei selbst war eigentlich gar kein großer Freund des Tabaks. Er rauchte lediglich die eine oder andere Zigarette auf seinem Zimmer, um das Rauschgefühl des Nikotins auszukosten. Und die Long Peace hatte er sich bloß als Marke ausgesucht, weil ihr weißer Filter ihm gefiel. Gotodas Augen starrten wie gebannt auf die Long Peace.
»Teures Zeug, das du da rauchst ...«
Verblüfft bemerkte Rei, dass Gotoda gar nicht wütend war, sondern einfach nur selbst eine Zigarette wollte. Rei nahm den Deckel einer Bonbondose, den er öfter als Aschenbecher benutzte, und drückte die Zigarette auf sadistische Weise darin aus. Für einen Moment zeigte Gotodas Gesicht einen Ausdruck, der an einen Hund erinnerte, dem man gerade den Fressnapf weggenommen hatte. Sein Unterkiefer klappte herunter und ein Seufzer entfuhr ihm. Es war wirklich mitleiderregend. Rei überlegte einen Moment lang, ihm eine Zigarette anzubieten, ließ es aber, als er sah, dass Gotoda aus der Innentasche seines Mantels ein ziemlich zerknittertes Päckchen »Echo« holte. Es war weiß Gott nicht der richtige Augenblick, einem verarmten Polizeibeamten eine Wohltat zu erweisen.
»Also, was willst du von mir?« fragte Rei in einem bemüht kaltherzigen Ton.
»Wo fange ich am besten an ... «
»Das musst du schon selbst wissen. Du willst doch was von mir.«
Gotoda überlegte einen Moment, während der den übelriechenden Rauch seiner billigen Zigarette ausatmete und begann dann gemächlich zu erzählen.
»Auf meinen Schreibtisch liegt ein Mordfall. Das Opfer ist ein politisch aktiver Oberschüler, genau wie du.«
Diesmal war es Rei, dessen Gesicht sich versteinerte.
»Es geschah vor gut einem Monat. Die Leiche wurde in einem verlassenen Haus nicht weit vom Haus des Opfers gefunden. Die Todesursache war hoher Blutverlust.«
»Und seine Schule ist ..«
»Zu den Details komme ich später. Falls du dann noch Interesse daran hast, versteht sich«, fiel ihm Gotoda ins Wort.
Was meinte er mit »falls du Interesse daran hast«? Eine ungute Vorahnung beschlich Rei, aber letztlich siegte seine immer stärker werdende Neugier.
»Soll ich fortfahren?« »Ja, bitte.«
»Opfer Nummer zwei wurde drei Tage später in seinem Zimmer im elterlichen Haus gefunden. Auch er war ein politisch aktiver Oberschüler, und auch bei ihm war die Todesursache Blutverlust. Und weitere drei Tage später ·.•
»Wie, es gibt noch mehr?«
»... wurde ein weiteres Opfer im Uferbereich unterhalb einer Eisenbrücke über den Fluss Tamagawa entdeckt. Auch diesmal war es ein Oberschüler und wieder war es die gleiche Todesursache«, fuhr Gotoda fort, wobei er Reis erstaunten Ausruf geflissentlich ignorierte.
»Moment mal!« Rei musste einfach etwas sagen. »Weder in den Zeitungen noch im Fernsehen haben sie davon ... «
»Es war nicht in den Nachrichten«, antworte Gotoda in einem Tonfall, als wäre es das Normalste der Welt. »Junge, du glaubst doch nicht etwa daran, dass die Zeitungen und das Fernsehen immer ehrlich und unparteiisch über alle Ereignisse berichten?
»Schon... Aber immerhin ist es eine Mordserie!«
»Glaub mir, Gewalteinwirkung oder Selbstmord als Todesursachen sind heute keine Seltenheit mehr. In unseren Zeiten sind auch die Medien viel beschäftigt.«
»Du hast am Anfang gesagt, dass es Mord war.«
»Respekt, du hast ein gutes Gedächtnis.« Gotoda verzog seinen Mund zu einem Lachen, verkniff es sich aber noch im gleichen Moment. »Nun, es gibt eine Reihe von Indizien, die auf Mord deuten. Zunächst wäre da die Todesursache. Die Opfer sind an Blutverlust gestorben. Es steht fest, dass dies die unmittelbare Todesursache war, aber ihre Körper wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf abgesehen von einer Art Bisswunde am Handgelenk.«
»Eine Bisswunde?«
Ja, ganz recht. Alle drei Opfer wiesen auf der Innenseite des Handgelenks der linken Hand eine Bisswunde auf. Im Prinzip müssen sie durch diese Wunde verblutet sein, aber realistischerweise klaffen hier einige Widersprüche auf. Ich denke, dass muss ich dir nicht weiter erläutern.«
»Nein.«
»Selbst mit einer Klinge erfordert es einiges an Vorbereitung, sich am Handgelenk so zu verletzen, dass man verblutet. Und mit den paar Tropfen Blut, die man durch eine Bisswunde verliert, ist es ganz und gar unmöglich. Außerdem ... Abgesehen von winzigen Spuren an der Kleidung der Opfer konnte an den Fundorten keinerlei Blut festgestellt werden.« Gotoda zündete sich eine zweite Zigarette an und atmete langsam aus, so als wolle er Rei Zeit zum Nachdenken geben.
»Dann sind sie irgendwo anders...?«
»Im zweiten Fall war der Tatort das Zuhause des Opfers. In den beiden anderen Fällen käme zum Mordverdacht noch der Verdacht auf illegales Zurücklassen einer Leiche hinzu, zumindest solange keine Tötungsmethode identifiziert werden kann, die es plausibel als Selbstmord erklärt. Wenn man bedenkt, wie unwahrscheinlich es ist, dass in so kurzem Abstand drei Personen auf eine so merkwürdige Methode verfallen, um sich das Leben zu nehmen, ist es weitaus vernünftiger davon auszugehen, dass es sich hier um eine sehr exzentrische Mordmethode handelt, oder?«
Rei konnte nicht umhin, seinem Gegenüber zuzustimmen. »Einmal abgesehen von der Mordmethode, weisen die drei Opfer noch in weiteren wichtigen Punkten Übereinstimmungen auf.«
»He, Moment, willst du damit etwa sagen, dass alle linken Aktivisten zu Freiwild geworden sind?« Die Geschichte entwickelte sich in eine Richtung, die auch Rei selbst betraf, und sein Ton wurde schärfer.
»Nur keine voreiligen Schlüsse«, beschwichtigte Gotoda mit der Gelassenheit des Älteren.
»Es waren zwar alles radikale Aktivisten, aber wir reden nicht von Parteikadern oder Ausschussvorsitzenden oder ähnlichem. Trotzdem... dass hier einer auf die Schnelle einfach nur mal drei harmlose Oberschüler umbringen wollte, erscheint mir als Motiv doch irgendwie unnatürlich.«
»Tut mir leid, dass wir euch zu harmlos sind...«
»Du sollst mich nicht ständig anfahren, das war doch nur so eine Wendung!« Gotoda murmelte einen undeutlichen Fluch und fuhr mit seinem Bericht fort. »Terror oder innerparteiliche Streitigkeiten, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber drei Oberschüler kurz hintereinander erscheinen sogar einem Außenstehenden wie mir als eine ziemlich hohe Quote. Andererseits haben die drei, die unterschiedliche Schulen besuchten, der gleichen Organisation angehört. Und das ist wiederum in einem anderen Sinne unnatürlich.«
»Der gleichen Organisation?«
Gotoda holte aus der Innentasche seines Mantels sein Polizeinotizbuch und suchte eine bestimmte Seite heraus. »Schülerkomitee der SR-Fraktion im Proletarischen Bund. Kennst du die?«
Natürlich kannte Rei sie. Gemeinhin sprach man ja gerne von den »drei Fraktionen und dreizehn Splittergruppen des Anti-Mainstream-Flügel im Allgemeinen Studentenbund« oder auch einfach nur vom »radikalen Flügel«, aber die Wirklichkeit war komplizierter, und es gab politische Gruppierungen und Organisationen in nicht unbeträchtlicher Zahl. Aber diese »SR Fraktion« genannte Gruppe, die Gotoda erwähnte, spielte eine gewisse Rolle im militanten Flügel, und es gehörte sozusagen in den Bereich der Allgemeinbildung eines Aktivisten, sie zu kennen.
»Ja. Aber SR spricht man nicht Englisch ess-abr aus, sondern ess-err.«
Mit einem Ausruf des Erstaunens sah Gotoda von seinem Notizbuch auf. »Sieh mal einer an. Dann steckt hinter der Abkürzung also gar nichts Englisches?«
»Nein. Das ist Deutsch, glaube ich.« Vielleicht war es aber auch Russisch? So genau wusste Rei das nicht, schließlich gehörten Fremdsprachen zu den Fächern, die er am meisten hasste. »Und was bedeutet dieses SR denn nun?«
»Sozialistische Revolution. Mit SR meint man allerdings gewöhnlich die Sozialistische Revolutionäre Partei, die 1902 in Russland gegründet wurde. Sie befehligte eine Terrororganisation mit Namen Kampfgruppe und machte durch die Ermordung bedeutender Persönlichkeiten von sich reden. Im System der Ein Parteien Diktatur unter den Bolschewiki fielen sie allerdings wegen ihres angeblich typisch kleinbürgerlichen Radikalismus in Ungnade. Ihre Ursprünge liegen in der Geheimorganisation Volkswille, die sich 1879 von der Bewegung der Narodniki oder Volkstümler in Russland abspaltete, um mit den Mitteln des Terrors ...« Rei verstummte, als ihm schlagartig klar wurde, wie lächerlich es war, dass er als politischer Aktivist einem Polizeibeamten einen Vortrag über die Parteien der Russischen Revolution hielt.
»Alles in Ordnung?« Gotoda, der sich eifrig Notizen zu Reis Vortrag gemacht hatte, sah von seinem Notizbuch auf.
»Ich habe durchaus verstanden, dass angesichts der Übereinstimmungen bei Opfern und Ausführung in allen drei Fällen die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass es sich um das Werk ein und desselben Täters handelt. Aber etwas Wesentliches hast du ausgelassen ...«Rei hatte bemerkt, wie geschickt Gotoda es verstand, seinen Gegenüber einzuwickeln. Er provozierte im richtigen Moment seinen Widerspruch und lockte ihn so genau an den Punkt der Diskussion, der für ihn selbst am interessantesten war. Rei hatte entschieden, dass ein Gegenschlag nötig wäre und schlug einen härteren Ton an, als er jetzt wild drauflosredete. »Wieso wurde in den Medien nicht darüber berichtet? Immerhin ist es ein Serienmord. Noch dazu ein reichlich grotesker! Ein gefundenes Fressen für die Zeitungen, Zeitschriften und das Fernsehen! Aber nirgendwo wird darüber berichtet!«
»Man lässt sie nicht darüber berichten.« »Wer?«
»Die Polizei.«
»Die Polizei, das bist du doch?«
»Es stimmt, dass ich Polizeibeamter bin, aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass ich die gesamte Polizei bin. Solche Verallgemeinerungen stören mich. Ich wette, du hättest genauso wenig Lust, als Vertreter sämtlicher Radikaler hingestellt zu werden.«
Rei seufzte und fuhr nach einer kurzen Pause mit seinem Redeschwall fort. »Hör mal, es wird schon dunkel. Meine Mutter wird gleich kommen und mich zum Abendessen rufen. Wenn ich nicht gleich runterkomme, klopft sie solange an die Tür, bis ich rauskomme. So ist sie nun mal, meine Mutter.«
»So sind alle Mütter.«
»Ich hab keine Lust, dich hier allein in meinem Zimmer zurückzulassen und noch weniger, dass meine Mutter dich zu Gesicht bekommt. Und dass ich mit dir hier die ganze Nacht durch quatsche, kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen!
»Schon gut. Ich komme zur Sache.« Gotoda gab ohne viel Aufhebens klein bei und durchsuchte die Innentasche seines Mantels, um sich eine dritte Zigarette herauszuholen, doch offenbar war ihm das Rauchmaterial ausgegangen. Während er jetzt die klassische Schauspielnummer aufführte und die Hände überall suchend in seine Taschen schob, warf er einen unverhohlenen Blick auf Reis Long Peace.
»Äh... darf ich?«
Für einen Kriminalbeamten zeugte das von einer geradezu verblüffenden Verkommenheit, aber Rei hatte es eilig und warf ihm die Schachtel hin. Der hoch erfreute Gotoda nahm eine Zigarette heraus, steckte sie sich in den Mund und ließ dann - und das war noch verblüffender - die Schachtel einfach in seiner Manteltasche verschwinden. Und falls diese Nummer auch geschauspielert war, dann beherrschte er sie in einer Perfektion, die allerhöchstes Lob verdiente. Gotoda zündete die
Zigarette mit einem billigen Einwegfeuerzeug an und blies einen mächtigen Schwall Rauch in Richtung Decke.
»Wo waren wir stehengeblieben?«
»Verdammt, ich will endlich wissen, was du hier zu suchen hast!« Rei wusste, dass es seinem Gegenüber nur zustatten kam, wenn er sich ärgerte und herumschrie, aber er konnte seinen Ärger einfach nicht mehr unterdrücken und wurde laut. »Was hat der Serienmord, von dem du erzählt hast, mit mir zu tun?«
Gotoda, der sichtlich genussvoll seine Long Peace schmauchte, starrte Rei mit unerklärlich fröhlichen Augen an.
»Nun, wir haben zunächst einmal die SR-Fraktion und ihre Schülerorganisation abgeklopft. Das ist der normale Gang der Ermittlungen. Schließlich könnte es noch weitere Opfer geben. Also haben wir eine Liste der Mitglieder dieser Schülerorganisation und ihrer Schulen erstellt. An deiner Schule sind wir auch fündig geworden. Dort gibt's eine Zelle.«
Er hatte recht. Auch an Reis Schule gab es Aktivisten der SR Fraktion. Auch wenn das Wort »Zelle« in diesem Zusammenhang ziemlich extravagant war. Gotoda blickte erneut in sein Notizbuch und las vor.
»Seiji Aoki, siebzehn Jahre alt. Das ist doch ein Kumpel von dir, oder?«
»Du glaubst doch selbst nicht, dass ich mich dazu äußere?« Selbst wenn Gotoda nicht vom Staatsschutz war, sondern bloß ein Kripobeamter, der einen Mordfall untersuchte (und nicht einmal dafür gab es einen sicheren Beweis), war es schlichtweg undenkbar, dass Rei Informationen über die Organisationen in seiner Schule verriet.
»Die SR-Fraktion scheint eine ziemlich kleine Organisation zu sein. Nach unseren Informationen besteht sie aus etwa 50 Arbeitern und Studenten. Zählt man die Sympathisanten mit, bringt sie kaum mehr als 100 Personen auf die Beine. Es gibt lediglich sieben Oberschüler in ihren Reihen ... Im Stadtgebiet von Tokio gibt es vier Oberschulen, die über eine Zelle der SR-Fraktion verfügen. Die drei Getöteten stammen aus drei dieser Zellen. Damit bliebe noch eine übrig. Und das ist die an deiner Schule.«
»Und wenn schon.« Rei begann langsam zu erahnen ,worauf Gotoda hinauswollte, stellte sich aber weiter stur. »Wieso gerade ich?Wenn du was über ihn wissen willst, wieso gehst du nicht direkt zu ihm?«
»Es stimmt doch, dass du vor 10 Tagen eingebuchtet worden bist.«
»Ich wurde nicht verhaftet ...« Rei wollte sagen, dass man ihn zu seinem eigenen Schutz inhaftiert hatte, schluckte den Rest des Satzes aber hinunter. »Die Verhaftung war nicht gerechtfertigt! Sie haben mich drei Tage lang festgehalten, obwohl sie nichts gegen mich in der Hand hatten! Aber dank der ganzen Sache wurde ich ... «
»... für drei Wochen von der Schule suspendiert, richtig?« Gotoda verfiel in ein hämisches Lachen. »Ob die Inhaftierung gerechtfertigt war oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Von Bedeutung ist der Zustand, in dem man dich aufgefunden hat. In dem ärztlichen Attest, das auf meinem Schreibtisch gelandet ist, war davon die Rede, dass man große Mengen von Blutspuren auf deiner Kleidung gefunden hat, aber keine äußerlichen Wunden, die als Quelle in Frage kommen. Dafür aber Spuren eines leichten Schlages auf deinen Hinterkopf. Keine Hinweise auf innere Blutungen, EEG regelmäßig. Für so einen Schlag muss man ja fast dankbar sein, was?
»Na und?!« Rei spürte, dass sich das Gespräch seinem eigentlichen Ziel näherte, und bemühte sich, seine Augen nicht von Gotodas Gesicht zu lassen, während er antwortete. »Ich wurde von jemandem niedergeschlagen und später blutüberströmt auf der Straße entdeckt. Aber was hat das mit deinem Fall zu tun?«
»Das Problem ist das Blut. Allem Anschein nach war es kein menschliches Blut.«
In Rei tobte ein Kampf. Einerseits spürte er einen Drang, herauszufinden, was dieser Gotoda alles über ihn wusste, andererseits wollte er es vermeiden, auf den schrecklichen Anblick jener Nacht zu sprechen zu kommen.
»Was... war das für ein Blut?«
»Also, da es kein menschliches Blut war, gibt es sozusagen auch keinen Fall. Und die Leute von der Spurensicherung sind viel zu beschäftigt, um Zeit auf ein Beweisstück zu verwenden, das nichts mit einem Fall zu tun hat ... Was hast du mit der Kleidung gemacht?«
»Hä?«
»Ich rede von der blutverschmierten Kleidung. Da es keinen Fall gab, können sie auch nicht als Beweismittel beschlagnahmt worden sein.«
Tatsächlich hatte Rei bei seiner Entlassung die Jacke zusammen mit seinen Schuhen und dem Gürtel zurückerhalten. Aber er konnte natürlich schlecht mit einer blutverschmierten Jacke durch die Stadt laufen, auch wenn das Blut sich nach drei Tagen schon fast schwarz verfärbt hatte. Also trug er die Jacke unter dem Arm nach Hause. »Zu Hause habe ich als allererstes gebadet. Als ich aus dem Bad kam, war von der Unterwäsche bis zu den Socken alles weg. Entweder hat meine Mutter die Sachen gewaschen, oder sie hat alles weggeschmissen, weil sie den Anblick nicht ertragen konnte.«
Gotoda kratzte sich zwischen seinen streng nach hinten gekämmten Haaren und begann, wie ein Hund zu knurren. Idiot! Das waren wichtige Beweisstücke ...!«
»Ich lass mir diesen Tonfall nicht länger bieten!« knurrte Rei unwillkürlich zurück. »Ist doch irgendwie seltsam ... Bei deinen drei Fällen wurde am Tatort kein einziger Tropfen Blut gefunden. Aber der Tatort, den ich gesehen habe ...« War voller Blut, verkniff es sich Rei gerade noch zu sagen. Aber da war es schon zu spät. Gotoda hatte es geschafft, ihn in eine Falle zu locken und klopfte ihm jetzt mit einem zufriedenen Lächeln auf die Schulter. »Du hast es also gesehen«, sagte er freudestrahlend.
Rei fühlte sich wie in einer zweitklassigen Krimiserie und ließ erst einmal die Schultern hängen. Genau auf diesen Augenblick schien Gotoda gewartet zu haben, als er Rei jetzt ein Foto vorlegte. Und dieses Foto versetzte Rei einen Schock, der ihm das Blut im ganzen Körper erstarren ließ.
»Das ist es doch, was du gesehen hast, oder?«
Es schien die Reproduktion eines Fotos aus einem Ausweis zu sein, sehr körnig und mit schwammigen Konturen, aber Rei erkannte das Mädchen zweifelsfrei wieder. Das, was von ihrer Schuluniform auf dem Foto zu sehen war, stimmte nicht mit Reis Erinnerung überein, aber diese ungemein bleiche, beinahe leblos wirkende Haut, und die im Kontrast dazu stechen den Augen...
»Woher hast du dieses Foto?«
»Als ich das Umfeld der drei Toten abklopfte, bin ich da auf eine hochinteressante Sache gestoßen. Bei allen dreien ist wenige Tage vor dem Mord eine neue Schülerin in die Klasse gekommen, die wenige Tage nach der Tat wiederum an eine andere Schule gewechselt ist. Ich habe die Schulen darum gebeten, mir die Unterlagen für die Schulanmeldung zu schicken, und es stellte sich heraus...«
»... dass es immer dieselbe Person war?«
»Dreimal innerhalb von zehn Tagen die Schule zu wechseln ...
Und jedes mal gibt es in der Klasse einen Toten. So jemand ist doch in höchstem Maße...«
»... verdächtig?«
»Reden wir vorläufig lieber von einem wichtigen Zeugen«, fuhr Gotoda mit einem furchtbar ernsthaften Gesichtsausdruck fort, während er das Foto in sein Notizbuch legte und in der Innentasche seines Mantels verstaute. »Saya Otonashi, siebzehn Jahre alt ... Die übrigen Angaben in den Papieren stimmen nicht überein und sind im übrigen frei erfunden.«
Rei erinnerte sich genau, dass der größere der beiden Ausländer das Mädchen in jener Nacht »Saya« gerufen hatte. Aber vielleicht waren ihr Name und ihr Alter, ja vielleicht sogar ihre Existenz an sich, einfach eine Erfindung? Dieser Zweifel kam Rei unwillkürlich, ohne dass es dafür einen Grund gab.
»Und wohin ist dieses Mädchen verschwunden?« »Verschwunden?« flüsterte Gotoda, während er seine Stirn runzelte. »Es war nicht die Rede davon, dass sie verschwunden ist.«
»Aber wo ist sie dann?«
»Sie ist seit drei Tagen an einer neuen Schule. Und zwar an deiner Schule.« Während Rei noch völlig nach Worten rang, legte Gotoda nach. »Sie ist in der 12-D. Das müsste die Klasse von deinem Kumpel Seiji Aoki sein, wenn ich mich nicht irre?« Rei musste all das erst einmal verdauen und war für einen Augenblick völlig abwesend. Erst der an einen Hund erinnernde, muffige Atem des Mannes direkt vor ihm ließ ihn wieder zu sich kommen.
»He, hörst du noch zu?«
Während Rei versunken das Gesicht des Mannes vor sich betrachtete, haderte er mit seinem Schicksal, das dafür sorgte, dass ihn diese Sache immer wieder einholte. Selbst wenn er schwieg und so tat, als ob er sich an nichts erinnerte, würde die Angelegenheit nicht mehr einfach so spurlos vorübergehen. Während dieser einen Woche, in der er zu Hause nach Herzenslust der Völlerei und dem Schlaf gefrönt hatte, war die ganze Sache mit einer erschreckenden Geschwindigkeit bedrohlich nahe an seine Umgebung herangerückt. Rei musste daran denken, wie in seiner Ahnungslosigkeit schon die große Portion Tammen Nudeln gereicht hatte, um ihn in Sicherheit zu wiegen, und ein Gefühl von Abscheu und Wut auf sich selbst überkam ihn.
»Na los, spuck's schon aus...«
Auch Gotodas Spruch, in dem irgendwie mitschwang, dass es Rei danach besser gehen würde, war wie aus einer Krimiserie. Und Rei spuckte es aus. Bei Redegefechten, das lehrte ein weiterer wichtiger Erfahrungssatz, war diejenige Person in der überlegenen Position, die mehr Informationen verheimlichen konnte. Um einem Kripobeamten wie Gotoda, der sich schon von Amts wegen meisterlich auf derlei Kniffe und Taktiken verstand, Paroli zu bieten, war Rei ganz einfach noch zu jung.
»Eine Oberschülerin mit einem blutverschmierten Schwert und zwei Ausländer? Soso ...«Es war nicht klar, ob Gotoda, der sich eifrig Notizen machte, das glaubte, was Rei ihm erzählte, aber er erzählte ihm alles, was er in jener Nacht gesehen hatte. Mit Ausnahme eines Punktes. »Die Sache stinkt gewaltig. So gewaltig, dass sich einem die Nase krümmt«, sagte Gotoda während er sein Notizbuch schloss und dabei die Nase kräuselte.
»Blutleere Leichen. Bisswunden am Handgelenk. Tatorte ohne einen Tropfen Blut und solche mit Blutlachen. Ermordete Oberschüler und ein Mädchen, das ständig die Schule wechselt ... Manche Leichen werden einfach liegengelassen, andere beseitigt...«
»Ich frag mich, wie das alles zusammenhängt«, sagte Rei, um das Eis bei Gotoda zu brechen, der sich am Kopf kratzte und etwas vor sich hinmurmelte.
»Nun, das werden wir erst noch ermitteln müssen.« »Wir?«
»Ich rede von uns beiden, von dir und mir«, sagte Gotoda in einem merkwürdig aufgeräumten Tonfall.
»Moment mal!« platzte Rei angesichts dieser völlig neuen Entwicklung heraus. »Wieso ich? Ich bin doch bloß ein Zeuge! Wieso soll ich mit so einer fiesen Sache .•
»Ein Zeuge?« fuhr Gotoda mit einem verwunderten Gesichtsausdruck fort. »Ich würde sagen, du steckst mittendrin! Ich habe keine Ahnung, wieso das Mädchen dich nicht einfach niedergemacht hat, aber sowohl diese beiden merkwürdigen Ausländer als auch das dubiose Mädchen kennen dein Gesicht! Nicht zu vergessen, dass der nächste auf der Liste einer von deinen sogenannten Gesinnungsgenossen sein dürfte!«
»Dann sind sie also hinter ihm her?«
»Von sieben Aktivisten sind drei bereits ermordet worden, und von den übrigen vier sind drei seit mehreren Monaten weder in der Schule noch zu Hause gesehen worden. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Der einzige, den wir dingfest machen konnten, ist dein Kamerad Seiji Aoki, und dieses dubiose Mädchen ist jetzt an seine Schule gewechselt und klebt an ihm. Das ist doch mehr als verdächtig.«
»Und wieso verhaftet ihr das Mädchen nicht einfach?« »Unter welchem Verdacht bitte schön?«
»Na ja... Immerhin bin ich doch Augenzeuge...« »Hast du die Leiche am Tatort gesehen?«
Natürlich hatte er sie gesehen. Hätte er sie nicht gesehen, wäre seine Lage vielleicht gar nicht so hoffnungslos. Aber er hatte sie gesehen, soviel war sicher. Und wenn er davon erzählte, ginge es um mehr als nur ein Mädchen mit einem Schwert und eine groteske Mordserie. Aber soweit würde es erst gar nicht kommen. Denn Gotoda, der in diesem Fall ermittelte, würde ihm die Sache gar nicht erst ohne weiteres glauben.
»Ich bin mir nicht sicher, es war so dunkel. .. « »Angenommen deine Geschichte ist wahr und die beiden Ausländer haben die Leiche tatsächlich weggeschafft, wird sie nicht so leicht wieder auftauchen.« Gotoda fuhr in einem Ton fort, als wolle er Rei alles noch einmal vorkauen. »Jetzt hör mir mal gut zu. Es gibt keine Leiche, du erinnerst dich nicht genau, wo es war und der Zeuge ist ein politisch radikaler Oberschüler, der gerade vom Unterricht suspendiert ist. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendein Gericht aufgrund so einer Geschichte einen Haftbefehl ausstellt?«
»Mag ja sein, dass ich mich nicht genau erinnere, wo es war, aber so, wie es da aussah, alles voller Blut und auch die Blutspritzer auf der Mauer ... «
»Wir wissen noch nicht mal, ob es menschliches Blut war, richtig? Wir leben in einer Zeit, in der irgendwelche durchgeknallten Typen Schweine- oder Hühnerblut auf einer Bühne verspritzen und das Kunst nennen. Wenn jemand so was anzeigt, wird es als Dummejungenstreich zu den Akten gelegt. Kannst du denn mit Bestimmtheit ausschließen, dass das Opfer dieses Mädchens nicht vielleicht ein streunender Hund oder was weiß ich was war?«
Nein, es war kein Hund gewesen. Das konnte Rei mit Bestimmtheit sagen. Er konnte es nur nicht aussprechen. »Meine Geschichte, ist sie...?«
»Ob sie glaubwürdig ist? Ja, ich glaube dir«, sagte Gotoda ohne Umschweife. »Es gibt keine Beweise ... Aber zumindest weiß ich, dass du nicht lügst. Wieso ich das Mädchen trotzdem nicht festnehmen kann, habe ich dir ja schon erzählt.«
»Wieso lädst du sie nicht einfach als wichtige Zeugin vor und quetscht sie dann im Verhör so richtig aus? Mich habt ihr schließlich auch drei Tage ohne Grund festgehalten!«
»Das geht nicht.«
»Wieso geht das nicht?!«
»Ich bin nicht mehr mit den Ermittlungen betraut«, murmelte Gotoda und sah Rei dabei traurig an. »Ich meine, nicht nur ich persönlich. Der ganze Fall wurde von der Kriminalpolizei an die Staatsschutzpolizei übertragen. Auch die Sonderkommission wurde aufgelöst, bevor wir unser Türschild aufhängen konnten.«
»Aber wieso? Was...?!«
»Na was wohl... Da hat jemand interveniert. Es gab Druck.
Und zwar von einem Kerl, der so mächtig ist, dass er sogar die Zeitungen und das Fernsehen zum Schweigen gebracht hat.« »Und die Aufsichtsbehörden? Was ist mit dem Polizeipräsidenten?«
»Wir haben eine demokratische Polizei. Am Tag, an dem herauskommt, dass so etwas vertuscht wurde, gibt es einen Riesenskandal. Wahrscheinlich wird der Druck deshalb sehr weit oben ausgeübt.«
»Weit oben? Und wer soll das sein?« platzte Rei heraus. »Woher soll ich das wissen!« Auch Gotoda, der sich von Rei anstecken ließ, begann jetzt zu schreien. »Ich bin nur ein einfacher Polizeiwachtmeister, drei Ränge über einem Streifenpolizisten und acht Ränge unter einem Polizeipräsidenten! Woher soll ich wissen, was die Kerle da oben treiben?!«
»Nicht so laut!! Was soll ich machen, wenn meine Mutter kommt?«
»Ruf deinen Vater zur Hilfe!«
Gotoda zündete sich eine dritte Long Peace an, um seine Erregung zu unterdrücken. Rei spitzte die Ohren und lauschte, ob sich im Treppenhaus etwas tat, aber seine Mutter schien noch im Geschäft zu sein. Eine Reaktion auf ihr explosives Redegefecht blieb aus.
»Scheint, dass die Luft rein ist.«
»Mal was anderes. Mich würde interessieren, was ein Beamter, der von den Ermittlungen abgezogen wurde, überhaupt noch hier zu suchen hat?«
Das Gesicht von Gotoda, dem das Nikotin eine gewisse Gelassenheit zurückzugeben schien, verzerrte sich wieder zu einem hyänenartigen, hämischen Grinsen.
»Nennen wir's Hartnäckigkeit. Ich kann eben nicht gut schlafen, wenn ich so einen dubiosen Fall aus der Hand geben muss. Außerdem wäre da noch mein Instinkt. Und der sagt mir, dass sie beim Staatsschutz ihre liebe Mühe mit dem Fall haben.«
»Weil es kein rein politischer Fall ist?«
»Ja, hinter diesem Fall steckt viel, viel mehr. Da bin ich mir sicher.«
»Und in so eine Geschichte willst du mich mit reinziehen?« »Wie gesagt, du steckst doch längst mittendrin. Willst du etwa tatenlos zusehen, wie es deinen Kumpel erwischt? Das wäre wenig rühmlich für einen Politaktivisten wie dich. Und wer sagt uns, dass du nicht auch noch dran glauben musst?« Gotoda hielt seinen Blick auf Rei gerichtet und fuhr fort. »Die Polizei wird dich nicht beschützen. Falls du nur ein kleines bisschen Rückgrat hast, wirst du erst gar nicht zur Polizei gehen und um Hilfe betteln. Also entscheide dich. Beim nächsten Mal wird's nicht bei ein paar blauen Flecken bleiben!«
Rei nahm die Zigarette aus Gotodas Hand und inhalierte tief. »Es gibt ein Problem.«
»Und das wäre?«
»Du weißt, wer ich bin und kennst meine Schule. Und da du hier bist, kennst du auch meine Adresse.« Rei bemühte sich, möglichst kontrolliert nachzusetzen. »Aber ich weiß von dir nichts, außer dass du Polizist bist.«
»Wie gesagt, ich heiße Gotoda.« Mit einem Seufzer holte Gotoda sein Notizbuch aus der Manteltasche, öffnete es und hielt es Rei unter die Nase. Unter einem Stempel mit dem Schriftzug Polizeipräsidium, Kriminalpolizei, 1. Dezernat stand in einer erschreckend ungelenk wirkenden Handschrift Hajime Gotoda.
Es gibt noch ein Problem.« »Was denn noch...«
»Wie bist du hier reingekommen?«
»Ach, wenn's weiter nichts ist ...« sagte Gotoda scheinbar fröhlich und ohne Umschweife. »Bittet, so wird euch gegeben; Klopfet an, so wird euch aufgetan ... «
DAS MANÖVER
Radikales Netzwerk
ERSTER TEIL
Radikales Netzwerk
ERSTER TEIL
Der Raum der »Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaften an der Städtischen K-Oberschule«(kurz »AG Soziales«) befand sich zusammen mit einer Reihe weiterer Klubräume im ersten Obergeschoss des »Klubgebäudes« direkt gegenüber dem Sportgelände der Schule. Entlang des Weges, der vom Haupttor vorbei an der Vorderseite des Klubgebäudes und den Sportanlagen bis hin zum Hauptgebäude der Schule führte, erinnerte eine Reihe von Ginkgo-Bäumen an die Zeit vor dem Weltkrieg, als sich hier noch eine Mittelschule der alten Präfektur Tokio befand. Für den aufmerksamen Betrachter strahlte diese alte Baumreihe noch eine gewisse Eleganz aus, aber bedauerlicherweise war das vor wenigen Jahren errichtete Klubgebäude selbst ein trostloser Stahlbetonbau. Ursprünglich war es gebaut worden, um all den schulischen Sportklubs wie der Baseball-AG, der Leichtathletik-AG, der Fußball-AG und anderen, die das gegenüberliegende Sportgelände nutzten, ein Zuhause zu geben. dass die AG Soziales, die zu den geisteswissenschaftlich ausgerichteten Gruppen gehörte, ein Zimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes besaß, war eine reichlich merkwürdige Geschichte, deren Gründe so recht niemand erklären konnte. Es gab eine durchaus plausible Theorie, wonach es sich um eine Maßnahme der Schulleitung gehandelt hatte, weIche die AG Soziales, die ähnlich wie die AG Kultur und die Zeitungs AG im Verdacht stand, ein Nährboden für linkslastige Schüler zu sein, inmitten der Sportklubs möglichst stark isolieren wollte. Aber ebenso gab es Gegenstimmen,die die Auffassung vertraten, es handele sich dabei allein um das Verdienst früherer Jahrgänge in der AG Soziales, die hier den am schwersten einsehbaren Platz der Schule quasi gewaltsam für sich erobert hätten. Wie dem auch sei, es war unklar, was an diesen Theorien wahr oder falsch sein mochte.
Im Klubraum saßen Rei und fünf seiner Kameraden um den großen, runden Holztisch, der den einzigen Einrichtungsgegenstand bildete. Alle Anwesenden waren Mitglieder des »Kampfkomitees für Demokratisierung der städtischen K-Oberschule«(genauer gesagt waren es die einzigen Mitglieder des Kampfkomitees) und zugleich Angehörige der AG Soziales.
Das Erste, was Gotoda von Rei verlangt hatte, nachdem dieser in eine Zusammenarbeit eingewilligt hatte, war, dass Rei die Kooperation der übrigen Mitglieder der Gruppe sicherstellen sollte. Die eigentliche Ermittlungsarbeit war selbstverständlich Sache eines Profis und damit Gotodas, aber das unauffällige Sammeln von Informationen innerhalb der Schule gestaltete sich für einen Polizeibeamten wie ihn schwierig. Da Rei vom Unterricht suspendiert worden war und nicht ohne weiteres in der Schule herumspionieren konnte, hatte er gar keine andere Wahl, als sich um die Mitarbeit der anderen zu bemühen. Es war nicht Reis Wunsch, seine Kameraden in so eine zwielichtige Sache hineinzuziehen, aber er konnte auch nicht einfach die Tatsache ignorieren, dass Seiji Aoki ein potentielles Mordopfer war. Also hatte Rei von einer Telefonzelle in der Nähe seiner Eltern Murasakino, den Leiter der AG Soziales, angerufen und ihn gebeten, eine Versammlung einzuberufen.
Das war gestern Abend, nach Gotodas Besuch bei Rei, gewesen. Die durchs Fenster des Klubraums scheinende Frühjahressonne begann bereits, sich zu neigen. Auf der anderen Seite des Fensters klangen weit entfernt vom Sportplatz her die monotonen Schlaggeräusche und seltsamen Anfeuerungsrufe der Mitglieder der Baseball-AG. Die Sitzung hatte unmittelbar nach Unterrichtsende begonnen, aber erst jetzt war Rei mit seinem ausführlichen Lagebericht fertig geworden. Die Zeit des Schulschlusses rückte näher.
»Aber ansonsten tickst du noch ganz richtig?« Den Anfang machte Murasakino, der Leiter der AG, der bei derartigen Sitzungen auch gleichzeitig das Wort führte. »Hast du irgendeine Idee, weIche Anstrengungen wir hier zur Vorbereitung des Kampfes gegen deine Suspendierung unternommen haben, während du zu Hause Winterschlaf gehalten hast? Und jetzt, wo du dich endlich mal wieder blicken lässt, fällt dir nichts Besseres ein, als ausgerechnet mit den Bullen gemeinsame Sache zu machen und in der Schule herumzuschnüffeln? Ich glaube fast, die drei Tage im Knast sind dir irgendwie zu Kopf gestiegen!«
Was Propagandaaktivitäten wie das Verteilen von Flugblättern an der Schule betraf, war Murasakino die wichtigste Person. Innerhalb des Komitees gehörte er zur gemäßigten Fraktion, die sich für die nüchterne Fortführung des »innerschulischen Kampfes« einsetzte. In der elften Klasse hatte er wegen einer Tuberkulosebehandlung längere Zeit dem Unterricht fernbleiben müssen, was ihn um ein Schuljahr zurückwarf. Murasakino war somit der älteste der Kameraden und wirkte neben Rei und den anderen, die mehr durch radikale Äußerungen als durch deren konsequente Umsetzung in Taten auf sich aufmerksam machten, auf merkwürdige Weise reif und erwachsen. Er hatte sich nicht nur dadurch Verdienste erworben, dass er von seinen selbst verdienten Ersparnissen eine Matrizenkopiermaschine gekauft und ein System zur regelmäßigen Verteilung politischer Flugblätter organisiert hatte, sondern besaß auch das nötige Pflichtbewusstsein, um durch das emsige Einsammeln von Spendengeldern die nötigen Mittel für Papier, Druckertinte und anderes mehr heranzuschaffen. Als Leiter der AG Soziales kümmerte er sich sowohl um die Verhandlungen mit der Schulleitung und der Schülervertretung als auch um allerlei lästige Formalitäten. Für Rei und die übrigen Straßenkämpfer war er deshalb so wertvoll und unentbehrlich, dass sie ihm stets mit einem gewissen Respekt begegneten. »Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie es überhaupt um das objektive Vorhandensein dieser angeblichen Mordserie bestellt ist? Was macht dich so sicher, dass das alles nicht einfach nur Gequatsche von diesem Gotoda ist?«
»Na ja, zumindest ist es eine Tatsache, dass diese Saya oder wie sie heißt an unsere Schule gewechselt ist.« Mit dieser Äußerung nahm Nabeta Rei in Schutz. Nabeta war ein ehemaliges Mitglied der AG Literatur und als ein radikaler Verfechter des Straßenkampfs für das Entwerfen der Flugblätter zuständig.
»Meinetwegen ist es eine Tatsache. Aber was soll das schon beweisen?« entgegnete der hartnäckig misstrauische Murasakino.
»Das Mädel soll aber verdammt gut aussehen ...« Diese völlig neue Sichtweise des Problems vertrat Amano, der als Frohnatur nicht so recht zu den Aktivisten passte und dessen Unbedarftheit ihm bisweilen abschätzige Blicke von seinen Kameraden einbrachte. Doigaku, der neben ihm saß, verzog das Gesicht. Während er seine langen Haare, die sein ganzer Stolz waren, hochkämmte, sagte er in einem leicht nervös klingenden Tonfall:
»Was tut das zur Sache, ob sie gut aussieht, oder nicht? Vielleicht ist diese Frau ja eine Mörderin. Zumindest wenn man Rei glauben schenkt ..•
»Das ist genau der springende Punkt ... Ob wir Rei glauben wollen. Davon hängt doch alles ab, oder nicht?«
»Zieht die Sache nicht ins Lächerliche«, mahnte Murasakino und machte Amanos allzu naive Schlussfolgerungen mit einem Schlag zunichte. »Hört mal gut zu. Angenommen, diese Frau mit dem Schwert, die Rei beobachtet haben will, existiert wirklich ... «
»Die ist bestimmt 'ne Rechtsextreme, diese Frau«, plapperte Amano, der von Natur aus nicht sehr lernfähig war, schon wieder dazwischen. Doigaku und Nabeta sprangen darauf an. »Wenn sie wirklich eine rechte Terroristin wäre, hätte sie es doch auf viel wichtigere Leute abgesehen. Das wäre ja geradezu erbärmlich, herumzulaufen und Oberschüler umzubringen.«
»Diese Morde passen doch schon von der Methode her gar nicht zu dieser Frau. Einerseits das blutverschmierte Schwert, andererseits die drei Toten, denen man das Blut praktisch raus gezogen hat.«
»Ich frag mich, was an dieser ganzen Geschichte überhaupt stimmt. Die drei wurden der Reihe nach ermordet, und das auch noch auf nicht gerade alltägliche Art und Weise. Sie hatten doch alle Familie und Nachbarn und so, die was bemerkt haben müssen ... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so was wirklich geheim halten kann.«
»Na ja, Eltern würden so eine Sache ja nicht unbedingt von sich aus herumerzählen. Und wenn ihnen die Polizei auch noch das Reden verboten hat, ist es völlig normal, dass sie beharrlich schweigen.«
»Aber man hat die Opfer ausbluten lassen, bis auf den letzten Tropfen. Es dauert doch ewig, jemanden so umzubringen. So begeht man doch normalerweise keinen Mord, oder?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Na ja, es soll ja blutige Säuberungen und Strafaktionen und
so was geben ... «
»Du meinst also, es war eine Säuberung durch Ausbluten?« »Mann, ihr redet ja wie die Metzger ... «
»Dann ist also doch alles erfunden.«
»Ich dachte, diese Art von Krimi, wo der tapfere und aufrichtige kleine Kripobeamte vor Ort sich heldenhaft gegen den Druck von oben durchsetzt, wäre längst außer Mode?
»Aber sein Polizeinotizbuch hatte er doch, oder?«
»Idiot, so was kannst du dir an jeder Straßenecke für ein paar Yen kaufen.«
»Das mit dem 1.Dezernat ist auch irgendwie verdächtig.« »Tja, wir können schlecht einfach im Polizeipräsidium anrufen und nachfragen.«
»Nach dem Motto, guten Tag, gibt es bei ihnen einen Kripobeamten, der Gotoda heißt?«
»Man nehme einen vorgetäuschten Mordfall als Vorwand, um sich an eine Gruppe politischer Aktivisten heranzumachen und ihre internen Angelegenheiten auszuhorchen ... «
»Du glaubst doch nicht, dass der Staatsschutz sich mit ein paar Jungs wie uns solche Arbeit machen würde?« »Außerdem gibt's bei uns keine internen Angelegenheiten, bei denen sich eine Suche lohnen würde ... «
»Ja, wenn sie was über uns wissen wollen, können sie die Schulleitung fragen.«
»Die Typen haben eben ihre eigenen Methoden.«
»Also wenn ihr mich fragt, ist diese ganze Geschichte völlig absurd...«
»Verdammt, wie oft soll ich's noch sagen, nichts davon ist erwiesen!« Murasakino war damit gescheitert, die Diskussion in vernünftige Bahnen zu lenken und hatte mit ansehen müssen, wie sie zunehmend in leeres Geschwätz ausartete. Jetzt war ihm endgültig der Kragen geplatzt. »Hört endlich auf, Vermutungen aufgrund von Hörensagen anzustellen oder nutzlose Diskussion auf der Basis ungesicherter Informationen zu führen! Seht es nüchtern und geht von den objektiven Tatsachen aus...«
»Schön, aber du hast doch eben selbst gesagt, dass es in diesem Fall keine erwiesenen Tatsachen gibt!« Nabeta klang so, als ob er langsam genug davon hätte. »Ich will nicht unbedingt das unterstützen, was Amano gesagt hat, aber ist es denn nicht doch so, dass letztlich alles davon abhängt, ob wir Rei glauben wollen, oder nicht?«
»Also, was? Hast du das wirklich gesehen?« Amano neigte sich nach vorne und starrte Rei in die Augen. »Oder war alles nur ein Alptraum, den du hattest, nachdem du niedergeschlagen wurdest? Eine Oberschülerin mit einem blutigen Schwert, das klingt doch ganz so, als ob's aus irgendeinem Film wäre!«
»Richtig. Wie aus einem Film von Teruo Ishii«, ergänzte Doigaku, der Fan von traditionellen Yakuza Filmen war.
»Ich hab's!« rief Amano mit sich überschlagender Stimme, als ob ihm gerade irgendein Licht aufgegangen sei. »Die haben da einen Film gedreht, und Rei ist hineingeraten ...«
»Idiot! Niemand dreht an so einem Ort und um so eine Uhrzeit einen Film!« sagte Doigaku.
»Außerdem wird man nicht gleich niedergeschlagen, nur weil man den Set eines Films gesehen hat«, fügte Nabeta hinzu. »Es könnte das Ritual einer zwielichtigen Sekte gewesen sein oder die Probe einer Rockband oder ... «
»Dann erkläre mir verdammt noch mal, wieso irgend jemand so etwas ausgerechnet am Abend einer Antikriegsdemo und inmitten all der Ausschreitungen durchführen sollte!« donnerte Murasakino den nicht locker lassen den Amano an.
»Ich hab es aber gesehen ... « murmelte Rei nach langem Schweigen, und die Augen aller ruhten mit einem mal auf ihm. Hatte er es wirklich gesehen oder glaubte er nur, es gesehen zu haben? Mit dieser Frage hatte er sich beständig gequält, und mitunter hatte er heimlich darum gebeten, es doch nach Möglichkeit dabei belassen zu dürfen, dass er es nicht gesehen hatte. Aber als er jetzt tatsächlich darüber redete, hatte sich der Zweifel in Reis Innerem unbemerkt in eine Art Gewissheit verwandelt. Wieso hatte er nur so furchtbare Angst davor? An etwas zu zweifeln, was man gesehen hat, ist nichts anderes als an der Realität zu zweifeln, in der man lebt. Und da die Realität einen nicht loslässt, kann man sie nur leben, indem man laut und deutlich sagt, dass man gesehen hat, was man sah. Selbst wenn das, was man gesehen hatte, im Widerspruch zur Realität steht. Voller Reue sagte Rei es noch einmal:
»Ich habe es gesehen. Ganz sicher.«
Ein merkwürdiges Schweigen breitete sich im Raum aus.
Zusammen mit dem Lärm des Sportplatzes, der von jenseits der Wand herüberschallte, entschwand sanft und langsam alles Realitätsgefühl aus diesem Ort. Wenn Rei etwas von dieser Leiche erzählen wollte, dann war jetzt der richtige und vielleicht einzige Moment dafür. Hier, an diesem Ort, konnte er reden. Rei fasste seinen Entschluss und wollte gerade den Mund öffnen, als er spürte, dass die eisigen Blicke der anderen auf ihm ruhten. Unwillkürlich hob er seinen Kopf.
»Wenn das so war, wieso hast du dann geschwiegen?!« Murasakinos Donnerstimme ließ Rei wieder zu sich kommen. In diesem Augenblick war es um Reis Entschluss- geschehen. Gleichzeitig verflüchtigten sich die Blicke der anderen, die ihn noch eben hatten schaudern lassen. »Jetzt, nachdem du dich eine Woche lang verkrochen hast, tauchst du plötzlich auf und fängst an, all dieses unglaubliche Zeug zu erzählen! Was hast du dir dabei gedacht?!« Murasakino wirkte so, als ob er gar nicht mehr wüsste, wohin mit seinem Zorn und fuhr fort, Rei anzubrüllen. Doch dann mischte sich Nabeta ein und versuchte, ihn zu besänftigen.
Jetzt reg dich mal nicht so auf ... Jeder von uns wäre durcheinander, wenn er so einen Ort gesehen hätte! Vergiss nicht, dass Rei beinahe selbst umgebracht worden wäre.«
»Das entschuldigt aber noch lange nicht ·.•
»Sagt mal, was haltet ihr davon«, warf Nabeta einen Blick durch die Runde, »wenn wir erst einmal klären, ob das Mädchen mit dem Schwert, das Rei gesehen hat, das Mädchen auf dem Foto von diesem Gotoda und diese Saya Otonashi, die seit kurzem neu an unserer Schule ist, ein und dieselbe Person sind?«
»Und was, wenn es wirklich ein und dieselbe Person ist?« widersprach Murasakino, der immer noch kein Einsehen zu haben schien.
»Das würde uns zumindest einen Schritt weiterbringen. Es wäre immer noch besser, als sich in einer Situation, in der es, wie du selbst sagst, keine gesicherten Fakten gibt, gegenseitig anzubrüllen. Solange die Möglichkeit besteht, dass Aokis Leben in Gefahr ist, können wir die Geschichte auch nicht einfach auf sich beruhen lassen. Egal, ob sie wahr oder erfunden ist. Was danach zu tun ist, können wir entscheiden, wenn es soweit ist ... Also, wie sieht es aus? Können wir uns fürs erste auf ein Manöver einigen?«
»Keine Einwände«, antwortete Doigaku, und Amano hob zustimmend seine Hand.
»Wie denkst du darüber?« frage Murasakino Aoki, der aus unerfindlichen Gründen die ganze Zeit über kein einziges Wort gesagt und nur schweigend seine Zigaretten geraucht hatte.
»Alles Quatsch«, murmelte Aoki verächtlich, nachdem er seine Zigarette an der Wand ausgedrückt und den Stummel aus dem Fenster geworfen hatte. »Manöver, was soll das sein ... Hört auf, so einen verdammten Mist zu verzapfen!« Aokis Stimme war nicht sehr laut, sein Ton dafür aber um so giftiger und machte alle Anwesenden für einen Augenblick sprachlos. »Ihr glaubt, jemand hat's auf mein Leben abgesehen?« fuhr Aoki mit einem höhnischen Grinsen fort. »Ein politischer Aktivist, der glaubt, was ihm ein Bulle erzählt ... Wo auf der Welt, gibt's denn so was?! Soviel naive Treuherzigkeit gehört ja bestraft! Das kommt dabei raus, wenn Idioten vom Übermut gepackt werden!«
»Aber wenn Rei doch sagt, dass er es gesehen hat!« widersprach Amano, doch Aoki würdigte ihn keines Blickes und starrte statt dessen Rei an.
»Was genau hast du gesehen?« Der Blick war stechend. Seine Augen waren unter den Gläsern der schwarz gefassten Brille zusammengekniffen und ruhten direkt auf Rei. Vielleicht war es Aokis eisiger Blick, den Rei da vorhin auf sich gespürt hatte ... Dieses Gefühl, als ob etwas auf ihm festfrieren würde, verband sich in Reis Innerem mit einer schmerzlichen Erinnerung. »Sag schon, was hast du gesehen!«
»Das hab ich doch vorhin schon erzählt!« »Was hast du gesehen?!«
»Eine Frau mit Augen ... wie eine Bestie ... ein blutbeschmiertes Schwert. .. zwei Ausländer ... « murmelte Rei scheinbar gequält. So sehr er auch wollte, er konnte seinen Blick einfach nicht von Aokis Augen lösen.
»Und was sonst noch?!«
Plötzlich ertönte ein Klopfen, und die Augen aller Anwesenden wanderten zur der Tür, die hinaus in den Flur führte. Endlich kam Rei von Aokis Augen los. Die Schiebetür öffnete sich, ohne dass der Klopfende auf eine Antwort gewartet hätte. Als Rei sah, wer da draußen vor der Tür im Flur stand, erschrak er sehr.
»Hi, wie geht's?« Gotoda trat ein, ohne der völlig konsternierten Runde vor sich weitere Beachtung zu schenken und schloss die Tür hinter sich.
»He, wer bist du?« stellte ihn der misstrauische Murasakino (wer sonst) zur Rede.
»Nanu, hat Rei euch nicht von mir erzählt?« Als Gotoda sich mit seinem Polizeinotizbuch auswies, wechselte die Gesichtsfarbe der Anwesenden und alle sprangen von ihren Stühlen auf.
»Verdammt, was soll das, Rei?!« - »Verdammt, was soll das, Gotoda?!« schrien Murasakino und Rei praktisch gleichzeitig auf.
»Na, ich dachte, ich warte besser draußen vor der Tür, um dir notfalls unter die Arme greifen zu können, falls du Schwierigkeiten hast, sie zu überzeugen. Offenbar habt ihr euch ja zerstritten und da ... «
»Du hast uns belauscht?« fragte Doigaku scharf, während er nach einer Holzlatte griff, die an der Wand lehnte.
»So laut, wie ihr hier herumgebrüllt habt, kann euch jeder hören, ob er will oder nicht«, antwortete Gotoda mit dreister Unbekümmertheit, und Rei fragte sich, ob dieser Mensch überhaupt Nerven besaß. Diesmal war die Situation eine andere als gestern, als Rei und Gotoda sich in seinem Zimmer gegenübergestanden hatten. Man lag zwar nicht im Streit, aber wenn ein Polizist im Dienst am helllichten Tag so offensichtlich und provozierend in eine Oberschule hereinspaziert kam und noch dazu in die Zentrale einer Schulbekannten Gruppe radikaler Aktivisten platzte, schrie das geradezu nach Konsequenzen. Selbst wenn er einer Tracht Prügel knapp entging ... Angesichts der Tatsache, dass er hier auf eigene Faust ermittelte, musste ihm doch sonnenklar sein, dass er ziemlich übel in der Bredouille wäre, wenn er hier einen Tumult verursachte und die Sache ruchbar würde ... Gerade als Rei in der Vorahnung einer Katastrophe seinen Blick flehend zum Himmel richtete, wurde die Tür wieder und dieses mal mit ungeheurer Gewalt aufgerissen, und neuerliches Geschrei erfüllte den Raum.
»Was ist das für ein verdammter Krach hier?!«
Ein weinroter Trainingsanzug und Turnschuhe. Als Rei den Mann um die vierzig mit dem kurzgeschnittenem, graumeliertem Haar sah, fühlte er sich schlagartig noch schlechter. Es war Kume, der Sportlehrer, Trainer des Rugby-Teams und »Führungslehrer«* . Außerdem war er Ausbilder bei den Japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften gewesen, bevor er Lehrer wurde. Er galt als extrem rechter Hardliner und war bei Rei und seinen Kameraden entsprechend verhasst. Schlimmer hätte es wirklich nicht kommen können. Zuerst tauchte ein Polizist bei der Sitzung des Kampfkomitees auf, und dann platzte auch noch der Führungslehrer herein...
Als Kume mit scharfen Blick Rei entdeckte, der vor lauter Verzweiflung beide Hände vors Gesicht geschlagen hatte, ging das Gebrülle weiter.
»Rei Miwa!! Du bist vom Unterricht suspendiert und solltest unter Hausarrest stehen!! Was, zum Teufel, hast du hier zu suchen?!« Als nächstes entdeckte er Doigaku, der mit der Holzlatte in der Hand wie festgewurzelt dastand, und brüllte mit finsterer Stimme. »Doigaku!! Ich dachte, du hättest dich krank gemeldet?!«
»Äh, heute Nachmittag hab ich mich plötzlich wieder besser gefühlt, da bin ich in die Schule gekommen, weil ich wenigstens bei der AG mitmachen wollte ... «
»Versucht bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen ... Wenn ihr glaubt, das wäre nur ein Spiel, hab ich eine Überraschung für euch!« Wie einen Fluch spuckte Kume diese Worte aus und fixierte dabei mit hasserfüllten Augen Doigaku, der ihm mit gespielter Beiläufigkeit geantwortet hatte. Nach einer kurzen Pause bemerkte er endlich den an der Seite stehenden Gotoda.
Gotoda murmelte ein »Hallo« und nickte zum Gruß, während Kume ihn von Kopf bis Fuß in aller Ruhe musterte. Schließlich fragte er ihn mit gesenkter Stimme:
»Und wer sind Sie?«
»Nun, ich...« Rei schloss unwillkürlich die Augen und stellte sich vor, wie Gotoda mal wieder sein Polizeinotizbuch ziehen würde, um sich vorzustellen, aber das was Gotoda tatsächlich sagte, versetzte allen Anwesenden in Erstaunen. »Ich bin Reis Onkel.«
»Onkel?«
Die Mitglieder des Komitees waren angesichts von Gotodas dreister Lüge völlig baff. »Wissen Sie, sein Vater hat mich gebeten...« Gotoda ignorierte die Reaktion in der Runde und fuhr unbekümmert mit seinem Lügenmärchen fort. »Scheint, dass Rei nach dem Ärger mit der Polizei und der Suspendierung zu Hause furchtbar deprimiert war... Hat sich in sein Zimmer eingeschlossen und kein Wort mehr mit den Eltern gesprochen. Also wollte sein Vater, dass ich mir mal in aller Ruhe anhöre, was sein Sohn zu sagen hat und ihm...«
»Und was machen Sie dann hier?« »Wie bitte?«
»Seine Geschichten oder was auch immer hätten Sie sich auch bei ihm zu Hause anhören können!«
»Nein. Wie soll ich sagen, Rei meinte, dass seine Sicht der Dinge nicht reicht, um ihn zu verstehen. Also wollte er, dass ich auch höre, was seine Freunde zu sagen haben. Deshalb habe ich alle gebeten, hier zusammenzukommen, verstehen Sie.« Gotoda setzte der Sache schließlich die Krone auf, indem er sich noch auffällig gekünstelt in der Runde versicherte, dass es doch so gewesen sei, oder etwa nicht? Kume war ein einfach gestrickter Mann. Er konnte Rei und die anderen zu sich zitieren und ihnen eine mehrstündige Standpauke halten, sie danach aber mit Sicherheit zu einer Runde Schnitzel auf Reis vom Hauslieferdienst einladen. Eine so durchsichtige Lügengeschichte wie die von Gotoda jedoch konnte selbst ein so schlichter Denker wie Kume unter den gegebenen Umständen nicht für bare Münze nehmen. Unter den spannungsgeladenen Blicken von Rei und seinen Kameraden starrte Kume Gotoda für einen kurzen Moment an. Als vom Sportplatz her ein Lautsprecher mit Musik ertönte und den Zeitpunkt des Schulschlusses verkündete, ergriff Kume die Gelegenheit, weiterzureden.
»Soso, ein Onkel also.« »Ja.«
»Da haben wir ein Problem. Unbefugten ist das Betreten des Schulgeländes verboten. Und ein suspendierter Schüler, der in der Schule herumlungert, ist ein schlechtes Vorbild für den Rest.«
»Wenn das so ist, bringe ich ihn sofort nach Hause.« »Tun Sie das.«
Mit einer scharfen Aufforderung an den Rest, ebenfalls nach Hause zu gehen, verließ Kume den Raum. Gotoda überprüfte noch, dass Kume wirklich die Treppe hinunterging und schloss dann die Tür.
»Was ist denn mit euch los?« Gotoda blickte in einen Kreis von Gesichtern, die ihn irgendwie staunend ansahen.
»Ich hätte nie geglaubt, dass Kume wirklich so dumm ist«, murmelte Rei mit einem Ausdruck tiefer Erschütterung. »So eine Lügengeschichte glaubt ja nicht mal ein Grundschüler!«
»Dieser Mann ist keineswegs dumm«, erwiderte Gotoda. »Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber der Kerl ist durchaus schlau genug, um zu wissen, was Sache ist. Er hat mit voller Wucht angegriffen, aber als er bemerkte, dass ein Außenstehender anwesend ist, wusste er, dass er leicht in eine Klemme geraten könnte, aus der es kein Zurück mehr gibt.Wahrscheinlich hat er sogar erkannt, was ich wirklich bin. Und als ich ihm den rettenden Arm hingehalten habe, hat er sofort dankbar zugegriffen. Dumme wissen nicht, wann die Zeit und Gelegenheit für einen Rückzug ist.« Gotoda zeigte ein. Grinsen und seine Augenwinkel legten sich in Falten, so dass ein überraschend freundlicher Ausdruck auf seinem Gesicht entstand. »Also... Was tun wir jetzt? Ziehen wir von hier ab und setzen unser Gespräche draußen fort?« Gotoda war nur ein Außenstehender, aber er hatte die unerwartete Entwicklung der Situation genutzt, um im Handumdrehen eine Art Pseudo-Komplizenschaft mit den Aktivisten einzugehen. Und nachdem er so die Situation in den Griff bekommen hatte, war er ohne zu zögern dazu übergegangen, das Hauptthema anzuschneiden. Die Geschicklichkeit, mit der er vorging, versetzte Rei in heimliches Staunen.
»Wir haben noch gar nicht entschieden, ob wir dich akzeptieren. Und eins sage ich dir gleich. Selbst wenn wir mit dir kooperieren, heißt das nicht, dass es zwischen uns vertraulich wird. Es ist eine vorübergehende Koalition, die nur besteht, bis die Wahrheit ans Licht gekommen ist.« In seiner beharrlichen Vorsicht schickte Murasakino noch diese Warnung aus, aber die Mehrheit hatte sich bereits entschieden.
»Also, wir ziehen es als Manöver durch oder wie ihr das genannt habt... Für mich ist das okay.«
Als ob er die merkwürdig harmonische Atmosphäre zerstören wollte, sprang Aoki wortlos von seinem Platz auf. Murasakino rief ihm noch etwas nach, aber Aoki ignorierte ihn und lief in Richtung Tür. An der Tür drehte er sich noch einmal um und warf einen kurzen Blick zurück auf Gotoda, machte dann aber auf dem Absatz kehrt und marschierte von dannen.
»Seit der Kerl in dieser Partei mitmacht, ist er wirklich nicht mehr derselbe«, sagte Murasakino mit einer säuerlichen Miene.
»Na ja ... Dogmatisch war er schon immer ... «Während die Runde sich unter allgemein kritischen Äußerungen über Aoki von ihren Sitzen erhob, bemerkte Rei, dass jemand ihm etwas ins Ohr flüsterte und blickte auf.
»...« Gotoda, der neben ihm stand, flüsterte irgend etwas. »Was?« Rei näherte sein Gesicht dem Gotodas, der seine Worte wiederholte. Vorsicht, seine Augen sind böse. Diesmal konnte Rei es klar und deutlich hören.
ZWEITER TEIL
Nur wenige Minuten Zugfahrt von Shibuya entfernt lag nahe der Station einer privaten Bahnlinie eines der ältesten Viertel der Stadt. Auf der Rückseite einer schmucken Einkaufsstraße breitete sich hier ein überraschend ruhiges Wohnviertel aus. Hier befand sich eine »berühmte« Oberschule, der Rei und Nabeta einen Besuch abstatteten. Diese der 'T-Universität angegliederte Oberschule war unter jungen Aktivisten deshalb so berühmt (in Reis Gruppe kannte sie jeder), weil es sich praktisch um die einzige Oberschule in ganz Tokio handelte, der es gelang, zu Demonstrationen ganz allein eine eigene Truppe auf die Beine zu stellen.
Der Unterricht war gerade zu Ende gegangen und im Schulgebäude wimmelte es nur so von Schülern, die entweder auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zu irgendeiner AG oder einer Klubaktivität waren. Glücklicherweise handelte es sich um eine fortschrittliche Oberschule ohne Uniform zwang, so dass Rei und Nabeta in ihrer Zivilkleidung hier nicht weiter auffielen.
Die beiden gingen durch einen langen, hell von der Sonne erleuchteten Flur und gelangten so auf den Innenhof der Schule, auf dem eine schon leicht verwitterte Sonnenuhr aus Bronze stand. Von hier nahmen Rei und Nabeta einen schmalen Weg, der um die Tennisplätze herumführte. Als die beiden eine Gruppe von Schülerinnen bemerkten, die auf dem Tennisgelände gelben Bällen nachjagten, blieben sie unwillkürlich stehen.
»Wow!« entfuhr es Nabeta wie ein Stoßseufzer und Rei nickte wortlos. Hier war alles ganz anders als an ihrer eigenen Schule. Um zu ihrer Schule zu gelangen, musste man an einem gewissen Bahnhof der staatlichen Eisenbahn (an dem es wenig mehr als herumlungernde Yakuza und ein paar Pachinko Spielhallen gab) in die düster grün lackierten Wagen einer privaten Bahnlinie umsteigen. Nach gut 15 Minuten Fahrt erreichte man dann ein Viertel mit vielen kleinen und mittelgroßen Gewerbebetrieben und urigen Kneipen. Die Läden, die sich dort aneinanderreihten, rochen viel zu intensiv nach Leben, als dass man von einer »schmucken Einkaufsstraße« sprechen konnte. Und in einer Ecke jenes Viertels befand sich Reis Schule. Ihr Sportgelände war immer staubig und von einer Mauer aus Beton umgeben. Vom Schulgebäude hieß es, es sei noch aus der Vorkriegszeit, aber eigentlich war es einfach nur alt. In der Schulkantine (eigentlich mehr eine Art Baracke, die der Bezeichnung »schulische Einrichtung« spottete) tummelten sich bloß hausbackene Schülerinnen in Uniformen ... Von einer Sonnenuhr aus Bronze konnten sie allenfalls träumen.
Erstaunlicherweise hatte direkt vor einem Nebeneingang der Schule eine Bar namens »Nettaigyo« ihre Zelte aufgeschlagen, die jedes Jahr eine Anzahl von Kandidaten für die Fürsorgeerziehung hervorbrachte. Noch erstaunlicher war, dass in unmittelbarer Nähe der Schule ein Strip Lokal existierte, dem man nachsagte, dass jeder Schüler, der während seiner Schulzeit dort einen Fuß hineinsetzte, damit absolut jegliche Chance verspielte, die Aufnahmeprüfungen für die Universitäten zu bestehen.
Berühmt waren an dieser Schule eigentlich nur das jährliche Sportfest (bei dem regelmäßig Verletzte zu beklagen waren), der in seinem primitiven Auftreten unübertroffene Fanblock der Schule und der unter dem Spitznamen »Tarzan« bekannte reaktionäre Schuldirektor.
»Mann, die haben sogar einen Tennisplatz«, murmelte Nabeta. »Die Welt ist doch für Überraschungen gut.«
Die weiße Tenniskleidung blendete. Rei und seine Freunde hielten nicht viel von dem Begriff Jugend«, aber als die beiden jetzt diese wie Lebewesen von einem anderen Stern wirkenden Mädchen betrachteten, kamen sie sich selbst mit ihren langen Haaren und den übergeworfenen Jacken irgendwie furchtbar schmutzig vor. Der verzweifelte heimliche Krieg gegen die Lehrer und die ebenso hoffnungslose Schlammschlacht mit den Eltern zu Hause ... Kaum auf der Straße, wurden sie von den mobilen Einsatzkommandos gejagt und herumgestoßen, vom Regen und Schweiß durchnässt ... Wenn sie an eine Oberschule wie diese hier gekommen wären, wer weiß, vielleicht hätten sie dann ja ein Loblied auf eine Jugend fernab aller politischen Kämpfe gesungen ... An all diese Dinge dachte Rei gerade mit einem merkwürdigen Schuldgefühl, als er auf einmal unwillkürlich den Kopf einzog und einen Blick auf das Gesicht von Nabeta neben ihm warf. Der verfolgte mit sperrangelweit offenem Mund und Glubschaugen die weißen Gestalten der Mädchen. Als die beiden den Raum der Zeitungs-AG endlich gefunden hatten, mussten sie feststellen, dass es sich um einen ziemlich exquisiten Klubraum handelte. Nicht nur dass an der Vorderseite Fenster mit antik wirkenden Rahmen aus Gusseisen eingesetzt waren, sondern auch der Raum selbst war um ein Mehrfaches größer als ihr eigener, nach kaltem Zigarettenrauch stinkender Klubraum. Rechter Hand lehnten in mehreren Reihen eine ganze Anzahl von frisch beklebten Stellplakatwänden. Linker Hand, in einer vom Rest des Raumes durch eine Wand aus Spinden abgetrennten Ecke, verbreitete eine Rotationsdruckmaschine ihr heiteres Geräusch. Der ganze Raum war von einen intensiven, frischen Geruch nach Druckerfarbe erfüllt. An einem großen Arbeitstisch in der Mitte des Raumes waren einige junge Männer und Frauen mit dem Sortieren von Druckerzeugnissen beschäftigt.
Als sie Rei und Nabeta bemerkten, hoben alle auf einmal ihre Köpfe. Aus ihrer Mitte trat ein großgewachsener Mann heraus und näherte sich. Rei senkte den Kopf zum Gruß und stieß Nabeta an, der gerade unbefangen die in großer Schrift auf die Wände geschriebenen Slogans betrachtete.
»Ah, wir kommen von der K-Oberschule...«.
»Miwa und Nabeta? Ihr seid die beiden, die überall herumschnüffeln?« Rei und Nabeta sahen sich erschrocken an, aber der Mann zeigte ihnen ein Grinsen und fuhr fort. »Ihr zwei seid doch gestern schon in der Oberschule der M-Uni aufgekreuzt, richtig? Wir tauschen mit denen regelmäßig Informationen aus, das sind Freunde von uns. Die haben mir schon einiges von euch erzählt.«
»Ach so...«
Nach einem interessierten Blick auf Rei, der überrumpelt worden war und jetzt mit einem ausdruckslosen Gesicht eine belanglose Antwort gegeben hatte, führte der Mann die beiden wortlos in eine Ecke des Raumes. Dort stand ein völlig zerschlissenes Sofa, auf dem anstelle von Kissen eine sorgfältig zusammengelegte Decke lag. Offenbar wurde das Sofa auch für das ein oder andere Nickerchen benutzt. Vor dem Sofa stand ein Tisch aus einer Reihe Bierkästen und einer darüber gelegten Sperrholzplatte. Während Rei und Nabeta sich auf dem Sofa niederließen, setzte sich der Mann rittlings auf einen zusammenklappbaren Rohrstuhl und verschränkte seine Arme über der Rückenlehne.
Rei nahm den jungen Mann, der mit einem offensichtlich interessierten Blick auf die beiden heruntersah, noch einmal in Augenschein. Ausgewaschene Jeans, weiße Basketballschuhe und ein Baumwollhemd mit hochgeschlagenen Ärmeln, über den Schultern hing locker eine hellorange Jacke ... In diesem Aufzug sah er zweifellos eher nach einem Sportler als nach einem politischen Aktivisten aus. Selbst Rei als Mann fiel auf, wie gutaussehend er war, so als ob sämtliche Mädchen anfangen würden zu kreischen, sobald er mit einem Rugby-Ball unter dem Arm über das Feld flitzte. Anders formuliert, es war die Art von Junge, dem gleichaltrige Geschlechtsgenossen nur mit einem Höchstmaß an Vorsicht begegneten. Andererseits wirkte er so, als ob er mit einem Helm auf dem Kopf und einem Megaphon in der Hand durchaus eine gute Figur abgeben könnte. Jedenfalls rief sich Rei noch einmal die Erfahrungsregel in Erinnerung, wonach gutes Aussehen bei allem eine gute Figur macht und kam zu dem Schluss, dass diesem Kerl ein weißer Helm durchaus stehen würde.
»Leider ist der Vorsitzende unseres Komitees nicht anwesend, ihr müsst also mit mir als seinem Vertreter Vorlieb nehmen ... Ich heiße Miura, und ich bin hier der Generalsekretär.« »Generalsekretär?« Rei entfuhr ein Seufzer.
»Das ist nur so ein Titel«, antwortete der Mann, der sich Miura nannte, in einem weiterhin unbekümmerten Ton. Aber egal was es war, Reis Gruppe, die sich »Kampfkomitee« nannte, war in Wahrheit nicht mehr als eine kleine Bande, die weder einen »Vorsitzenden« noch einen »Generalsekretär« besaß. Der Begriff »Generalsekretär« machte jedenfalls nachhaltigen Eindruck bei Rei und Nabeta. Bei ihnen hatte Murasakino, der sich selbst »Druckereileiter« nannte, auch so eine Art Titel, aber im Vergleich zum Leiter eines Sekretariats, reichte seine Autorität ungefähr so weit wie die eines kleinen Druckereibesitzers, der Klubzeitschriften druckte und Manuskripte, die ihm nicht gefielen, ablehnen konnte.
»Also, womit kann ich helfen?« stieß Miura das Gespräch an, und versuchte dabei offensichtlich den Eindruck zu erwecken, dass ihn die Rangunterschiede nicht interessierten.
»Ich dachte, du hättest schon einiges gehört?« entgegnete Rei leicht aggressiv, wobei er seinem Gegenüber direkt in die Augen sah, um seine Unsicherheit zu unterdrücken. Das Sammeln von Informationen an der eigenen Schule hatte man Amano und den anderen überlassen, die sich dazu bereit erklärt hatten. Zu Nachforschungen über die vermeintlich Ermordeten und das Mädchen namens Saya hingegen hatte sich Nabeta bereit erklärt.
Im Falle einer Partei war es bei Nachforschungen zu einem innerparteilichen Problem möglich, im Rahmen von Befugnissen, die eine spezielle Untersuchungskommission erteilen konnte, Methoden wie Verhöre und ähnliches einzusetzen. Bei Studenten war es zudem möglich, auf dem Umweg über die diversen gemeinsamen Kampforganisationen und Verbindungskonferenzen ein Treffen auf formellem Wege vorzuschlagen. In der Welt der Schüler sah es hingegen etwas anders aus. Hier existierten zwar auch eine Reihe von Verbindungsorganisationen, die aber meist nur sehr wenige Mitgliedsorganisationen zählten. Die Realität war, dass die einzelnen Gruppen und Organisationen ihren Kampf weitgehend unabhängig und auf sich allein gestellt führten. Da an den Oberschulen, die Gotoda ihnen genannt hatte, niemand Bekannte besaß, war man gezwungen, es bei den Nachforschungen auf einen Versuch vor Ort ankommen zu lassen. Alles hing also von den Verhandlungskünsten von Rei und Nabeta ab. Obwohl sich hier auf beiden Seiten linke Politaktivisten gegenüberstanden, hieß das noch lange nicht, dass es automatisch ein Kameradschaftsgefühl gab. Einfach so mit einer aberwitzigen Geschichte von einer bizarren Mordserie oder einem Mädchen mit einem Schwert anzukommen, würde die Gegenseite nur unnötig misstrauisch werden lassen und war deshalb dumm.
»Angeblich werden Mitglieder des Schülerkomitees der SR Fraktion gezielt liquidiert und verschwinden spurlos. Es heißt, dass ihr versucht, herauszufinden, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, weil einer eurer Kameraden dort ebenfalls Mitglied ist ... «
»In eurer Schule soll es auch ein Mitglied geben?« »Ja. Der Kerl heißt Kajio.«
»Miura!!« Die scharf tadelnde Stimme kam vom Arbeitstisch her, wo sich jetzt einer der Männer erhob.
»Lass gut sein! Sie sind hier, weil sie sich Sorgen um einen Kameraden machen. Vertrau ihnen einfach.« Miura sprach, ohne sich umzuwenden, und sein Ton klang ganz so, als ob er nicht mal aus reiner Höflichkeit sagen könne, dass er ihnen vertraue, aber es genügte, um den Mann am Arbeitstisch zum Schweigen zu bringen. Der Rang des »Generalsekretärs« schien also doch mehr als ein leerer Titel zu sein. »Wenn der Staatsschutz oder eine Partei dahintersteckte, würden sie's nicht auf so 'ne plumpe Tour versuchen. Hab ich recht?«
»Tut mir Leid, dass wir hier so einfach rein geplatzt sind.« »Schon gut. Wir sind bloß alle ein wenig nervös. Es war nicht böse gemeint.« Miura sprach so, als ob er sagen wollte, dass ihnen zwar niemand böse gesinnt sei, aber dass man trotzdem wachsam wäre. »Tatsächlich haben wir von Kajio seit ungefähr zwei Wochen nichts mehr gehört. Wir sind nur ein bunt zusammengewürfelter Haufen und haben wenig Lust, bei Typen von so einer Splittergruppe herum zu stöbern. Wir haben schon ein wenig nachgeforscht, aber es ist alles nicht so einfach. In der Schule ist er krank gemeldet, aber wenn man zu Hause anruft, meldet sich keiner. Als wir bei ihm waren, um nachzuschauen...«
»... wurdet ihr geschickt weg komplimentiert, und von der Familie hat sich niemand blicken lassen, richtig?«
»Sieh mal an. Dann sieht es an der Oberschule der M-Uni also genauso aus?« Miura, der seine schnelle Auffassungsgabe unter Beweis gestellt hatte, nickte nachdenklich. »Diese Geschichte ist ja wirklich merkwürdig. Wer sollte einen Vorteil davon haben, so eine kleine Splittergruppe und noch dazu ihre Schülerorganisation kaputtzumachen?«
»Es ist nicht gesagt, dass jemand sie kaputtmachen will.« »Moment mal. Ich denke, es geht um gezielte Liquidationen?« »Das besagen die Gerüchte, die man hört. Aber wenn so viele
nach und nach verschwunden sind...«
»... wäre es denkbar, dass sie auf Befehl von oben untergetaucht sind.«
»Aber was wollen die im Untergrund? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine kleine Splittergruppe Terroranschläge oder subversive Aktivitäten plant.« Miura schnaufte leicht, bevor er in einem veränderten Tonfall fortfuhr. »Sagt mal, wieso fragt ihr nicht einfach euren Kameraden anstatt hier bei uns Nachforschungen anzustellen? Wenn er auch in dieser Organisation ist, muss er doch irgendwas gehört haben.«
»Du weißt doch selbst, um was für einen Verein es da geht.« »Wie viele sind denn verschwunden?«
»Wir wissen von mindestens drei.«
Miuras Gesichtsausdruck verlor an Gelassenheit. Er stöhnte leicht und begann, angestrengt nachzudenken. Es war Rei und Nabeta gelungen, Miuras Argwohn von ihnen selbst weg auf den eigentlichen Fall zu lenken, aber vielmehr, als dass der Junge namens Kajio tatsächlich verschwunden war, hatten sie bisher nicht herausfinden können. Nabeta war der Meinung, es sei jetzt an der Zeit, sich einen Schritt vorzuwagen und begann zu reden:
»Ist euch irgendwas aufgefallen bevor er verschwand?« »An Kajio meinst du?« Miura zuckte gekonnt mit den Achseln.
»Wie soll ich sagen, Kajio war schon immer ein bisschen seltsam. Er war ziemlich aktiv und hat sich eifrig an der Überzeugungsarbeit in der Schule beteiligt, aber manchmal hat er sich zu Hause versteckt oder ein richtig düsteres Gesicht gemacht. Ob die Leute von der SR-Fraktion alle so sind?«
»Ja, tendenziell schon. Sie können merkwürdig starrsinnig und richtige Geheimniskrämer sein. Wenn es um den Schutz ihrer Organisation geht, werden sie leicht nervös.« Als Rei sich so zustimmend äußerte, begann Miura wie ein Wasserfall zu reden:
»Trotzdem... Findest du nicht, dass sie sich fragen lassen müssen, was der Sinn ihrer ganzen Partei ist? Ich meine, sie sind eine radikale Splittergruppe, aber bei ihren Aktionen oder beim Theorien streit mit ihnen spürt man irgendwie gar keine Leidenschaft. Ihre Parteizeitung erscheint unregelmäßig, Versammlungen halten sie nur äußerst selten ab, und wenn sie mal auf der Straße aktiv sind, was selten genug vorkommt, stehen sie nicht gerade in der ersten Reihe. Verhaftungen gibt's bei denen auch nie. Böse Zungen bei uns behaupten sogar, dass sie eigentlich gar keine politische Organisation, sondern mehr eine religiöse Sekte sind.«
Sowohl Rei als auch Nabeta hatten keinerlei Einwände gegen das, was Miura gesagt hatte, aber die Zeit war knapp und sie mussten zur Sache kommen. Sie mussten das, was sie wissen wollten, so schnell wie möglich in Erfahrung bringen und dann den Rückzug antreten, sonst könnten sie mit etwas Pech selbst in Bedrängnis geraten.
»Übrigens, diese Frau ...« Das Foto, das Rei jetzt herausholte, war ein Schnappschuss, den Amano in einer Blitzaktion aufgenommen hatte und um einiges klarer als die unscharfe Kopie, die Gotoda besaß.
Miura warf einen Blick auf das Foto, drehte seinen Oberkörper in Richtung Arbeitstisch und rief laut nach einer Schülerin namens Abe. Vermutlich wusste sie etwas über Saya. »Abe geht mit Kajio in die gleiche Klasse. Sie sollte etwas über die Schulwechslerin wissen.«
Das Mädchen mit Namen Abe betrachtete das Foto und nickte zur Bestätigung. »Das ist Saya Otonashi. Sie schreibt sich mit den Schriftzeichen für klein und Nacht, zusammen wird das dann Saya gelesen.«
»Schön... Könntest du uns nicht sagen, ob dir an ihr etwas aufgefallen ist?« Rei bemühte sich, keine Veränderung im Gesichtsausdruck des Mädchens zu übersehen, aber ihre Miene war abweisend und sie schüttelte lediglich zaghaft den Kopf.
»Ich wüsste nicht was. Sie ist zwar in meine Klasse gegangen, aber das waren ja bloß drei Tage ... Na ja, gut ausgesehen hat sie.« Das Mädchen entschuldigte sich, senkte leicht den Kopf und ging direkt zu ihrem Platz am Arbeitstisch zurück.
Es war hoffnungslos. Rei erkannte, dass es Zeit für den Rückzug war und gab Nabeta ein Zeichen.
»Vielen Dank. Ihr habt uns auf jeden Fall geholfen.«
»Da war noch was, das die Typen von der Oberschule der M-Uni mir gesagt haben«, rief Miura Rei und Nabeta hinterher, die bereits auf dem Weg zum Ausgang waren.
»Es scheint da einen Kerl zu geben, der öffentlich verkündet, dass herumschnüffelnde Hunde, die es mit dem Staatsschutz halten, der Schlag treffen soll.« Rei spürte, wie es ihn eiskalt durchlief. Es waren erst zwei Tage vergangen, seit sie aktiv geworden waren, aber diese Welt war offenbar noch viel kleiner, als er dachte. »Wieso lasst ihr die Kerle nicht einfach in Ruhe? Ich hab keine Ahnung, was hinter all dem steckt, aber diese Splittergruppen überlässt man am besten sich selbst.«
»Danke für den Rat. Aber dafür ist uns unser Kamerad zu wichtig«, bluffte Rei nach Kräften und wandte Miura wieder den Rücken zu. Das rhythmische Stampfen der Rotationsdruckmaschine schien auf ewig in Reis Ohren nachzuhallen.
Als sie das Schulgelände durch das Haupttor verließen, begann die Sonne bereits unterzugehen, und ein kalter, Nacht verkündender Wind kam auf.
»Irgendwie stinkt die Sache gewaltig«, murmelte Nabeta, während er den Reißverschluss seiner Jacke zuzog.
»Schnüffelnde Hunde soll also der Schlag treffen ...« Die Warnung, die Miura ausgesprochen hatte, lastete schwer auf Reis Brust. Er wusste selbst, dass es eigentlich nicht gutgehen konnte, sich in die Angelegenheiten einer fremden Partei oder Fraktion einzumischen, aber die Schnelligkeit der Reaktion der Gegenseite machte ihm Sorgen. Vielleicht war es ja Aoki selbst, der sich Miura bedient hatte, um diese Warnung auszusprechen, dachte Rei, ohne diesen Verdacht begründen zu können. Wenn das so wäre, würde es bedeuten, dass Aoki über bestimmte Informationen zu diesem Fall verfügte und verhindern wollte, dass Rei und die anderen weiter in der Sache aktiv waren. Vielleicht hatte Miura ja Recht und sie sollten zuallererst mit Aoki selbst reden? Es war Zeit nach Hause zu gehen. Ermittlungen mit »Sperrstunde«, das war eigentlich eine Lachnummer, aber als vom Unterricht suspendierter Oberschüler hatte Rei kaum eine Wahl. Wenn es die Situation erforderte, wäre Rei durchaus bereit, sämtliche Auflagen einfach zu ignorieren, aber gegenwärtig, wo nicht einmal sicher war, in weIche Richtung die Ermittlungen überhaupt führen würden, verzichtete er dankend darauf, sich unnötigen Ärger aufzuhalsen. Also musste er vor Sonnenuntergang zu Hause sein.
»Wie wär's mit 'ner Portion Ramen, bevor wir nach Hause gehen?« schlug Rei vor, und da Nabeta keine Einwände hatte, machten sich beide auf den Weg. In diesem Moment hörten sie hinter sich jemanden rufen. Es war Abe. Sie war den beiden offenbar gefolgt und blieb mit leicht beschleunigtem Atem vor ihnen stehen.
»Tut mir leid ... Ich konnte vorhin nicht so gut reden.« Im Gebäude war es Rei gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo er ihr erneut gegenüberstand, empfand er ihre nach oben geschwungenen Augen als sehr eindrucksvoll. Man konnte bei ihr durchaus von einem hübschen Mädchen sprechen. Ihre weißen Wangen waren ganz leicht errötet, und durch die ungeordneten Haare ihres Ponys lugte eine Stirn hervor, die einen intelligenten Eindruck erweckte.
»Ist dir doch noch was eingefallen?« Nabeta, auf den sie den gleichen Eindruck zu machen schien, wurde auf einmal lauter. Auch Rei sah Abe ohne jede Zurückhaltung an, so als ob es jetzt darauf ankäme.
»Diese Saya ist gefährlich.« »Gefährlich?«
»Nein, wartet ... Vielleicht nicht so sehr gefährlich, sondern eher böse, oder wie soll ich sagen ... Ich habe so ein Gefühl, dass wir Kajio nie wiedersehen werden.«
»Moment mal, was meinst du mit böse?!«
»Haltet euch besser von ihr fern. Das ist es, was ich euch sagen wollte.« Abe entschuldigte sich und wollte kehrtmachen, als Nabeta sie erwartungsvoll fragte: »Könnten wir nicht noch mal in Ruhe darüber ...«
Abe antwortete mit einem Lächeln, das irgendwie einsam und verloren wirkte. »Ich bedaure, aber das wird nach Lage der Dinge vorläufig nicht möglich sein.«
»Was hat das alles zu bedeuten, das ist doch ...« Nabeta wollte einfach nicht lockerlassen. Rei erinnerte sich an die seltsame Spannung, die über dem Raum der Zeitungs-AG gelegen hatte. Die immense Anzahl von Stellplakatwänden, die an der Wand lehnten. Wir sind alle bloß etwas nervös ... Genau das hatte Miura doch gesagt. »Heißt das etwa ihr ... «
Abe warf Rei einen strengen Blick zu, aber gleichzeitig lag auf ihrem Mund ein Lächeln. Schließlich schien es auch Nabeta zu kapieren, der zwischen den beiden hin-und hersah, und ein Seufzer des Erstaunens entfuhr ihm. Als Abe schließlich ging, hinterließ sie einen nachhaltigen Eindruck bei Nabeta und Rei, die nun allein und gedankenverloren herumstanden. »Haben die's gut ...«, murmelte Nabeta voller Neid.
»Die Sonnenuhr aus Bronze, die Tennisplätze ...« »Der Raum der Zeitungs-AG!«
»Die elektrische Rotationsdruckmaschine!« »Ein cooler Typ als Generalsekretär ·.• »Und sie haben richtig hübsche Mädchen.«
»Und jetzt machen sie anscheinend sogar eine Barrikade!
Das ist einfach nicht fair!«
Eine Barrikade zu »machen« bedeutete, mit Hilfe von Barrikaden ein bestimmtes Gebäude, etwa eine Fabrik oder eine Schule, abzuriegeln, um es zu besetzen. Die Barrikade war eine symbolische Waffe im tagtäglichen Kampf der Systemgegner an den Universitäten überall im Land. Diese Waffe war freilich auch sehr riskant.Wer an einer Hausbesetzung teilnahm, machte sich strafbar und konnte wegen »Hausfriedensbruchs« oder gewaltsamer Störung eines Geschäftsbetriebs« juristisch belangt werden. Und im Falle einer Räumung war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Besetzer, die sich im Inneren des Gebäudes verschanzt hielten, der Polizei auf einen Streich ins Netz gingen. Für einen politisch aktiven Oberschüler bedeutete eine Barrikade aber vor allem auch das einzige Mittel, um sich auf symbolische Weise einen Freiraum außerhalb des Alltags zu erobern. Für Rei und die anderen war sie deshalb ein Objekt größter Sehnsucht.
Um eine solche Barrikade für eine bestimmte Dauer aufrechterhalten zu können, war allerdings eine gewisse Truppenstärke und Logistik erforderlich. Für eine Gruppe Oberschüler war es daher sehr schwierig, eine Barrikade zu bauen und noch schwieriger, sie aufrechtzuerhalten. Rei und seine Kameraden, die noch nicht einmal in der Lage waren, eine eigene Truppe aufzustellen, konnten von einer Barrikade nur träumen. Also standen Rei und Nabeta jetzt vor dem Tor der Schule und gaben sich den verzweifelten Träumereien hin, die das Wort Barrikade bei ihnen ausgelöst hatte.
Das was an dem Ort, an den sie zurückkehren mussten, auf sie wartete, war weit weniger verlockend. Es war ein Alltag in einer staubigen Schule, mit unverbesserlichen Lehrern, mit einem miefigen Klubraum und mit auf einer Matrizenkopiermaschine hergestellten Flugblättern, die sie wie Diebe in der Nacht verteilen mussten. Und natürlich ohne ein Mädchen wie Abe. Und offen gesagt dachten beide in diesem Moment das Gleiche, nämlich dass sie das alles nur mit einer Portion Ramen würden ertragen können. Zwei Tage später berichteten die Zeitungen und das Fernsehen, dass die der T-Universität angegliederte Oberschule von Mitgliedern eines aus Schülern bestehenden Komitees besetzt und abgeriegelt worden war.
DRITTER TEIL
»Bösartig...« murmelte Gotoda still vor sich hin. Die Essstäbchen mit dem Kimchi hielten auf dem Weg zu seinem Mund für einen Moment inne. »Dieses Mädchen scheint mir ein helles Ding zu sein.Wie war noch gleich ihr Name?«
»Abe. Aber keine Ahnung, ob der echt war«, antwortete Nabeta kühl.
»Ich würde sie gerne mal treffen«, sagte Gotoda, ließ sich den Kimchi in den Mund fallen und führte anschließend das Bierglas an die Lippen. In der Gaststätte, in dem dicke Schwaden fett geschwängerten Rauchs von gebratenem Fleisch aufstiegen, waren zu dieser frühen Stunde außer Rei, seinen Kameraden und Gotoda keine weiteren Gäste anwesend. Das Rikaen, so der Name der Yakiniku Gaststätte, war gut zehn Minuten Fußweg von Reis Schule entfernt und lag etwas abseits der Einkaufsstraße. Der Laden war dafür bekannt, dass man sich hier für wenig Geld so richtig satt essen konnte.
Der Grund dafür, dass Rei und seine Kameraden diesen Ort für das Treffen mit Gotoda ausgewählt hatten, war zum einen, dass sie keine allzu großen Hoffnungen in die Finanzkraft eines einfachen Kriminalbeamten setzten. Zum anderen war es aber auch die spezielle Geschäftsphilosophie des Besitzers, die es ihnen ermöglichte, den Laden in Schuluniformen zu betreten und hier unbehelligt Bier zu bestellen. Der nicht sehr große Gastraum umfasste neben einigen Tischen mit Stühlen im hinteren Teil noch ein kleines Separee, das mit Tatami Matten ausgelegt war. An einem Tisch mit eingelassenem Grillrost fanden hier mit Ach und Krach zehn Leute Platz, und man konnte sogar unbehelligt rauchen. Einmal allerdings, als Nabeta im Übermut Shochu Schnaps bestellt hatte, kam der Besitzer des Ladens mit einem großen Fleischermesser aus der Küche herüber und alle, die zusammensaßen, waren vor Schreck erstarrt. Eine völlig gesetzlose Zone, in der man nach Lust und Laune Unfug treiben konnte, war das Rikaen also nicht.
Rei und die anderen, die das Separee in Beschlag hielten, qualmten eine Zigarette nach der anderen und schütteten Bier in rauen Mengen in sich hinein. Zog man Gotodas Alter,Aussehen und seinen leicht betretenen Gesichtsausdruck in Betracht, war es durchaus möglich, in der Runde einen literarisch oder ähnlich angehauchten Zirkel von Schülern zu sehen, der hier unter der Leitung ihres beratenden Lehrers mit dessen Billigung ein geselliges Beisammensein beging.
»Die ist nicht zu treffen«, urteilte Rei, während er emsig seine Essstäbchen bewegte und gleichzeitig mit den Augen die Restmenge an geschnittenem Fleisch, die sich auf dem großen Teller in der Mitte befand, im Auge behielt. »Die hat sich nämlich seit gestern in einem besetzten Haus verbarrikadiert.«
»Hat die's gut«, schob Doigaku unverzüglich und leicht mürrisch nach, während Amano sogleich weitergehendes Interesse offenbarte:
»Ist sie hübsch?«
»Offen gesagt ist sie genau mein Typ«, antwortete Nabeta. »Schlank, helle Haut und durchdringende Augen«, ergänzte
Rei.
»Diese Oberschule merk ich mir fürs nächste Meeting vor.«
»Er hat doch gerade gesagt, dass sie sich eine Weile nicht blicken lassen kann. Weder auf der Straße noch auf einem Meeting«, wandte Doigaku ein.
»In ein paar Tagen werden die Bullen das Gebäude räumen.
Dann wird sie festgenommen, vorläufig inhaftiert ... Wird 'ne Weile dauern, bis sie draußen ist.«
»Für das Mädchen würde ich sogar in den Knast wandern«, murmelte Nabeta mit einer seltsamen Entschlossenheit, so dass Amano vor Schreck der Atem stockte, und er mit seinen Stäbchen für einen Moment innehielt.
»Stimmt. Gut vorstellbar, dass sie einem dieses Gefühl geben kann«, pflichtete Rei ihm bei, als Amano seine Stimme zu einem lauten Aufschrei erhob.
»Verfluchter Mist!«
»He, langsam fangt ihr an zu nerven!« brüllte Murasakino, der sich bisher in Schweigen gehüllt hatte.
»Für Privatgeschichten wie eure Gier nach Frauen ist hier kein Platz! Nabeta! Du hast mit deinen unbedachten Äußerungen Amano angestachelt und unseren Diskurs ins Lächerliche gezogen!« Während er die Fleischhäppchen auf dem verkohlten Rost vor ihm schön säuberlich ordnete, fuhr der bei allem und jedem hyperkorrekte Murasakino in einem seltsam weltmännischen Ton fort. »Manche besitzen eben und andere nicht. In dieser Welt sind nicht nur die materiellen und kulturellen Güter ungleich verteilt. So wie wirtschaftliche Ungleichheiten existieren, existieren auch lokale Unterschiede in den jeweiligen Bedingungen des revolutionären Kampfs. Meinetwegen sollen die anderen ihre Barrikaden und ihre Rotationsdruckmaschinen und ihre Frauen, für die es sich lohnt, verhaftet zu werden, haben! Aber ich sage euch: und wenn schon!« Wir haben eben nur die Tante aus diesem vor Fett triefenden Yakiniku Laden und eine lausige Matrizenkopiermaschine!
Murasakino ging nicht so weit, auch das noch zu sagen, aber für Rei und die anderen war seine Wut auch so deutlich genug spürbar. Nüchtern betrachtet hatte Murasakinos Wutausbruch das, was sich bei Nabeta und Amano in Form von Neid geäußert hatte, einfach nur durch Zorn zum Ausdruck gebracht, aber er selbst war sich dessen gar nicht bewusst. Offenbar ging es Murasakino nach dem Bericht von Rei und Nabeta auch nicht anders als allen anderen. Irgendwie schien er die Lage, in der sie sich befanden, als absurd zu empfinden.
Während die Runde jetzt die Köpfe hängen ließ, entzündete sich das Fett des auf dem Grill bratenden Fleischs und begann heftig zu qualmen. Es war beinahe so, als ob darin die Gefühle von Rei und seinen Kameraden zum Ausdruck kommen würden.
»Hört mal, Jungs, ich verstehe ja durchaus, dass ihr hier Trübsal blast, aber...«
»Und wenn schon!!Was geht dich das an?!« fauchte Murasakino Gotoda an und zeigte so ungeschminkt, was er dachte, nämlich dass Gotoda rein gar nichts verstand.
»He, reagiere doch nicht gleich so gereizt.« Der Ton von Gotodas Reaktion war teilnahmslos, aber im Unterschied dazu ließ sein Blick erkennen, dass ihn Murasakinos Reaktion amüsierte. »Also, sprechen wir über die Arbeit.«
Ja, und zwar in aller Ruhe, während wir essen. Das Fleisch ist übrigens alle«, antwortete Murasakino mit provokativ zugekniffenen Augen.
»Wir kriegen doch einen Nachschlag, oder?«
»Hört mal gut zu, die Reserven meiner Geldbörse sind nicht unerschöpflich, und ich kann die Rechnung hier auch nicht als Spesen absetzen.«
Aber Murasakino rief schon die Bedienung herbei, und die Kameraden orderten gnadenlos nach.
»Rippenfleisch Spezial für zehn.« »Roastbeef, ebenfalls für zehn.«
»Rinderzunge, je drei mit Salz und drei mit Soße.« »Zweimal Kimchi und zweimal Kakuteki.«
»Eine große Portion gemischte Beilagen.« Gotoda bestellte fünf Portionen Reis, weil er dachte, es wäre sein finanzieller Ruin, wenn diese Kerle sich allein an Fleisch satt essen würden. So schaufelte er sich jedoch bloß sein eigens Grab.
»Ich hätte lieber kalte Nudeln statt Reis.« »Dann nehme ich auch kalte Nudeln.« »Für mich 'ne große Portion Reissuppe.«
»Und für mich eine große Portion Bibimba mit Suppe.« »Eine Extraportion Yukke-Bibimba mit Suppe.«
Als die Bedienung alles notiert hatte und sich schon zum Gehen abwandte, bestellte Amano noch schnell fünf Bier nach. »Also, ordnen wir doch mal die einzelnen Berichte.« Unter völliger Missachtung des reichlich jämmerlich dreinblickenden Gotodas nahm Murasakino das Heft in die Hand.
»Nach den Ermittlungen von Rei und Nabeta sind drei Personen, nämlich Hayashida von der Oberschule der M-Uni, Kajio von der Oberschule der T-Uni und Koga von der Technischen Oberschule, tatsächlich verschwunden.«
»Außerdem stimmen die Daten ihres Verschwindens genau mit den Daten überein, an denen laut dem Alten die drei Leichen gefunden wurden«, ergänzte Nabeta während er mit seinen Stäbchen in der Sauce auf dem Teller vor ihm herumstocherte.
»Die Lage nach dem Verschwinden ist ebenfalls in allen Fällen identisch. In den Schulen sind sie für längere Zeit krankgemeldet, die Familien hüllen sich in Schweigen.«
»Trotzdem wäre es voreilig, davon auszugehen, dass sie tot sind. Immerhin ist es möglich, dass sie von zu Hause abgehauen oder in den Untergrund gegangen sind.« Gotoda hielt dem hartnäckig misstrauischen Murasakino ein Bündel Papiere hin, das von einer Schnur zusammengehalten wurde. Auf dem schwarzen Deckel war ein Aufkleber, auf dem »Autopsiebericht« stand.
Bei den Todesursachen unterschieden die Behörden zwischen einem natürlichen Tod durch Krankheit oder Altersschwäche und einem gewaltsamen Tod durch irgendeine Form äußerer Gewalteinwirkung. Letztere Fälle wurden in Gebieten, in denen eine rechtsmedizinische Institution existierte, als »nicht natürlicher Tod« eingestuft und mussten der Polizei gemeldet werden. Die wiederum veranlasste daraufhin eine Untersuchung, die von medizinischer Seite im wesentlichen aus einer Leichenschau, also einer Begutachtung des Leichnams, bestand, weIche durch die Hand eines Rechtsmediziners erfolgte. Im Rahmen der Leichenschau konnte nach Maßgabe dieses Rechtsmediziners auch eine Autopsie (Leichenöffnung) durchgeführt werden. Bei Verdacht auf eine Straftat konnte die Autopsie auch auf Anweisung eines Untersuchungsrichters erfolgen, man sprach dann von einer gerichtlichen Autopsie«.
Das was jetzt vor Murasakino lag, war (wenn man Gotoda Glauben schenken wollte) allem Anschein nach der Bericht einer solchen gerichtlichen Leichenöffnung.
»Das sind die Autopsie Berichte der drei Toten. Ich habe sie mit viel Mühe für euch organisiert, weil ihr immer so misstrauisch seid. Ach so, falls ihr eure Nachbestellungen genießen wollt, rate ich euch, die Berichte erst nach dem Essen anzuschauen.«
Murasakino rümpfte die Nase und öffnete die Akte, woraufhin sich sein Gesicht zu einer Grimasse verzog. Amano, der Murasakino über die Schulter schaute, entfuhr ein angewidertes Stöhnen. »Könnte es nicht sein, dass die drei Leichen mit den drei Verschwundenen identisch sind?« Man musste schon extrem starrköpfig sein, um jetzt noch so etwas zu behaupten, aber für Murasakino war es ein letzter Versuch des Widerstands.
»Wenn wir die Fotos in den Schulen der drei herumzeigen, müsste das schnell herauszufinden sein.«
»Idiot. Wie willst du erklären, woher du die Fotos bekommen hast?« wies Doigaku den wie immer unbedarft daherredenden Amano zurecht.
»Versuches nur. Die hat mir ein befreundeter Polizist gegeben ... Wirst dein blaues Wunder erleben.«
»Die machen dich fertig.«
Nachdem Amano eine Weile auf den Bericht gestarrt hatte, kam die Akte über Amano, Doigaku und Nabeta schließlich auch zu Rei. Die Bilder schienen unter einer schattenfreien Beleuchtung aufgenommen worden zu sein und waren arm an Kontrasten, so dass sie auf Rei einen merkwürdig unwirklichen Eindruck machten. Abgesehen von einer Naht, die in gerader Linie vom Hals nach unten führte, bezeugte nur die durch die Totenstarre ausgelöste Ausdruckslosigkeit der Gesichter, dass es sich bei den Körpern auf den Fotos um Tote handelte.
»Können wir Abzüge davon haben? Ich meine, für alle Fälle ... « »Da muss ich um Nachsicht bitten. Falls rauskommt, dass ich die Fotos mit nach draußen genommen und Außenstehenden gezeigt habe, reicht das schon für mehr als eine Abmahnung.« Hastig nahm Gotoda die Unterlagen wieder an sich und verstaute sie behutsam in seiner Tasche.
»Du fliegst doch eh, wenn die Sache rauskommt.« »Wahrscheinlich seid ihr noch zu jung, um das zu verstehen, aber ich bin schon zu alt, um noch mal bei Null anzufangen. Wann ich meinen Job für etwas riskiere, möchte ich schon noch selbst entscheiden.«
»Na gut. Stellen wir also fest, dass es eine Tatsache ist, dass drei Personen von irgendwem, noch dazu auf äußerst bizarre Weise, umgebracht worden sind, einverstanden?« Murasakino sprach in einem gönnerhaften Tonfall, worauf der Rest der Gruppe widerspruchslos zustimmte. Genau betrachtet war das alles einfach nur furchtbar arrogant und anmaßend, denn was machte es schon für einen Unterschied, ob eine Gruppe von Oberschülern einen Sachverhalt als wahr anerkannte oder nicht, aber Gotoda nickte zufrieden. »Als nächstes ist Doigaku mit dem Bericht zu den Untersuchungen in unserer Schule an der Reihe...«
Doigaku kam der Aufforderung durch Murasakino nach und holte aus seiner Umhängetasche einen Ordner hervor, den Amano auf dem von Tellern geräumten Tisch ausbreitete. Im Ordner waren eine Reihe von Fotos, die Amano offenbar heimlich aufgenommen hatte, in systematischer Reihenfolge eingeklebt worden. Unter den Bildern stand in Handschrift (vermutlich die von Doigaku) jeweils eine kurze Bildlegende geschrieben. Rei entfuhr ein Ausruf der Bewunderung und Gotoda knurrte etwas.
»Gute Arbeit!«
»Danke, war auch gar nicht so einfach.« Nachdem Doigaku auf Murasakinos Lob geantwortet hatte, holte er sein Notizbuch hervor und begann mit dem Bericht: »Saya Otonashi, 17 Jahre. Dem Lebenslauf, der in ihre Schulanmeldung eingeklebt ist, zufolge, lautet ihr gegenwärtiger Wohnsitz ...«
»Moment mal!« sagte Rei erschrocken. »Wo habt ihr die Sachen denn her?«
»Wir sind heimlich ins Lehrerzimmer geschlichen und haben's uns vom Schreibtisch des Klassenlehrers geborgt. Eine Kopie der Unterlagen befindet sich am Ende der Akte.«
»He, niemand hat gesagt, dass ihr so weit gehen sollt!« rief Murasakino mit einer leicht zornigen Stimme. »Was passiert, wenn sie euch auf die Spur kommen?!«
»Keine Sorge, wir haben's direkt vor Ort kopiert und gleich wieder zurückgelegt.«
»Ich werde das überprüfen ... Aber wahrscheinlich ist es frei erfunden.«
Gotoda, der das Streitgespräch der beiden geflissentlich überhörte, blätterte in der Akte und machte sich Notizen. »Sagt uns lieber, wie die Lage in der Schule ist.«
»Die Leute aus der 12-D sagen, dass sie im Prinzip ein ruhiges Mädchen ist. Sie redet mit niemandem, und es spricht sie auch niemand an. Sie kommt nie zu spät, fehlt nie und arbeitet im Unterricht gut mit. Besonders in Englisch scheint sie eine echte Kanone zu sein. Lehrer Shibazaki hat etwas auf Englisch gefragt, und sie hat seine Aussprache korrigiert.War wohl hochnotpeinlich für ihn. Manche sagen, dass sie eine Weile im Ausland gelebt hat. Vom Turnunterricht ist sie allerdings beurlaubt...«
»Dann hat sie wohl ständig ihre Tage«, sagte Amano.
»Was soll das bedeuten, dass sie niemand anspricht? Ich dachte, sie sei so hübsch?« Murasakino übersah Amanos Kalauer geflissentlich und formulierte einen Zweifel.
»Es heißt, dass sie irgendwie unnahbar wäre. Selbst wenn man sie ansprechen will, sobald sie unmittelbar vor einem steht ... «
»... ist man wie gelähmt.«
Doigaku blickte Rei überrascht ins Gesicht und nickte zustimmend. »Ja. Genau das haben alle gesagt.«
»Wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange ... « »Nein, nicht ganz«, korrigierte Rei Murasakinos Vergleich »Man fühlt sich eher wie ein Mensch, der in einem dunklen Wald einem Wolf begegnet.«
»He, Rei, das klingt ja ganz so, als ob du schon mal einem Wolf in einem dunklen Wald begegnet bist.«
»Bin ich auch. Allerdings nicht in einem Wald«, antwortete Rei und erwiderte Murasakinos Blick. Als Murasakino, der Rei anstarrte, erkannte, dass in dessen Blick nicht etwas Aufsässiges, sondern etwas Drohendes lag, runzelte er die Stirn und wandte die Augen von ihm ab.
»Wie wäre es dann mit ...bösartig?« Murasakino verschränkte die Arme und sprach das gleiche Wort aus wie zuvor schon Gotoda. »Das war es wohl auch, was dieses Mädchen namens Abe gemeint hat...«
Eine wunderschöne neue Mitschülerin, die ein bösartiges Geheimnis verbarg ... Das allein war eigentlich schon zu lächerlich, um wahr zu sein. Aber jetzt existierte ein soIches Mädchen an ihrer Schule wirklich, sie war in einen Mordfall verwickelt und in ihrer unmittelbaren Nähe gab es einen Tatzeugen und ein potentielles Opfer. Es war einfach nur noch absurd. Murasakino und die anderen konnten all das nicht vollends glauben, aber die merkwürdig beunruhigende Nähe, die sie zwischen dem, was ihnen erzählt wurde, und den Tatsachen spürten, verstörte sie nachhaltig.
»Also, wenn sie ihre Tage hat,dann bedeutet das schon mal, dass sie ein Mensch ist.«
»Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht einfach jeden Mist aussprechen, der dir in den Sinn kommt!« fuhr Murasakino Amano an, der mal wieder Unsinn verzapfte.
»Was wir über diese Saya wissen, sind alles nur subjektive Eindrücke und keine handfesten Beweise«, sagte Gotoda, der eifrig in der Akte hin- und her geblättert hatte, um eine Bilanz zu ziehen. »Ihr habt Fotos gemacht, dass man Wände damit tapezieren könnte, aber neue Erkenntnisse hat das nicht gebracht. Es war nicht mal das Geld für das Entwickeln der Bilder wert.«
»Das ist aber noch nicht alles ...« Mit einer herausfordernden Miene holte Doigaku aus der Brusttasche seiner Schuluniform einige Fotografien wie in der Hinterhand gehaltene Asse hervor und legte sie nebeneinander auf den Tisch. Reis Gesichtsausdruck verdüsterte sich, als er hastig nach den Bildern griff. Eines war heimlich aufgenommen worden und zeigte, wie Saya gerade in ein schwarzes Auto stieg. Daneben standen zwei Männer in schwarzen Anzügen. Das zweite Foto war mit einem Teleobjektiv aufgenommen und zeigte nur die beiden Männer. Es schien, dass Amano wenn schon nicht sonst, dann doch wenigstens beim Fotografieren ein glückliches Händchen hatte. Ein hochgewachsener Mann um die sechzig und ein kräftiger Mann um die vierzig. Es waren die beiden Ausländer, die Rei in jener Nacht gesehen hatte.
»Kein Zweifel, das sind sie«, sagte Rei beinahe murmelnd.
Doigaku und Amano lächelten zufrieden und gratulierten sich zur Feier ihres Erfolgs.
»Ich würde sagen, dass wir damit eine Bestätigung für Reis Aussage hätten«, sagte Doigaku mit stolz geschwellter Brust.
»Was soll der Geiz, wieso legt ihr's nicht gleich auf den Tisch, wenn ihr so was habt?« Murasakino klang ärgerlich, aber seine Miene wirkte eher erleichtert. Ja, es war die Aussage eines Freundes gewesen, aber ihr Inhalt war einfach zu unglaublich, als dass man sie ohne weiteres hätte glauben können. dass jetzt ein Indiz aufgetaucht war, das diese Aussage bestätigte, brachte den Fall in der Tat einen Schritt voran.
»Diese Saya scheint ein verdammt hohes Tier zu sein. Sie treibt es zwar nicht so auffällig, dass sie sich bis direkt vors Schultor karren lassen würde, aber immerhin wird sie in einer dicken Importlimousine zur Schule gefahren und abgeholt Und dann diese Leibwächter ...«
»Hast du sie verfolgt?« fragte Murasakino und goss noch etwas Bier in Doigakus Glas.
»He, heiße ich etwa Abebe Bikila?« Doigaku stürzte einen Schluck Bier hinunter und fuhr dann fort. »Na ja, vielleicht morgen, wenn man ein Motorrad organisieren könnte ...«
»Das ist nicht notwendig, warf Gotoda ein, der die Bildet von Rei erhalten hatte und sie betrachtete. Mit einer misstrauischen Miene hielt er die Bilder schließlich in die Runde. »Man merkt, dass ihr keine geübten Beobachter seid. Seht euch das Foto doch mal genau an.« Mit einem seiner nikotingelben Finger schnippte Gotoda eines der Bilder an.
»Ein diplomatisches Kennzeichen!« rief Doigaku.
»Was ist denn ein diplomatisches Kennzeichen?« fragte Amano.
»Kennzeichen, wie sie Botschaftsfahrzeuge haben, du Idiot«, antwortete Murasakino.
»Dann hast du das schon gewusst?« fragte Rei nach.
»Hört mal zu, ich drehe nicht die ganze Zeit Däumchen. Auch wenn's euch nicht leichtfällt, erinnert euch ab und zu daran, dass ich von Beruf Kriminalbeamter bin!«
Doigakus Miene verdüsterte sich, und Amano schenkte
Gotoda mit einer dienstfertigen Handbewegung Bier nach. »Und wohin fahren die dann?«
Gotoda leerte sein Glas mit einem Zug und antwortete dann. »Woher soll ich das wissen. Bin ich etwa Abebe?« Allgemeine Rufe der Enttäuschung erhoben sich und Doigaku bellte Gotoda an: »Du bist doch bloß ein Angeber, am Ende bist du auch nicht schlauer als wir!«
»Du wirst gleich merken, was mich von Amateuren wie euch unterscheidet«, sagte Gotoda und zückte sein geliebtes Polizeinotizbuch. »Die Nummer ist auf ein Fahrzeug der israelischen Botschaft in Tokio registriert. Allerdings scheinen die beiden Männer keine Botschaftsangestellten zu sein, und auch auf der Personalliste gibt es keine Namen, die auf sie passen würden.«
Mit einem Mal wurde es unruhig in der Runde, und die Mienen erstarrten.
»Sag mal, ist das wahr?«
»Israel... Meinst du etwa das Israel?« »Auweia...«
Natürlich war weder Rei noch seinen Freunden in diesem Moment klar, was daran eigentlich so schlimm sein sollte. Aber zu einem Zeitpunkt, als weder die genaue Natur der Affäre noch ihre Ausmaße sicher waren, musste das wie aus heiterem Himmel in die Runde geworfene Wort »Israel« einen Schock auslösen. Es gab eine Mordserie, deren Opfer politische aktive Oberschüler waren, dazu die groteske Mordmethode, eine rätselhafte Splittergruppe, deren Mitglied die Opfer waren und eine Schulwechslerin, die immer kurz vor den Verbrechen auftauchte ... Die Teile des Puzzles schienen irgendwie zusammenzupassen und irgendwie auch wieder nicht. Und jetzt gab es ein neues Teil in diesem Puzzle, noch dazu eines von völlig anderem Kaliber ...
Es war naheliegend, dass diese Affäre schon längst ein Niveau erreicht hatte, das die Möglichkeiten und Mittel einer Gruppe einfacher Oberschüler oder auch die eines einfachen Kriminalbeamten wie Gotoda bei weitem überschritt. Aber es war eine Tatsache, dass die Dinge sich jetzt in ihrer Schule und vor ihren Augen weiterentwickelten. Und auch dass Rei, der Augenzeuge, ebenso wie seine Kameraden, die sich zu Komplizen Gotodas gemacht hatten, seine Kompetenzen schon längst überschritten hatte sei es als vorbildlicher Schüler oder auch nur als radikaler Politaktivist.
Aber das war noch nicht alles. Ihre Rolle als parteilose Aktivisten verlieh ihnen eine eigentümliche Befindlichkeit, eine Art verzweifelter Entschlossenheit, ein Gefühl, als ob sie nichts mehr zu verlieren hätten. Und möglicherweise war es genau diese Befindlichkeit, die bei ihnen das Gefahrenbewusstsein lähmte, das normalerweise die Neugier im Zaum hielt.
Rätsel gab auch Gotoda auf. Die Psyche dieses Mannes, den es offenbar kaltließ, dass er eine Gruppe radikaler Jungaktivisten (die letztlich bloß Oberschüler waren) in eine soIche Affäre hineingezogen hatte, war sicherlich nicht ganz normal. Und wenn man in Betracht zog, dass er Kripobeamter war, konnte man sie sogar durchaus abnormal nennen. Im gleichen Maße wie sich die Affäre ausweitete und immer verwirrender wurde, eskalierte auch die Debatte darüber unter den Jugendlichen.
»Soll das heißen, hinter diesem Mädchen namens Saya steht der Staat Israel?«
»Wenn sie in einem Botschaftswagen gebracht und abgeholt wird, ist das gleichbedeutend damit, dass sie von nationalem Interesse für Israel ist?«
»Ob sie so eine Art japanisch stämmige Jüdin ist?«
»Ich frag mich eher, ob sie überhaupt eine Japanerin ist.« Ja, ihr Gesichtsausdruck hat schon so was Westliches.« »Aber wird jemand ohne japanischen Pass überhaupt an einer städtischen Oberschule zugelassen?«
»Findet ihr's nicht auch seltsam, dass sie lauter falsche Angaben in die Formulare geschrieben hat?«
»Da hat der Schulausschuss wohl gepennt.«
»He, pass auf, das sind konterrevolutionäre Äußerungen!«
»Wenn jemand so mächtig ist, dass er polizeiliche Untersuchungen behindern kann, wird er wohl kein Problem damit haben, einen Schulausschuss zu manipulieren.«
»Dann ist es also doch ein Verbrechen im Auftrag eines Staates.«
»Wenn Israel da mitmischt, könnte es auch eine internationale Verschwörung sein.«
»Ich hab's!« rief Amano mit schriller Stimme. »Die beiden Männer sind subversive Mossad-Agenten, und die Frau ist eine Killerin.«
»Wann kapierst du endlich, dass du nicht jeden Einfall gleich raus plappern sollst!«
»Der Mossad hat alle Hände voll mit arabischen Terroristen und Nazikriegsverbrechern zu tun. Oder glaubst du, denen fällt nichts besseres ein, als in ein demokratisches Land am andern Ende der Welt linksgerichtete Oberschüler zu liquidieren?«
»Und wieso sollte eine Killerin des Mossad ausgerechnet mit
einem japanischen Schwert herumlaufen?« »Ich hab's!« sagte Amano noch einmal. »Du hältst jetzt den Mund!«
»He, Murasakino, deine autoritäre Haltung gefällt mir nicht.« »Auch Amano hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung.« »Mach hier nicht den Bona!«
Der Ausdruck »den Bona machen«, war von dem Begriff Bonapartismus« abgeleitet und bedeutete, dass jemand autokratische oder diktatorische Tendenzen zeigte. Im Alltag wurde es eher im Sinne von »spiel dich nicht so auf« gebraucht.
»Wenn du's weißt, dann sag's schon! Spann uns nicht auf die Folter!«
»Also... die beiden sind CIA-Agenten!«
»Da habt ihr's! Ich hab doch gleich gesagt, lasst ihn nicht quatschen!« Murasakino hatte sein x-ten Wutausbruch an diesem Tag, aber da er selbst keine bahnbrechende Erklärung anzubieten hatte, kehrte schließlich Ruhe in der Runde ein. »Sag mal«, wandte Rei sich an Gotoda. »Wie denkst du eigentlich über die Sache?«
»Meinst du die Identität dieser Saya, oder die Affäre insgesamt?«
»Meinetwegen über beides.«
Gotoda, der sich zuletzt mit dem Rücken an die Wand gelehnt hatte und der Debatte unter Reis Kameraden nur mit einem Ohr gefolgt war, beugte sich jetzt nach vorne, und die ganze Runde blickte aufmerksam zu ihm.
»Also... Wie wär's wenn wir beim Essen noch mal in Ruhe über alles nachdenken. Euer Nachschlag kommt gerade.« Rippenfleisch spezial für zehn Personen; Roastbeef für zehn Personen; dreimal Rinderzunge mit Salz und dreimal mit Soße; zweimal Kimchi und zweimal Kakuteki; eine große Portion gemischte Beilagen; zweimal kalte Nudeln; eine Reissuppe extragroß; eine große Portion Bibimba mit Suppe; eine Extra Portion Yukke-Bibimba mit Suppe; fünf Bier.
Als die Teller mit all diesen Nachbestellungen schließlich eng nebeneinander gedrängt auf dem Tisch standen, war das ein Anblick wie bei einem wüsten Freßgelage. In einer Gaststätte wie dem Rikaen, das auf preiswerte Speisen und große Portionen spezialisiert war, hatte man für Feinheiten nicht viel übrig. Folglich wurden die Bestellungen auf einmal und nicht etwa entsprechend dem Fortgang nach und nach an den Tisch gebracht. Über Einteilung und Reihenfolge des Essens muss. ten die Gäste selbst entscheiden. So kam es denn, dass Rei und Nabeta, deren kalte Nudeln eigentlich erst zum Abschluss gegessen werden sollten, sich voll auf die unerquickliche Aufgabe konzentrieren mussten, ihre Nudeln zu schlürfen und gleichzeitig Fleischhäppchen vom Grill zu essen.
Murasakino, der beim Debattieren genauso wie beim Grillen gerne das Heft in die Hand nahm, legte sauber in Reihe und Glied Fleischhäppchen auf den viereckigen Grillrost und begann zu sprechen. »Es mangelt immer noch an Informationen.« Amano und Doigaku, die mit ihrer Reissuppe und dem Bibimba deutlich freier in der zeitlichen Gestaltung ihres Essens waren, tranken gemütlich von ihrem Bier und lauschten Murasakinos Rede, während sie darauf warteten, dass das Fleisch gar wurde. »Ich denke, das Verständnis der eigentlichen, wahren Natur dieser Affäre ist der einzige Weg zu ihrer Lösung. Und wenn ich hier von einer Lösung spreche, meine ich von unserem ideologischen Standpunkt aus betrachtet und nicht etwa den Schutz des Schülerkomitees der SR-Fraktion vor Angriffen. Ich denke vielmehr, dass es unsere vordringlichste Aufgabe und unser Ziel sein muss, den Mord an Seiji Aoki, einem Mitglied im Kampfkomitee unserer Schule, zu verhindern. Darüber hinaus sollten wir bereit sein, die Ermittlungsarbeit eines gewissen Herrn Gotoda zu unterstützen, soweit es sich bei den fraglichen Verbrechen um einen feindlichen, gegen die gesamte Linke unseres Landes gerichteten Akt des politischen Terrorismus oder gar eine staatliche Verschwörung gegen uns handelt. Sollte sich aber herausstellen, dass es sich hierbei nicht um politisch motivierte Verbrechen handelt, würde dieses Zweckbündnis umgehend aufgelöst ... Könnt ihr mir soweit folgen?«
Nabeta, Doigaku und Amano antworteten, dass sie keine Einwände hätten und nach kurzem Nachdenken nickte auch Rei zustimmend.
»He, ich weiß doch längst, dass es für euch nur ein Manöver ist«, murrte Gotoda, und es klang, als ob er langsam genug davon hätte. Murasakino ignorierte ihn einfach und fuhr fort. »Auch wenn wir weiterhin nur Informationen sammeln sollen. Das eigentliche Problem ist doch, wohin das ganze führen soll.«
»He, ich glaube, das Fleisch ist gar!« »Reden wir beim Essen weiter!«
Die gesamte Mannschaft stürzte sich auf das Fleisch, und Murasakino füllte die frei gewordenen Plätze auf dem Grill wieder mit neuem Fleisch auf. Selbstverständlich wurde stets wesentlich schneller gegessen, als gegrillt werden konnte, weshalb man nicht wirklich beim Essen würde reden können, sondern eher in den Zwangspausen, die sich zwischen dem Essen ergaben.
»Ermittlungen außerhalb der Schule sind nur beschränkt möglich. Und bei der gegenwärtig einzigen Spur, nämlich der Botschaft, sind wir machtlos.« Nabeta redete, während er zugleich auf einigen Häppchen Fleisch herumkaute, die er sich gerade eingeworfen hatte. »Ich muss schon sagen ... so auf die Schnelle hast du das ja gut herausgefunden.«
»Ich hab einfach bei der Auslandsabteilung nachgefragt«, antwortete Gotoda, während er sich selbst Bier nachgoss. »Auslandsabteilung... Gehört die nicht zum Staatsschutz?
Ich dachte, du wärst nicht beim Staatsschutz?« fragte Rei.
Als Gotoda Reis überraschte Miene sah, stellte er sein Glas ab. »Ich habe einen Freund beim Staatsschutz, der mir noch einen Gefallen schuldig war. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die Kerle da routinemäßig auch Botschaftsangehörige beschatten.«
»Klar doch«, antwortete Rei doppeldeutig, aber er spürte, dass ihn etwas an der Sache störte.
»Ein echter Profi«, quatschte Amano.
»Diese Spur mit der Botschaft werden wir wohl dir überlassen müssen.« Als Murasakino das zu Gotoda sagte, wusste Rei, dass sie keine Wahl hatten. Mit der Botschaft als Gegner wären sie chancenlos. »Die Frage ist, was mit der Schule wird«, sagte Murasakino undeutlich.
»Na ja, die Schlüsselfigur dürfte Aoki selbst sein.«
»Der 'Typ kommt immer noch in den Unterricht, als ob überhaupt nichts sei. Der Kerl hat echt Nerven.«
»Ist mir neu, dass Aoki soviel Mumm hat.«
»Ich sage nur Strafaktionen und blutige Säuberungen.
Auf solche blutrünstige Geschichten ist der schon immer abgefahren.«
Rei dachte von neuem über Aoki nach, während er dem Gespräch der anderen lauschte. Seiji Aoki war zwar ein Mitglied der AG Soziales, aber er war dort eher eine Karteileiche, die dazu diente, die Mitgliederzahlen zu schönen. Bis vor einem Jahr war er Mitglied in der Fußball-AG gewesen, und eigentlich entsprach das auch eher seinem Wesen. Er war so ein klassischer Sportlertyp, der immer einen leichten Geruch nach Schweiß verströmte. Der Anstoß dazu, dass sich Aoki ihrer Gruppe angeschlossen hatte, war ein heftiger Streit gewesen, den Murasakino, Rei und einige andere mit dem Klassenlehrer von Aoki vom Zaun gebrochen hatten.
Rei war damals mit seinen Kameraden von Klasse zu Klasse gezogen, um zur Teilnahme an Antikriegskundgebungen aufzurufen, und dabei in Streit mit Aokis zufällig anwesendem Klassenlehrer geraten. Als der Klassenlehrer sie mit den Worten »ihr Kerle solltet besser den Mund halten und lernen!« herunterputzte, war es Aoki, der ihre Partei ergriffen und wütend protestiert hatte. Mit hochrotem Kopf und voller Wut schrie er den Lehrer an und setzte ihm zu, dass er Rei und die anderen reden lassen solle.Wenn der völlig verdutzte Rei und seine Kameraden Aoki nicht gebremst hätten, wäre er möglicherweise sogar noch auf die Idee gekommen, den Lehrer zu verprügeln.
Wie düster mochten die Gedanken gewesen sein, die Aoki wohl damals mit sich herumtrug, dass er, der sonst gegen Bälle trat oder seine Runden um den Sportplatz lief, so etwas tat! Rei hatte nicht die geringste Ahnung. Aber die Affäre war der Anlass dafür, dass Aoki zu politischen Versammlungen kam, sich bei der AG Soziales blicken ließ und sich relativ schnell von seinem Leben als strebsam büffelnder Schüler verabschiedete. Es kam nicht selten vor, dass Aoki, der ein einfacher, geradliniger Typ und ziemlich heißblütig war, mit seinem Verhalten auch unter den Kameraden auf Kritik stieß, aber Rei hatte durchaus Sympathie für Aokis beinahe kindlich zu nennenden Gerechtigkeitssinn. Erst nachdem er der sogenannten »SR-Fraktion« beigetreten war, hatte es damit angefangen, dass Aokis Erscheinung sich veränderte, dass er einen merkwürdig düsteren Blick bekam und sich durch sein Verhalten von Rei und den anderen immer weiter distanzierte.
Rei und die übrigen Parteilosen verhielten sich allgemein tolerant, wenn jemand einer bestimmten Partei beitreten wollte. Ihnen war bewusst, dass sie nur ein zusammengewürfelter Hafen waren und dass es angesichts der ideologischen Differenzen zwischen den einzelnen Mitgliedern stets von aller größter Bedeutung war, das Gleichgewicht der zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrer Gruppe zu bewahren. Zumindest war klar, dass das arrogante Auftreten von Aoki in der AG neulich den Rahmen dessen, was Rei und die anderen hinnehmen konnten, weit überschritten hatte. Das Ergebnis war, dass es in der Gruppe um den Ruf von Aokis menschlichen Qualitäten zur Zeit nicht zum Besten bestellt war.
Abe hatte gesagt, dass sie glaube, dass Kajio nicht wieder auftauchen werde. Und Rei dachte für sich, dass eine Rückkehr Aokis in ihren Kreis wohl vorerst ausgeschlossen wäre. Die Kälte in Aokis Blick, die Rei an jenem Tag förmlich auf seiner Haut spürte, war nicht die Art von Blick, mit der ein Mensch einen anderen ansah. Man sagt, dass Menschen sich verändern, aber hier ging es nicht einfach nur darum, dass jemand anders <lachte. Was war das nur für eine Kraft, die einen Menschen wie Aoki so sehr verändern konnte? Rei hatte nicht den leisesten Schimmer.
»Was machen wir wenn er nicht auf eine Vorladung reagiert?« »Wie wär's mit einem Verhör?«
»Bloß nicht, am Ende wird er noch gelyncht!«
»So was meine ich doch gar nicht. Es geht nur darum, ihn mit strengen Worten zur Rede zu stellen.«
»Und wo ist der Unterschied zu einem Verhör?«
Die Debatte konzentrierte sich auf einen Punkt, die Frage, wie man Aoki am besten Informationen entlocken könnte. »Vom Herum quatschen kommen wir jedenfalls nicht weiter. Ich schlage vor, dass ich ihn vorlade und versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Was haltet ihr davon?«
Ja, mach das nur. Für mich ist der Typ sowieso ein rotes Tuch.« Nabeta, der noch nie sonderlich gut mit Aoki ausgekommen war, stimmte Murasakino zu, und auch der Rest hatte keine Einwände.
»Bist du auch einverstanden, Rei?«
Ja, ich überlasse das dir.« Rei war froh, als er hörte, dass sich Murasakino der Sache annehmen wollte. Er fragte sich insgeheim, ob er vielleicht Angst vor Aoki habe. Aber war es wirklich Aoki selbst, der ihm Angst machte, oder war es dieses etwas, das Aoki so sehr verändert hatte?
»Gut, gehen wir noch mal unseren Aktionsplan durch. Doigaku und Amano beschatten weiterhin das Mädchen. Für den Bereich außerhalb der Schule ist der Alte zuständig. Ich selbst werde mich mit Aoki auseinandersetzen. Rei und Nabeta ... «
»Da wäre noch etwas«, unterbrach Rei Murasakinos Rede schwall.
»He, du hast einen Vorschlag?«
»Doch hoffentlich nicht, dass wir nach Aoki auch noch das
Mädchen verhören?«
»Idiot, die hantiert mit einem Schwert!« »Ja, aber nicht in der Schule!«
»Und wer sagt dir, dass sie dich nicht nachts irgendwo ummacht?«
»Schnauze halten, verdammt!« Murasakino brachte Doigaku und Amano zum Schweigen und unternahm einen neuen Anlauf: »Also, spuck's aus, Rei.«
»Ich meine das Motiv.«
Gotoda, den das schier endlose Geschwätz der Jugendlichen ermüdete, hatte die ganze Zeit mit einem angewiderten Gesichtsausdruck Zigaretten geraucht. Jetzt verzogen sich seine Mundwinkel zu einem Grinsen.
»Natürlich hattest du recht, Murasakino. Um die Natur dieses Falls zu begreifen, müssen wir die Fakten herausarbeiten Aber ich glaube, es ist notwendig, den Fall auch noch unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten«, ergänzte Rei.
»In der Tat. Der Schlüssel zur Natur eines Verbrechens liegt stets in seinem Motiv. Sehr gut, junger Mann.« Gotoda sagte das im Ton eines Seminarleiters, der die Diskussion seiner Studenten in eine bestimmte Richtung lotsen will. »Fahr bitte fort.
Etwas an Reis Äußerung schien bei Gotoda, der der Debatte unter den Jugendlichen bisher wortlos zugehört hatte, Interesse geweckt zu haben. Während Rei noch über die wahren Absichten Gotodas spekulierte, begann er zu reden.
»Es handelt sich um einen Mordfall, deshalb müsste die Art der Ausführung einen Hinweis auf das Motiv des Täters geben können. Alle drei Morde wurden nach der gleichen Methode ausgeführt und zwar nach einer besonders exzentrischen. Da ist es doch naheliegend, dass dahinter eine bestimmte Absicht stand.«
»Rache, Bestrafung, Abschreckung...«
»Hm, das passt alles nicht so richtig. Jemandem das Blut aus dem Körper zu ziehen, ist vielleicht hinterhältig, aber besonders einschüchternd oder überzeugend ist es nicht.« »Vielleicht ist der Mörder einfach pervers?«
»Das Argument, dass in der Methode der Schlüssel zum Verständnis des Motivs liegt, mag ja vernünftig sein, aber die Methode ist in diesem Fall einfach zu sonderbar, als dass man auf irgend etwas schließen könnte.«
»Kurzum, wir stehen wieder am Ausgangspunkt. Ich glaube nicht, dass uns Reis Beitrag wirklich weiterbringt«, sagte Murasakino, als wolle er damit ein abschließendes Urteil fällen.
»Wieso lässt du ihn nicht ausreden!« Mit ziemlich genervt klingender Stimme griff Gotoda erneut ein, und Rei redete weiter:
»Ich glaube ja auch nicht, dass man anhand der Mordmethode direkt auf das Motiv des Täters schließen kann. Aber zumindest kann man aufgrund der Gemeinsamkeiten und der Eigentümlichkeiten in der Mordmethode Schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass es sich um das Werk ein und desselben Täters handelt. Soweit kann mir doch jeder folgen, oder?«
»He, mach's doch nicht so kompliziert.« »Sag schon, worauf du hinauswillst.«
»Etwas mehr Geduld bitte! Also gut. Bei einer Mordserie muss man mehr als nur die Gemeinsamkeiten und Eigentümlichkeiten der einzelnen Morde beachten. Die Unterschiede zwischen den Morden verdienen ebenfalls Aufmerksamkeit.«
»Wie meinst du das?« fragte Amano.
»Werde langsam mal konkreter«, ermahnte Murasakino.
»Ich habe von einer Mordserie gesprochen. Habt ihr schon vergessen, dass ich Augenzeuge bei einem Mord war, den dieses Mädchen begangen hat? Die drei Morde sind in der Tat alle nach der gleichen Methode abgelaufen, aber das ist nicht die Methode von Saya! Sayas Methode ist anders! Man könnte sagen, fast gegensätzlich!«
»Genau. Blut entziehen und Blutbad«, stimmte Doigaku zu. »Sicher recht gegensätzlich«, fuhrt Murasakino fort. »Na und? Diese verhaltene Reaktion ärgerte Rei, aber er fühlte, dass
das, was anfangs bloß eine vage Eingebung gewesen war, jetzt wo er es in Worte fasste, eine immer klarere Form annahm »Also, ich denke, das Wichtigste ist, dass die Unterschiede in der Methode bedeuten, dass auch die Motive unterschiedlich sind.«
Nabeta entfuhr ein leiser Seufzer. »Du meinst wahrscheinlich, dass sich gerade in den Unterschieden die eigentliche Natur dieses Falls erweist?«
»Was ich sagen will, ist ...« Rei unterbrach Nabeta, der endlich ahnte, worauf Rei eigentlich hinauswollte und fuhr dann schnell fort:»... dass es in dieser Mordserie abgesehen von Saya und den beiden Ausländern noch einen ganz anderen Verdächtigen geben dürfte.«
Rei warf einen Blick in die Runde, wie um sich der Wirkung seiner Worte zu vergewissern. Doigaku und Murasakino hielten mit ihren Essstäbchen inne und starrten Rei an, während Nabeta den Kopf in die Hände stützte.
»Also, wie soll das denn ...?« Amano, der offenbar noch Probleme mit Reis Darlegung hatte, blickte Murasakino fragend an. »Was gibt's da zu fragen! Nach Reis Meinung sind die drei nicht von dieser Saya, sondern von jemand anders umgebracht worden!«
»Es gibt ein Mädchen, die immer kurz vor einem Mord in der Nähe des Opfers auftaucht und kurz danach wieder verschwindet. Jetzt ist dieses zweifellos verdächtige Mädchen an unsere eigene Schule gewechselt. Und dann auch noch in die Klasse von Aoki, der derselben Splittergruppe angehört wie die drei Mordopfer. Von dieser Konstellation haben wir uns blenden lassen und sind zu dem voreiligen Schluss gekommen, dass sie etwas mit diesen Morden zu tun haben muss. Das war fahrlässig von uns!«
Rei atmete kurz durch und führte dann das Bierglas zum Mund. Im gleichen Moment ertönte ein gekünsteltes Klatschen.
»Respekt. Klasse Leistung für einen Oberschüler.« Die Blicke der gesamten Runde richteten sich auf Gotoda, der ein zufriedenes Lachen zeigt und applaudierte. »Aber es ist erst die halbe Miete.«
»Wie meinst du das, Alter?« fragte Nabeta und sah Gotoda dabei scharf an. »Nun, dass ein zweiter Täter existiert, ist eine Möglichkeit, die bei nüchterner Analyse der zur Verfügung stehenden Informationen beinahe zwangsläufig in Betracht gezogen werden sollte. Und dass nicht irgendeiner von euch, sondern ausgerechnet derjenige, der Saya als Augenzeuge bei einem Mord beobachtet hat, darauf kommt, ist schon ein bißchen armselig. Findet ihr nicht auch?« Reis Hochstimmung war mit einem Mal verflogen. Jetzt, wo er es aus Gotodas Mund hörte, musste er ihm recht geben. »Und noch etwas. Das Motiv eines Verbrechens zeigt sich nicht allein an der Methode, sondern noch an etwas anderem. Hat jemand eine Idee?« Rei und die anderen wechselten Blicke, aber im Moment schien keinem von ihnen etwas einzufallen. »Die Antwort ist: an der Leiche«, sagte Gotoda mit einem freudestrahlenden Gesichtsausdruck.
»Oder präziser ausgedrückt daran, in welchem Zustand der Tote zurückgelassen wurde. Aber das ist nichts, was man beim Essen diskutieren sollte. Oder wollt ihr es wissen?«
»Mein Magen hält was aus!« sagte Murasakino herausfordernd und der Rest der Runde stimmte ihm zu.
»Wirklich, gar kein Problem!«
»Spann uns nicht auf die Folter!« Nabeta wuchtete eine große Menge Rippenfleisch auf den Grillrost, von dem augenblicklich dichter Qualm aufstieg.
»Gut, dann sollt ihr es hören ...« Gotoda zündete sich eine Echo an.
»Bevor ich anfange, darüber zu erzählen, wie der Täter die Leiche seines Opfers beseitigt, solltet ihr etwas darüber wissen, wieso Menschen überhaupt ihre Toten beseitigen. Man kann nämlich ohne Übertreibung sagen, dass die Geschichte des Menschen eine Geschichte der Auseinandersetzung darüber ist, wie mit Toten zu verfahren ist.«
»Sind wir jetzt im Geschichtsunterricht?« fragte Doigaku. »Das klingt nach einer längeren Geschichte«, ergänzte Nabeta Als ob er diese Worte bestätigen wollte, goß Gotoda sich in aller Ruhe Bier nach und fuhr dann fort.
»Tod durch Krankheit, natürlicher Tod, Unfalltod, Mord, Tod im Krieg. Unabhängig von den Umständen haben die Menschen schon immer ihre Toten eingesammelt und beseitigt Wieso eigentlich?«
»Weil Leichen verwesen.« »Weil sie unhygienisch sind.«
»Leichen sind ein Nährboden für Infektionskrankheiten.« »Sie sind schmutzig und stinken.«
»Ist das alles?« fragte Gotoda.
»Um ein Verbrechen zu vertuschen. Um Ermittlungen z erschweren ... «
»Dieses Thema behandeln wir später. Mich interessieren jetzt allgemeinere Motive für die Beseitigung von Leichen.«
»Es ist ein ethisches Problem. Die öffentliche Moral einer Gesellschaft sagt, dass es unerwünscht ist, Leichen einfach liegenzulassen. Und es verstößt gegen die Menschenwürde.« »Hygiene, Moral, Menschenwürde ... Sonst nichts?«
Die Jugendlichen tauschten ratlose Blicke aus. Murasakino, von Natur aus ungeduldig, zeigte erste Anzeichen von Ärger und wackelte mit den Knien. Doigaku zündete sich eine Zigarette an. Auch Rei hatte nicht die geringste Ahnung, worauf Gotoda mit seiner Frage hinauswollte.
»Ich hab's!« rief Amano und hob die Hand. »Aus Angst!« Gotoda zeigte ein schelmisches Grinsen und bohrte dann weiter. »Angst? Vor was?«
»Na, vor den Leichen.«
»Genauer.«
»...
Der um eine Antwort verlegene Amano blickte hilfesuchend durch die Runde, aber natürlich konnte ihm niemand beistehen.
»Angst davor, dass der Tote die Augen öffnen, aufstehen und herumlaufen könnte. Anders ausgedrückt, Angst davor, dass der Tote ins Leben zurückkehrt.« Gotoda sprach im Ton eines ausgefuchsten Lehrers, der einen missratenen Schüler zur Lösung einer Aufgabe gelotst hat, und Amano nickte mit einer überglücklichen Miene mehrmals zustimmend. Gotoda leerte zufrieden sein Bier.
»Sag mal...« Murasakinos Miene verriet, dass er es einfach nicht mehr aushielt. »Von was redest du da überhaupt?«
»Na, davon, wieso die Menschen ihre Toten beseitigen.« Gotoda goss Bier in sein leeres Glas und sah dabei aus, als ob er sich nicht das Geringste aus Murasakinos Zorn machen würde. »Hygiene, Moral, Menschenwürde ... Das sind doch alles
Begriffe, die es erst seit wenigen Jahrhunderten gibt. Wie haben die Menschen, die im Kulturkreis des vorindustriellen Zeitalters, in einer Welt, die als schriftlose Gesellschaft bezeichnet wird, lebten, den Tod gesehen? Wie haben Menschen Krankheit und Tod erklärt, die noch nicht einmal Grundlagen Wissen über Physiologie, Pathologie und Immunologie hatten?«
»Mit dem Teufel oder dem Totengott oder so«, antwortet der besonders eifrige Amano und lehnte sich dabei vor. Gotod zeigte ein freundliches Lächeln. Hätte der »Lehrer« Gotoda, dieser Mann mittleren Alters mit seinem Bierglas in der Hand nicht so offensichtlich nach Bulle ausgesehen, hätte man die ganze Szene vielleicht für ein erbauliches Zwiegespräch zwischen Lehrer und Schüler halten können.
»Bedauerlicherweise hat der Teufel nur mit dem Fall der menschlichen Seele zu tun. Das Patent auf die Sakramente, die mit Leben und Tod des Menschen zu tun haben, liegen aber allein in der Hand Gottes. Außerdem waren solche christlichen Ideen anfangs ohnehin auf eine winzige, privilegierte Schicht der europäischen Welt beschränkt, wo sie als eine Art Luxusweltbild kursierten. Die Menschen damals brauchten aber eine einfachere und überzeugendere Erklärung.«
Gotoda pickte einen Happen Kimchi aus einer Schale und schob ihn sich in den Mund. Der Kimchi schmeckte billig und war einfach nur scharf, ohne eigentlichen Geschmack. Unter einem Hustenanfall fuhr Gotoda fort.
»Massenhafter Tod, verursacht durch grassierende Seuchen.. unerklärlicher Tod durch genetische Krankheiten ·• unerwarteter Tod durch Naturgewalten wie Steinschlag oder Blitze.. natürlicher Tod durch Altersschwäche. . . Der Tod suchte die Welt in vielfältiger Form heim, er war unbequem und doch allgegenwärtig und den Menschen damals verlangte es nach einer Erklärung, um der Furcht und den sozialen Ängsten, welche der Tod mit sich brachte, begegnen zu können. Ich wiederhole noch einmal, wir sprechen von einer Zeit, in der es keine Rechtsmedizin, ja noch nicht einmal Ansätze einer Pathologie gab. Verständlich war der Tod für sie nur als Folge eines Mordes oder Krieges, also als Folge des bösen Willens irgendeiner Person, nicht aber als kosmisches oder natürliches Gesetz. Folglich kam für sie der Tod nicht einfach, irgend jemand brachte ihn. Was war die einfachste und zudem überzeugendste Erklärung? Gib den Toten die Schuld am Tod!«
»Die Reihenfolge ist aber verkehrt«, nörgelte Murasakino, der sich um das Grillen der Fleischhäppchen kümmerte und sich ansonsten seinem eigenen Yukke-Bibimba widmete.»Egal, wie zurückgeblieben das wissenschaftliche Denken damals in der Welt war, so was wie Logik muss es gegeben haben. Der Tod verursacht den Toten, nicht umgekehrt.«
»Bedeutet logisches Denken denn nicht, dass das Denken gewöhnlich der gleichen Bahn folgt und am Ende das gleiche Ergebnis steht?« entgegnete Gotoda. Sein Appetit schien von Murasakinos Yukke-Bibimba angeregt worden zu sein, denn er zog den Beilagen Teller zu sich heran. »In unserem Fall ist es denkbar, dass zwei Vorurteile in der Wahrnehmung die Schlussfolgerungen der Menschen damals beeinflusst haben. Anders formuliert ... Wenn zwei Ereignisse aufeinanderfolgen, ist das erste Ereignis die Ursache des zweiten. In unserem Fall hieße das erste Ereignis das Auftauchen eines Toten und das zweite Ereignis wäre ein neuerlicher Tod.« Gotoda hob den Beilagen Teller an und rezitierte: »Post hoc ergo propter hoc. Das heißt B kommt nach A, also muss A die Ursache für B sein.«
»Wie bitte?« fragte Murasakino.
»Als ihr das Auftauchen dieses Mädchens namens Saya mit den drei Morden in Verbindung gebracht habt, seid ihr der gleichen Logik gefolgt,« antwortete Gotoda und stopfte sich den Mund mit Gemüse voll, während Murasakino ein angewidertes Gesicht machte.
»Das mit dem Auftauchen des Toten, wie ist das gemeint? fragte daraufhin Amano.
»Ganz wörtlich. Überall auf der Welt, in den verschiedensten Kulturkreisen gibt es Kerle, die sich nicht damit begnügen, Tote zu sein, sondern aus ihren Gräbern zurückkommen, um ihren Familien und ihren Freunden den Tod zu bringen« Laut und geräuschvoll kauend fuhr Gotoda schnell fort. »Der Vampir der Slawen, der Upyr der Russen, der Vrykolakas der Griechen, der Strigoii der Rumänen, der Nachtzehrer im Norden Deutschlands ... «
»Moment mal, redest du da gerade von Vampiren? Von Blutsaugern?« fuhr der erschrockene Amano hoch und blickte von seinem Teller auf.
»He, mach mal halblang,Alter«, sagte Nabeta und ließ seinen Teller mit Bibimba für einen Moment unbeachtet stehen. »Hört doch erst mal in Ruhe zu ... «
»Der Vampir ist ein lokal begrenzter und sehr intensiver Ausdruck des Versuchs, alle möglichen unerklärlichen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod zu erklären, er ist eine Art Sündenbock. Ähnlich wie das Eintreiben eines Holzpflocks in die Brust symbolischer Ausdruck einer Methode war, der Bedrohung durch die Toten zu entkommen. Zum Beispiel ist die Legende von der Verbreitung des Vampirismus, also die Idee, dass ein Mensch, der von einem Vampir gebissen wird, selbst zum Vampir wird, einfach ein Modell gewesen, die Ausbreitung von Seuchen zu erklären. Von unserem modernen Standpunkt aus betrachtet, mag diese Art der Interpretation von Phänomenen natürlich hoffnungslos fehlerhaft erscheinen, aber das Interessante an dieser Interpretation ist, dass sie alle Informationen, die den Menschen in der damaligen Zeit zugänglich waren, widerspruchsfrei in sich vereinte. Auch vermochte sie viele der allgemeinen Sitten und Bräuche, die selbst von Betroffenen nur schwer erklärbar waren, logisch zu erklären. Aber lassen wir das, ich komme vom Thema ab ..•
»Mann, hab ich mich erschrocken«, murmelte Amano, atmete tief durch und wandte sich wieder dem Schlürfen seiner kalten Nudeln zu.
»Ich dachte schon, es ging um die drei Ermordeten.« »Freilich, wenn man es so betrachtet, ist es irgendwie logisch ...«, antwortete Doigaku zustimmend und nickte.
•Die Bisswunden am Handgelenk, der große Blutverlust ... Dann ist ihnen das Blut also nicht entzogen, sondern ausgesaugt worden!« sagte er und blickte Nabeta, der ihm gegenüber saß, in die Augen. »Das würde auch erklären, wieso am Tatort keine Blutspuren zurückgeblieben sind.«
Nabeta begann, seine Meinung über Doigaku zu ändern und senkte seine Stimme. Amano, der gerade den Löffel zum Mund führte, hielt inne.
»Das ist nicht euer Ernst, oder ... «
»Hört auf Quatsch zu reden! Esst lieber schneller! Das Fleisch brennt schon an!« Nabeta und Doigaku reagierten mit einem irren Lachen auf Murasakinos Anschnauzer und streckten ihre Stäbchen nach dem Fleisch aus.
»Hört auf damit, es reicht!«
»Einfach zu komisch, wie du reagierst!« Auch Gotoda begann sein bekanntes Hyänen grinsen zu zeigen, als er das Hin und Her zwischen Murasakino und den anderen beobachtete.Was hatte dieser Gotoda sich nur dabei gedacht, ihnen einfach so ein Thema wie Vampire aufzutischen? Wieder wunderte sich Rei über die wahren Absichten Gotodas, während er seine innere Unruhe mittels der vor ihm stehenden Schüssel Nudeln zu vertuschen versuchte.
»Hast du vorhin nicht was von zwei Vorurteilen gesagt?«, fragte Murasakino und machte sich wieder daran, Fleischhäppchen auf dem Rost zu verteilen.
»Wie gesagt, B kommt nach A, deshalb muss A die Ursache...« »Schon klar, das weiß ich. Aber was war das zweite?«
»Um auf ein bestimmtes Modell zu schließen, benötigten sie nicht eine bestimmte Anzahl von Ereignissen. Ein einziges genügte.«
»Das kapier ich nicht, sagte Doigaku. »Erklär das mal«, fügte Nabeta hinzu.
»Zum Beispiel. .. Nehmen wir an, wir haben hier einen Arm, der aus einem Grab herausschaut.« Gotoda stieß ein Essstäbchen in den Berg Roastbeef, der auf dem großen Teller aufgehäuft war.
»Wenn man sich die damalige Beerdigungspraxis vor Augen hält, war das sicherlich keine Seltenheit. Ich spreche nachher noch ausführlich darüber, aber ein tiefes Grab auszuheben ist nicht nur schwere körperliche Arbeit, sondern auch an eine Reihe topographischer Voraussetzungen gebunden. Deshalb sind die allermeisten Gräber flach und nur von wenig Erde bedeckt. Wenn es längere Zeit regnet oder Tiere herum scharren, zeigt der Tote dann schnell sein Gesicht. Aber der Mensch, der den aus dem Grab ragenden Arm als erster entdeckt, sieht nur eine Stufe in diesem Prozess, nämlich dass hier ein Arm aus einem Grab ragt. Es gibt eine Redewendung, die besagt, dass der Arm eines Missetäters aus seinem Grab herausragt. Also handelt es sich um den Arm eines Verbrechers. Verbrecher sind so eine Art Vorläufer von Vampiren, also muss hier ein Toter versuchen, sein Grab zu verlassen. Um das Grab herum sind Spuren von Hundepfoten oder ähnlichem. Die sind der Beweis dafür, dass der Vampir sich in eine Bestie verwandelt hat und herumgestreift ist ... Ungefähr nach diesem Schema müsst ihr euch das vorstellen. Und was glaubt ihr, was erst los ist, wenn nicht nur ein Arm, sondern der halb verweste Oberkörper einer Leiche aus dem Grab herausschaut.«
Die Backen von Murasakino und Doigaku, die den Mund voll Fleisch hatten und eifrig kauten, erstarrten.
»Aber es geht noch weiter. Viele verschiedene Leute hören diese Geschichte und interpretieren sie alle auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist der Anfang einer vielfältigen Überlieferung...«
»Ich würde sagen, denen mangelte es an Informationen.« Das war Murasakino, der es irgendwie geschafft hatte, das Fleisch herunterzuschlucken, und sich mit seiner Lieblingsphrase zu Wort meldete.
»Macht euch klar, dass es in der damaligen Gesellschaft keinerlei Informationen gab, die nicht subjektiv beeinflusst waren. So etwas wie induktives Denken, bei dem man aus empirisch begründeten Tatsachen übereinstimmende Punkte heraussucht, um daraus eine Schlussfolgerung abzuleiten, die alles einheitlich zu erklären vermag, war praktisch nicht existent. Ein zusammenhängender Ablauf formt ein Ereignis oder Geschehen. Die Menschen verknüpften verschiedene Ereignisse, von denen sie aus eigener Erfahrung oder aufgrund von Hörensagen wussten, mit einem bestimmten Motiv und gaben ihnen so Folgerichtigkeit. Dann erzählten sie diese Ereignisse als einen zusammenhängenden Ablauf. Diese Darstellung musste irgendwann in einer Erzählung enden, die von den ursprünglichen Ereignissen denkbar weit entfernt war. Anders ausgedrückt, es war ein unvermeidlicher Prozess, dass Beweise zunächst interpretiert und daraufhin mittels dieser Interpretation fehlende Beweise ergänzt wurden.«
Vor dem vulgären Kunstobjekt, das aus einem Berg Roastbeef und einem Essstäbchen geformt worden war, setzte Gotoda seine Darstellung mit offensichtlicher Freude fort.
»Denkt daran, dass es lediglich die Arroganz der modernen Menschen ist, die diese Art von Denken als das unwissende und unsinnige Gerede einer von Feudalherren ausgebeuteten, geistig minderbemittelten Masse abtut. Egal, wie unwissenschaftlich oder unlogisch es aussieht, es ist das Ergebnis der Bemühungen der damaligen Menschen um Rationalisierung unerklärlicher Sachverhalte, mit denen sie sich konfrontiert sahen ... Du da, was bedeutet Rationalisierung?«
Amano, der plötzlich einen Finger auf sich gerichtet sah, war völlig verwirrt.
»Keine Antwort. Gut, der nächste ...« »Ah...« antwortete Murasakino. »Gut, der nächste.«
»Der Drang, Sachen effizienter und sparsamer zu machen.« »Nein.Ich will wissen, was es in dem erwähnten Zusammenhang bedeutet. Der nächste bitte. »Ich passe«, sagte Nabeta.
»Der nächste.«
»Keine Ahnung, sagte Doigaku.
Nachdem Gotoda sich vergewissert hatte, dass alle kapituliert hatten, verfiel er in sein eigentümliches, hämisches Lachen. Scheinbar konnte er sich vor lauter Freude nicht mehr beherrschen.
»Für Politaktivisten ist das ja keine Meisterleistung. Karl Marx würde sich im Grab umdrehen.«
»Wir sind keine Marxisten!« fuhr Murasakino Gotoda an. »Was seid ihr dann?«
»Wir sind...«
»Wir sind Radikale! Passt dir was nicht?« ergänzte Rei anstelle von Murasakino und sah Gotoda dabei direkt in die Augen. »Ich frag mich eher, ob du wirklich von der Kripo bist!« »Darf denn ein Kriminalbeamter nichts über Soziologie erzählen? Es ist euer Vorurteil zu glauben, dass die Polizei eine Ansammlung einfältiger Sportlertypen ist. Und gerade hab ich euch erzählt, was solche Vorurteile hervorbringen: Geschichten voller Irrtümer und Fehler! Denkt mal drüber nach!«
»Danke für die Mühe. Aber was war jetzt mit den Toten und den Leichen?« fauchte Murasakino, dessen Geduld offenbar erschöpft war.
»Brülle nicht so rum, du Idiot! Oder willst du, dass mal wieder der Alte mit dem großen Fleischermesser zu uns kommt?!« »Dann kriegen wir Hausverbot!«
»Du redest jetzt weiter, oder unsere Zusammenarbeit ist beendet!« sagte Murasakino mit unterdrückter Wut.
»Also... Rationalisierung bedeutet hier, dass ein bestimmtes Phänomen so erklärt wird, dass es der eigenen, bestehenden Weltanschauung nicht widerspricht und es in das eigene Weltbild integriert werden kann. Für die Menschen der Vergangenheit, die keine wissenschaftlichen Kenntnisse besaßen, gab es außerhalb der immer weiter verwesenden Toten selbst keinerlei Grundlage, um den unerklärlichen und furchteinflößenden Tod erklären zu können. Soweit könnt ihr mir folgen.«
»Und weiter?« drängte Murasakino.
Es gab allerlei merkwürdige Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwesung und der Toten. Damit meine ich etwa, dass das Gesicht des Toten anschwoll; dass sein Bauch sich aufblähte; dass aus seinem Mund Blut floss; dass der Tote seine Position im Sarg veränderte; dass Fleisch abfiel und der Knochen entblößt wurde; dass sich Gas bildete unter dessen Druck ein Fötus aus der Gebärmutter gepresst wurde ... All diese Vorgänge am Toten werden durch die Zersetzungsarbeit von Mikroorganismen oder Aasfresser wie große Fleischfresser oder Insekten verursacht. Aber natürlich konnten die Menschen keine Mikroorganismen sehen, und über das Fressverhalten der Aasfresser wussten sie so gut wie nichts. Es war nämlich weder einfach noch ungefährlich, diese Tiere beim Fressen zu beobachten. Für diese Menschen gab es keinerlei funktionellen Unterschied zwischen nicht sichtbar sein und nicht existent sein. Wenn folglich ein Leichnam, den die Menschen aus irgendeinem Grund zu Gesicht bekamen, als Folge von Verwesung und Beschädigung wie ein Gespenst aussah, das einem die Haare zu Berge stehen ließ, dann dachten sie, dass sich der Tote durch Einwirkung von jemanden anderen oder aus eigenem Willen in ein Gespenst verwandelt habe. Dummerweise ist es zwar nicht in allen, aber in vielen Kulturkreisen so, dass die Toten aus ihren Gräbern kommen. Und zwar ganz ohne die Hilfe irgendeines Dämons, einfach nur aufgrund der Naturgesetze und das gar nicht mal so selten ...«
Gotoda befeuchtete sich die Kehle mit einem Schluck Bier und fuhr dann fort.
»Am häufigsten und zugleich massivsten wird das Erscheinen von Toten durch Überschwemmungen ausgelöst. Geht man von der damaligen Verhältnissen aus die Technik war allgemein rückständig und nennenswerte Anlagen zur Flussregulierung gab es wenn überhaupt nur in der Nähe großer Städte - dann war es gar nicht selten, dass Friedhöfe überschwemmt wurden. Da sowohl ein Sarg als auch ein Leichnam selbst Auftriebskräfte entwickeln, konnten sie im Fall einer Überflutung die völlig durchweichte Erde beiseite drücken und an die Wasseroberfläche aufsteigen. Nachdem das Wasser wieder abgeflossen war, zeigten die Toten dann überall ihre grässliche Gestalt. Auch wurde die Erde, welche die Gräber bedeckte, schnell ein Raub der Erosionskräfte von Wind, Regen und Sonne. Unabhängig davon, ob es Särge gab oder nicht, wurden viele Friedhöfe von Aasfressern heimgesucht, die den Boden nach Essbarem durchwühlten. Aber nicht nur die schädlichen Einflüsse der Natur, sondern auch menschliches Handeln führte dazu, dass Leichen an der Erdoberfläche erschienen. Sie wurden etwa von Grabräubern ausgegraben, die es auf Grabbeigaben oder Leichenteile für magische Zwecke abgesehen hatten. Oder dumme Totengräber gruben versehentlich Leichen aus, weil sie vergessen hatten, wo die unbenutzten Teile des Friedhofs waren. Oder sie wurden aus religiösen Gründen ausgegraben, etwa weil man Ketzer und Selbstmörder aus geweihter Erde vertreiben wollte. Oder ..«
»Schon gut«, sagte Nabeta etwas verzagt. »Das ist soweit klar, jetzt mach schon weiter ... «
»Es gibt aber noch viel mehr Gründe«, sagte Gotoda sichtlich unzufrieden und streckte die Hand nach seiner Packung Echo aus. Sie war leer.
»Hast du Zigaretten?« bettelte er Rei an. »Nein, ich rauche nie außer Haus.«
»Wieso denn, Mann?!« Gotoda, der auf eine Long Peace gehofft hatte, sprach diesen für einen Kriminalbeamten ziemlich unpassenden Satz und blickte dann in die Runde.
»Wenn dir eine Highlight genügt ... «
Gotoda lehnte mit einer leichten Handbewegung Nabetas Angebot ab und wandte sich statt dessen an Doigaku.
»Du da, mit dem Bibimba, du rauchst doch Short Hope, hab ich recht?«
Doigaku warf ihm die Schachtel zu, Gotoda fing sie auf und entnahm behende eine Zigarette. Dann steckte er die Schachtel ein, ohne sich im geringsten um die eisigen Blicke aus der ganzen Runde zu kümmern und zündete sich seine Zigarette an. Sichtlich genussvoll atmete er den Rauch aus und begann dann zu sprechen:
»Wo waren wir stehengeblieben?«
»Die schriftlosen Gesellschaften vor der Industrialisierung. Die Menschen damals besaßen nichts außer den verwesenden Toten selbst, um das unbegreifliche Phänomen Tod zu erklären. Und die Leichen sind regelmäßig aus den Gräbern herausgekommen und wie Gespenster vor den Leuten erschienen. Bis dahin sind wir gekommen.« Murasakino zeigte eine für seine Verhältnisse ungewöhnliche Geduld, als er den Stand der Dinge noch einmal zusammenfasste. »Aber das sind doch alles Geschichten von anno dazumal. Mir ist immer noch nicht klar, was das mit der Ausrichtung unserer Ermittlungen zu tun haben soll.«
»Ich denke, ich hatte gesagt, dass das noch gar nicht so lange her ist«, sagte Gotoda beschwichtigend und nahm noch einen Zug. »Außerdem... Selbst dem modernen Menschen ist es nicht wirklich gelungen, die Idee des Todes abschließend zu erklären. Nur der Mensch fürchtet den Tod und sein Symbol, die Leichen. Eine bedeutende Persönlichkeit geht sogar so weit zu sagen, dass es uns unmöglich ist, uns einen Begriff von unserer eigenen Nichtexistenz zu machen.«
»Wer soll das sein?« fragte Amano.
»Ich hab's vergessen«, antwortete Gotoda. »Ich hab's vergessen... Aber wenn man die Psyche eines Menschen betrachtet, der mit einer Leiche konfrontiert wird, dann unterscheiden wir moderne Menschen uns da nicht allzu sehr von früheren Menschen, die in einer Welt voller Unwissenheit und Aberglauben lebten. Es kommt nämlich so gut wie nie vor, dass der Mensch sich wahrhaft vernünftig verhält. Besonders am Ort eines Verbrechens. Aber das soll hier genügen... Ich komme zum Thema zurück.«
»Da bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, dass wir nicht fertig werden, bevor der Laden hier dichtmacht.« Gotoda übersah Doigakus ironische Bemerkung und setzte seinen Bericht fort.
»So kam es, dass die Menschen, wenn sie denn nichts besseres zu tun hatten, den Kampf gegen Leichen aufnahmen, die aus ihren Gräber kommen wollten. Worauf wir hier achten sollten ist, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen der allgemeinen Beseitigung von Toten, also der Bestattung, und der Beseitigung von Toten bei Verbrechen, also zum Zwecke der Vernichtung von Beweismitteln, gibt.«
»Bei einer allgemeinen Bestattung ist das Hauptprinzip, die Entstellung der Leiche und die Rückkehr des Toten zu verhindern. Bei einem Verbrechen geht es hingegen darum, die Leiche für möglichst lange Zeit verschwinden zu lassen oder besser ganz zu vernichten«, antwortete Rei ohne zu zögern. Nach dem Verlauf von Gotodas Vortrag hatte er eine ungefähre Vorstellung davon, worauf dieser hinauswollte.
»He, was ist denn mit dir los? Haben dir die Nudeln etwa den Kopf frei gespült?«
»Ich will bloß, dass wir schneller fertig werden.« Rei antwortete Gotoda, der vor Freude bis in die Augenwinkel lächelte, mit einer entschieden unfreundlichen Miene und einem ebensolchem Ton.
»Hört mal, ich habe mir vorhin auch euer endloses Geschwätz anhören müssen. Von daher würde ich es begrüßen, wenn ihr mir still und aufmerksam zuhören könntet ... Aber wie ihr meint, dann werde ich das Tempo etwas anziehen. Also, was sind die notwendigen Anforderungen bei der Auswahl einer Bestattungsmethode?«
Die gesamte Runde reagierte mit eifrigem Fingerschnalzen. »Die Methode muss schnell und billig sein.«
»Mit möglichst kleinem Aufwand müssen möglichst viele
beseitigt werden können.« »Sie muss sauber sein.«
»Sie muss zuverlässig sein.«
»Die Methode muss so ordentlich sein, dass sie keine sozialen Ängste schürt.«
»Es darf nicht stinken.« »Es muss unauffällig sein.«
»Am besten so, dass man es nicht selbst machen muss.« »Gut. Ich werde das Ganze mal zusammenfassen und nach Wichtigkeit ordnen. Erstens, die Beseitigung selbst muss schnell erfolgen, bevor die Leiche aktiv wird; zweitens, der Tote muss schnellstmöglich handlungsunfähig gemacht werden; drittens, es muss unter minimalem Kontakt mit der Leiche möglich sein; im Falle eines Verbrechens ändert sich im Prinzip nichts an dieser Reihenfolge, nur dass es bei Punkt Eins auf jede Sekunde ankommt, weil es für den Täter eine Frage von Leben oder Tod ist; bei Punkt zwei kommt es darauf an, die Ermittlungen zu behindern und die Methode zu verschleiern; bei Punkt drei besteht ein direkter Zusammenhang mit der Vernichtung von Beweisen. Ist das soweit klar?«
»Keine Einwände.«
»Als nächstes geht es um die Zielsetzungen, die zu erreichen sind. Unabhängig davon, ob es um ein Verbrechen oder eine reguläre Bestattung geht, gibt es sehr vielfältige Ziele bei der Beseitigung einer Leiche. Gewöhnlich zählt dazu aber mindestens eines der beiden folgenden. Erstens, die Leiche muss an einem bestimmten Ort fixiert werden, um voraussehbare Gefahren zu verhindern. Das wäre das Auftauchen der Leiche mit dem einhergehenden Verbreiten von Angst und Schrecken beziehungsweise im Falle eines Verbrechens die Entdeckung der Leiche. Zweitens, die Leiche muss handlungsunfähig gemacht werden. In beiden Fällen erwartet man, dass die Leiche am Ende in einen Gleichgewichtszustand kommt, das heißt die letzte, unveränderliche Stufe ihres Wandlungsprozesses erreicht. Das wären idealerweise die Asche oder die Knochen des Toten, aber im Falle allgemeiner Bestattungen erfüllt eine Mumifizierung oder eine Feuerbestattung denselben Zweck.«
Gotoda klatschte in die Hände und fuhr mit frischem Elan fort: »Also los, machen wir einen Versuch! Zählen wir die repräsentativsten Verfahren zur Beseitigung einer Leiche auf! Stellt euch vor, ihr wärt ein Bauer, der sich ständig vor den Schatten des Todes fürchtet. Oder ein Mörder.«
»Begraben.« »Verbrennen.«
»Beschweren und versenken.« »In Schwefelsäure auflösen.« »Einbetonieren.«
»Den Vögeln verfüttern.« »Krokodilen verfüttern.« »Hunden verfüttern.«
»Jemandem heimlich zu essen geben.« »Selbst essen.«
Nachdem alle Nudeln, Bibimba und Reissuppen vertilgt worden waren, wurden Häppchen von Rippenfleisch und Roastbeef in großer Menge auf den Grillrost gelegt, und die offenbar mit einem gesunden Appetit gesegnete Runde redete kreuz und quer durcheinander.
»Mir scheint, es fällt euch leichter, euch in die Lage des ruchlosen Mörders hineinzuversetzen als in die des tugendhaften Bauern ... Wie dem auch sei. Ich werde eure Vorschläge jetzt Punkt für Punkt durchgehen, sagte Gotoda, während er sich erneut eine der Short Hopes anzündete, die er Doigaku abgeluchst hatte.
»Beginnen wir mit der Erdbestattung. Von ihr können wir erwarten, dass sie den Toten an einem Ort fixiert, ihn verbirgt und mittels der im Erdreich vorhandenen Bakterien und Insekten zersetzt. Damit wären beide vorhin genannten Zielsetzungen gleichzeitig erfüllt. Da die Arbeit des Vergrabens zudem keine besondere Erfahrung erfordert, sieht die Erdbestattung auf den ersten Blick wie eine ideale Lösung aus. Tatsächlich ist sie, sowohl was allgemeine Bestattungsmethoden als auch was die Beseitigung von Mordopfern betrifft, die beliebteste Form der Leichenbeseitigung. In Wirklichkeit ist es allerdings gar nicht so einfach, einen Leichnam in ein Skelett zu verwandeln. Allgemein gesagt entspricht es der menschlichen Natur, die Toten an einem Ort zu bestatten, der möglichst weit entfernt von den Behausungen der Lebenden ist. Das gilt um so mehr für einen Mordfall, wenn der Täter aus Furcht vor Entdeckung einen möglichst unbelebten Ort wählen wird. Wenn man einen solchen Ort definieren würde, wäre es ein Ort, der sich nicht zum Wohnen eignet, etwa im Gebirge, einer engen Schlucht oder einem Sumpfgebiet. Nun gibt es aber eine Erfahrungsregel, die besagt, dass ein Ort, der sich nicht zum Wohnen eignet, sich auch nicht zum Zurücklassen einer Leiche eignet. Ein Leichnam ist ein verdammt schweres und sperriges Ding, unabhängig davon, ob seine Zersetzung schon begonnen hat oder nicht. Bevor Autos allgemeine Verbreitung fanden, erforderte der Transport einer Leiche schwere körperliche Arbeit. Aber selbst wenn der mühsame Transport gelingt, sind Berge und Schluchten oft felsig und besitzen nur eine dünne Erdschicht, was eine Beerdigung stark erschwert. Außerdem fehlt es hier an Mikroorganismen, die für die Zersetzung der Leiche notwendig sind. Ein Erdreich wie hier bei uns in Japan, das hinsichtlich Wassergehalt, Temperatur, Mikroorganismen und Insekten so beschaffen ist, dass eine Verwesung und vollständige Skelettierung möglich ist, dürfte weltweit betrachtet eher die Ausnahme als die Regel sein. In Sümpfen und Feuchtgebieten ist das Erdreich zwar tief genug für das Vergraben eines Toten, aber der Grundwasserspiegel ist sehr hoch, was es beinahe unmöglich macht, ein Loch zu graben, das tief genug ist und nicht mit Wasser vollläuft. Wer das ignoriert und trotzdem eine Leiche an so einem Ort begräbt, muss damit rechnen, dass die Auftriebskräfte der verwesenden Leiche bei Überschwemmungen oder Starkregen dafür sorgen, dass sie mit Leichtigkeit wieder zum Vorschein kommt. In stark alkalischen Böden ist zudem die Gefahr einer Saponifikation gegeben.«
»Was ist denn Saponifikation?«
»Das ist ein Vorgang, bei dem das in der Leiche enthaltene Fett mit dem Natrium im Erdreich eine chemische Reaktion eingeht und sich Leichenwachs bildet, wenn ich mich recht erinnere. Mit anderen Worten, es ist eine Art...«
»... menschliche Seife«, ergänzte Nabeta.
»Jedenfalls ist es ziemlich schwierig einen einsamen und abgelegenen Ort zu finden, an dem die Erde reich an Mikroorganismen und Insekten ist, und an dem man tief genug graben kann, um die Leiche vor der Freilegung durch Aasfresser zu schützen. Und das ist noch nicht alles. Ein Grab auszuheben kann jeder sprichwörtliche Idiot, aber trotzdem ist dafür intensive und harte körperliche Arbeit erforderlich. In Zeiten von Seuchen, an Kriegsschauplätzen oder Orten von Massakern ist die Zahl der Toten, die man entsorgen kann, begrenzt. Unter diesen Blickwinkeln betrachtet ist die Erdbestattung, sowohl was die allgemeine Bestattung als auch was die Beseitigung von Mordopfern betrifft, denkbar weit von einer Ideallösung entfernt. Und genau das ist der Grund, wieso Tote immer wieder aus ihren Gräbern gekommen sind und wieso fast alle Morde und Massaker entdeckt werden. Falls ihr keine Fragen habt, komme ich zum nächsten Punkt.«
Niemand sagte ein Wort.
»Die Feuerbestattung erlaubt es, den Toten in Asche, eine vollkommen inaktive anorganische Substanz, zu verwandeln. Man könnte das Verbrennen daher als ultimative Methode zur Leichenbeseitigung bezeichnen. In Kulturen, welche die Feuerbestattung verwenden, existieren keine Totengeister, die fleischliche Körper besitzen beziehungsweise diese Kulturen verwenden die Feuerbestattung, um zu verhindern, dass gerade solche Totengeister entstehen. Es gibt Wissenschaftler, die glauben, dass die Sitte der Feuerbestattung in ihren Anfängen eine Art Präventivschlag gegen Totengeister sein sollte, und ihre Wirkung ist ja in der Tat drastisch. Aber ähnlich wie die Erdbestattung ist auch bei der Feuerbestattung nicht alles perfekt ... He, pass doch mal auf! Die Flamme ist zu stark, das Fleisch verkohlt ja schon!«
Schnell drehte Murasakino, der für das Grillen zuständig war, die Flamme kleiner. Vielleicht weil sie eine ungute Vorahnung des Kommenden beschlich, stopften Nabeta und Doigaku sich hastig den Mund mit angekohltem Fleisch voll, aber Amano verteilte auf dem frei gewordenen Platz auf dem Grillrost gleich wieder große Mengen an rohem Fleisch.
»Untersuchen wir einmal anhand eines durchschnittlichen Erwachsenen, wie schwierig es ist und welche Massen an Energie benötigt werden, um einen einzigen Menschen mit seinem hohen Wassergehalt zu verbrennen. Laut einer Quelle benötigt man für die vollständige Verbrennung einer Leiche von 70 Kilogramm Gewicht zu Asche in einem speziellen Einascherungsofen mit Hochtemperatur-Gasumlaufeinheit bei einer Temperatur von 870 Grad Celsius circa 45 bis 60 Minuten. Im Falle älterer Öfen ohne regelbaren Luftstrom und mit hohem Brennstoffverbrauch benötigt man gut 90 Minuten und etwa 700 Kilogramm Koks oder ca. 500 Kubikmeter Gas. Bei einem elektronischen Einäscherungsofen werden etwa 24 Gallonen Schweröl benötigt, um den Ofen auf Betriebstemperatur zu bringen ... 700 Kilogramm Koks, das ist etwas mehr, als alle Öfen einer Grundschule am Tag verbrauchen. Na? Überrascht?«
»Allerdings«, stimmte Amano erstaunt zu.
»Wenn kein spezieller Einäscherungsofen vorhanden ist, zum Beispiel wenn man einen Scheiterhaufen verwendet, wie das ja in Filmen oft zu sehen ist, benötigte man laut einer Quelle in einem Fall ungefähr 21 Kubikmeter Holz und einen ganzen Tag Zeit, um einen zum Tode Verurteilten vollständig zu verbrennen. Eine andere Quelle berichtet von einem Fall, in dem 217 Holzscheite notwendig waren. In Wirklichkeit wurden als Brandbeschleuniger zusätzlich tierische Fette, etwa reine Butter, und später auch Pech und Erdöl verwendet. Schließlich konnten die Menschen damals im Gegensatz zu einem Mörder heute nicht einfach nach Belieben Benzin verwenden. Aber selbst mit Benzin erhält man wenig mehr als einen verkohlten Körper, wenn man die Leiche nicht längere Zeit und sehr sorgfältig verbrennt. Das Problem ist nicht nur ein Feuer zu erzeugen, das heiß genug ist, sondern diese hohen Temperaturen auf den Leichnam zu übertragen und diesen Zustand bis zum vollständigen Verbrennen aufrechtzuerhalten. Für eine Verbrennung ist ein ununterbrochener Zufluss von Sauerstoff unerlässlich. Wenn man einen Toten einfach auf den Boden legt, mit Benzin überschüttet und dann anzündet, wird die Unterseite der Leiche, die Kontakt mit dem Boden hat, nicht verbrennen. Man erhält dann eine Leiche in halb rohem und halb verkohltem Zustand.«
Auf dem Grillrost verspritzte das Rippenfleisch jetzt jede Menge Fett und heftiger Qualm stieg auf. Murasakino griff ein und wendete sorgfältig ein Fleischhäppchen nach dem anderen.
»Ihr seht, mit einer Leiche ist es genauso wie mit dem Rippenfleisch. Der Körper muss im richtigen Abstand zur Hitze der Flammen gehalten und regelmäßig gewendet werden, um gleichmäßig zu verbrennen. Im Falle eines Mordes sind dafür eigentlich nur großformatige Müllverbrennungsöfen oder Brennöfen für Keramik geeignet. Aber dort ist das Risiko, dass man dem Mörder auf die Spur kommt, extrem hoch. Und das ist nicht das einzige Problem ... Wie muss sich jemand fühlen, der über Stunden eine Leiche wie ein bratendes Tier im Feuer dreht? Wenn man solche menschlichen Faktoren mit einbezieht, werden die Grenzen der Beseitigung eines Leichnams oder eines Mordopfers mittels Verbrennen deutlich sichtbar. Es kostet Zeit, Geld und Nerven. Wenn man einmal von den abgestumpftesten Mördern absieht, waren es deshalb stets die Reichen und Mächtigen, die es sich leisten konnten, ihre Toten einzuäschern, weil sie diese unangenehme Arbeit nicht selbst besorgen mussten, sondern andere dazu zwingen konnten. So gab es die Feuerbestattung im alten Rom ausschließlich beim Adel, in Indien war sie die erbliche Aufgabe einer Kaste namens Dom, während die Armen selbst ihre Toten den Ganges hinuntertreiben ließen. Zudem ist die Verbrennung ähnlich wie die Erdbestattung völlig ungeeignet, in Notsituationen größere Mengen von Leichen zu beseitigen. In Seuchenzeiten, wenn es an arbeitsfähigen Menschen mangelte, oder im Krieg, wo das eigene überleben an erster Stelle stand, war keine Zeit, um eine riesige Anzahl an Gräbern auszuheben oder ein mächtiges Feuer zu machen. Der riesige Energiebedarf des Einäscherns und die psychologischen Probleme beim Umgang mit Leichen überstiegen die Leistungsfähigkeit bei der Beseitigung von Toten in diesen Kulturen. Als Ergebnis dieser Schwierigkeiten entstand eine neue Form der Bestattung, und zwar ..• »Das Massengrab«, murmelte Rei.
»Man gräbt eine riesige Grube, wirft von einem Ende zum anderen die Leichen hinein und bestreut sie mit Kalk. Wenn das Grab voll ist, bedeckt man es mit Erde. Es ist dieselbe Methode, wie sie auch die Nazis in ihren Konzentrationslagern angewandt haben oder die sowjetische Armee nach der Ermordung der polnischen Offiziere im Wald von Katyn.«
»Wo wir beim Thema sind, Mozart, der an einer Infektionskrankheit starb, wurde ebenfalls in eine solche Grube, also ein Massengrab, geworfen. Immer wenn es eine große Zahl von Toten gibt, entdecken die Menschen das Massengrab als einzig taugliches Mittel. Und so kommt es, dass diese Toten an die Oberfläche zurückkehren und uns von Morden oder Kriegsverbrechen berichten.«
Auf dem Grill lag noch ein Berg von Fleischhäppchen, den unter diesen Umständen niemand anrühren wollte. Murasakino begann jetzt damit, das Fleisch, das er gebraten hatte, in der Runde zu verteilen. Halb aus Trotz nahm Rei einen Happen zwischen die Zähne, aber dem zu stark gebratenen Fleisch mangelte es an Saft und Fett, so dass er das Gefühl hatte, auf ein Stück Pappe mit Soße zu beißen. Alle kauten schweigend vor sich hin.
»Das Zweifeln am Fleischverzehr hat Zweifel an der menschlichen Natur hervorgebracht. Kriege und Morde sind die Strafe für den Fleischgenuss«, sagte Gotoda mit einem hämischen Grinsen.
»Wer sagt denn so was?« fragte Rei.
»Jedenfalls nicht der Alte vom Yakiniku-Laden.«
»He, wieso isst du eigentlich nicht mit?« fragte Murasakino gehässig.
»Weil ich aus ethischen Gründen Vegetarier bin. Hatte ich das nicht erwähnt?« antwortete Gotoda ungerührt und stopfte sich noch einen Happen vom Beilagenteller in den Mund.»Na ja, esst nur schön weiter, während ihr mir zuhört. Kommen wir zur Wasserbestattung. Nichts ist schneller und einfacher, als einen Toten in einen Fluss oder ins Meer zu werfen, und da der Kontakt mit dem Leichnam auf ein Mindestmaß beschränkt wird, ist diese Form der Bestattung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten höchst effizient. Allerdings verläuft die Verwesung im Wasser im Vergleich zum Erdreich langsamer ab, und besonders im Fall von Fließgewässern sollte man auf die Effektivität der dortigen Aasfresser wie Fische oder Schalentiere nicht allzu viel Hoffnung setzen. Hinzu kommen die starken Auftriebskräfte der Leiche, so dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass der Tote an einem nicht vorhersehbaren Punkt irgendwo flussabwärts plötzlich auf dem Wasser treibt und einen nicht sehr erbaulichen Anblick bietet. Wenn man dieses Wiederauftauchen verhindern will ... «
»...kann man ihn mit einem Gewicht versenken!« »Man verpasst ihm Betonfüße!«
»Gut. Aber um eine Leiche im Wasser zu fixieren, benötigt man, physikalisch ausgedrückt, ein Gewicht, dessen Masse der Auftriebskraft, also der Gewichtskraft der vom Volumen der Leiche verdrängten Wassermenge, entspricht.«
»Okay, das archimedische Prinzip kennen wir auch«, sagte Rei. »Genauer gesagt treibt die Leiche wie ein Luftschiff unter Wasser, wenn das Gewicht haargenau der Wassermenge entspricht. Also braucht man ein Gewicht, das sogar schwerer ist.«
»Hinzu kommen die Auftriebskräfte der Gase, die sich im Inneren der Leiche bilden. Jedenfalls ist etwas vom Kaliber einer Eisenhantel völlig nutzlos. Dadurch entsteht ein Arbeitsaufwand, der im Ergebnis die übrigen Vorteile der Methode wieder aufhebt. In den Aufzeichnungen von Dr. Terence Allen, ein forensischer Pathologe in Diensten der Gerichtsmedizin des Bezirks Los Angeles, findet sich der Fall einer Leiche, die an der Wasseroberfläche trieb, obwohl sie an einen 66 Kilogramm schweren Generatorkasten aus Eisen gefesselt war. Deshalb ist es gar nicht übertrieben zu sagen, dass es praktisch unmöglich ist, mit einer normalen Eisenhantel einen Toten dauerhaft zu versenken. Vom Standpunkt eines Mörders, der eine Leiche so verschwinden lassen will, betrachtet bedeutet dies, dass er einen Stein oder ein Stück Eisen transportieren und versenken muss, das so riesig ist, dass es noch auffälliger als die Leiche selbst ist, was die ganze Sache natürlich ad absurdum führt. Auch die euch allen aus dummen Mafia-Filmen vertraute Eisenkugel an der Kette ist vielleicht geeignet, einem Opfer Angst einzujagen, wirklich effektiv ist sie aber nicht. Und Betonfüße stehen ganz außer Frage.«
»Dumme Mafia-Killer kennen eben das archimedische Prinzip nicht«, merkte Nabeta an.
»Falsch. Dumme Mafia-Film-Regisseure kennen es nicht«, korrigierte ihn Gotoda.
»Also, weiter zum nächsten Punkt. Verfüttern an Vögel, Wölfe, Hyänen, Hunde, Krokodile und ähnliche Aasfresser, was nichts anderes bedeutet, als das Fleisch einer Leiche zu beseitigen. Um es kurz zu machen, diese Methode ist einfach nur ekelhaft. Luftbestattung mit Vögeln klingt ja irgendwie romantisch, aber wenn man Berichte von Augenzeugen hört, die so etwas mit eigenen Augen gesehen haben, muss es da schlimmer zugehen als in einem Schlachthaus. Es muss wirklich grauenhaft sein.Weil der Tote schnell gefressen werden muss, bevor er verwest, wird der Körper mit Hilfe eines Beils in Stücke gehauen. Dann wird das Fleisch von den Knochen geschabt und schließlich klein geschnitten. Das Ganze ist so ekelhaft, dass sich in Indien tatsächlich eine Kaste gebildet hat, die das berufsmäßig betreibt und der man den Auftrag dazu erteilen muss, was natürlich die Kosten in die Höhe treibt. Da bei dieser Methode eine Menge Knochen mit Spuren von Gewalteinwirkung zurückbleiben, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Archäologen und Anthropologen das Ganze als Produkte von Kannibalismus deuten. Im Falle von Wölfen, Hyänen oder Krokodilen wäre anzumerken, dass diese nicht einfach überall verfügbar sind, so dass sich diese Methode allgemein schwer umsetzen lässt. Hunde gibt es überall, aber einem Haustier wie dem Hund einen toten Menschen zu verfüttern, wirft ethische Probleme auf. Es könnte zum Beispiel zu dem wenig erbaulichen Ergebnis führen, dass sich der Hund mit einem Menschen Knochen im Maul in der Nähe menschlicher Behausungen herumtreibt. Im Falle eines Verbrechens wird diese Möglichkeit wohl nur Leuten offenstehen, die zu Hause einen Löwen halten oder im Pool einen weißen Hai.«
»Die Welt von Phantom.«
Ja, genau wie bei James Bond...«
»Zum Schluss kommen wir zu der Idee, die Leiche einen Menschen zu essen zu geben. In fast allen Kulturkreisen der Welt existiert ein psychischer Widerstand gegenüber kannibalischen Handlungen, der noch stärker ausgeprägt ist als das Ekelgefühl gegenüber Leichen. Hinsichtlich der Eignung als Methode zur Beseitigung von Leichen lohnt er deshalb keine weitere Untersuchung. In der Kriminalgeschichte gibt es durch aus Fälle, in denen Leichenteile gegessen, zu Wurst verarbeitet, oder anderen Personen als Leber heimlich zum Essen gegeben wurde. Einen Fall, in dem eine Leiche zum Zweck der Beweisvernichtung komplett aufgegessen wurde, gibt es indes nicht. Wenn man sich schließlich klarmacht, dass der Akt des Fleischverzehrs dem Menschen nicht nur emotionale Probleme bereitet, sondern auch ein ideologisches Thema darstellt, wird ganz von selbst klar, wie schwierig so etwas wäre.Genau, wie wenn man die Masse Roastbeef und Rippenfleisch sieht, die hier am Tisch übriggeblieben ist.«
Als Gotoda zu dieser provozierenden Schlussfolgerung kam, wuchtete der von rebellischem Geist erfüllte Murasakino mit einer entschlossenen Handbewegung noch einmal eine große Menge Fleisch auf den Grillrost.Wieder stieg eine große Menge Rauch auf, und alle außer Murasakino sahen sich mit einem völlig übersättigten Gesichtsausdruck an.
»Als Methoden zur Leichenbeseitigung blieben damit noch die Mumifizierung mit chemischen Mitteln, Austrocknung mittels heißem Sand, heißer Luft oder Feuer sowie die Leichenverwachsung unter Ausnutzung spezieller natürlicher Umgebungsbedingungen wie in Höhlen und ähnlichem. Diese Methoden erreichen zwar die endgültige Fixierung einer Leiche, dienen aber nicht ihrer Beseitigung, sondern erfolgen vielmehr in der Absicht ihrer Erhaltung und Konservierung, weshalb ich mir hier eine Überprüfung im Detail erspare ... Hoppla... Wo wir es von chemischen Mitteln haben, es gab ja noch den Vorschlag, die Leiche in Schwefelsäure aufzulösen.«
Ein kurzes Zittern ging durch Amanos Schultern.
»Das war doch dein Vorschlag. Sehen wir mal von irgendwelchen Horrorfilmen ab, braucht man für diese Methode eine große Menge an Chemikalien, weshalb die Polizei einem leicht auf die Spur kommen kann. Außerdem verschwindet die Leiche nicht, sondern wird lediglich in breiartige Flüssigkeit verwandelt. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Brei einen grauenhaften Gestank verbreitet und im übrigen schwieriger zu handhaben ist als die Leiche selbst, weshalb ich in dieser Methode kaum einen Vorteil erkennen kann ... Nun, ich könnte noch eine Weile weiterreden, aber ich denke, wir belassen es mal bei dem Gesagten.«
An Reis Seite entfuhr Nabeta ein Seufzer. Auch Amano und Doigaku zeigten erleichterte Mienen.
»Ich denke, wir haben eure Kenntnisse ausreichend vertieft Ihr wisst jetzt, wie schwierig und mühsam die Handhabung und Beseitigung von Leichen ist, ihr habt vom Kampf des Menschen mit den Toten gehört, und ihr besitzt eine Ahnung, welche Probleme einen Mörder erwarten, der eine Leiche beseitigen will. Deshalb würde ich jetzt gerne einmal unseren Fall unter dem Gesichtspunkt der Leichenbeseitigung prüfen. Beginnen wir mit dem Mord, den du beobachtet hast ...« Als er das sagte, warf Gotoda einen Blick auf Rei und fuhr dann fort.
»Offensichtlich sind das Mädchen namens Saya und die beiden Ausländer Komplizen. Einer der beiden Ausländer hat eine Leiche in einem großen Sack mit Gummiüberzug verstaut, ohne sich weiter um dich, den Augenzeugen, zu kümmern. Ist das soweit korrekt?«
»Das Material konnte ich nicht genau erkennen, es war so dunkel...«
»Vermutlich hat es sich dabei um einen speziellen Leichensack gehandelt, wie ihn die US-Armee im Krieg in Vietnam einsetzt. So ein Ding wird nicht gerade an jeder Ecke verkauft. Die Aussage, dass das Mädchen als augenscheinliche Täterin die Klinge auf Scharten untersucht hat und das Verhalten des zweiten Mannes nach Art eines Anführers machen es schwer denkbar, dass es sich bei diesem Mord um einen persönlichen Racheakt gehandelt hat. Offensichtlich waren hier Profis am Werk.«
»Killer also...«
»Mit Profis meine ich nicht unbedingt Kriminelle, die ihren Lebensunterhalt mit dem Töten von Menschen verdienen. Ein Schwert als Tatwerkzeug und die Schuluniform des Mädchens scheinen nicht in das Bild zu passen, aber wir haben eine offenbar hochtalentierte Täterin, einen Mann, der mit Geschick eine Leiche verstaut und einen Anführer, der Routine und Erfahrung ausstrahlt. Für mich riecht das alles nach einer illegalen Organisation.«
»Also doch der Mossad!« rief Amano. »Verdammt, halt deinen Mund!« rief Murasakino.
»Unter normalen Umständen führt man an so einem Ort keinen Mord aus, aber vielleicht wollten sie sich gerade das allgemeine Chaos und Durcheinander an diesem Tag zunutze machen. Vermutlich haben sie die Tat entsprechend vorbereitet. Aber wenn wir einmal annehmen, dass sie einer Organisation professioneller Killer angehören, dann kommt der Tatsache, dass sie die Leiche mitgenommen haben, aller größte Bedeutung zu. Bei einem politischen Mord, wenn es um eine Machtdemonstration geht, lässt man die Leiche normalerweise am Tatort zurück. Recht häufig kommt es sogar vor, dass sie an einem besonders auffällig Ort zurückgelassen wird. Das Mitnehmen einer Leiche birgt erhebliche Risiken, weshalb man davon ausgehen muss, dass es einen wichtigen Grund oder Zweck dafür gab.«
»Einen Grund, sie vor den Menschen zu verbergen?« murmelte Nabeta, und Rei senkte unwillkürlich den Kopf. Rei allein wusste den Grund, weshalb diese Leiche auf keinem Fall den Bücken der Menschen ausgesetzt werden sollte. Vielleicht war dies die letzte Gelegenheit für Rei, auszusprechen, was er wusste. Aber es war nicht nur die Wahrheit über diese Leiche, die Rei jetzt weiterhin schwanken ließen. Wieso sagte Gotoda der Runde nichts davon, dass das Blut vom Tatort, das sich auf Reis Kleidung fand, kein menschliches Blut gewesen war? Gotoda dachte offenbar nicht daran, irgend etwas anderes als das Wort »Mord« in den Mund zu nehmen. Es war diese Rätsel hafte Haltung, die Rei so zögerlich werden ließ.
»Ich finde, dafür dass die Kerle professionelle Killer sind, waren sie in manchen Dingen verdammt schlampig.« Doigakus Ton verriet, dass es ihm schwerfiel, Gotodas These zu akzeptieren. »Rei hat doch erzählt, dass am Tatort alles voller Blu1 war. Wenn sie die Leiche eingesackt haben, um ihr Verbrechen zu vertuschen, wieso haben sie ihr Opfer dann überhaupt auf diese Weise umgebracht?«
»Mit einem Schwert ... Da spritzt das Blut nur so, keine Frage«, nickte Nabeta zustimmend. »Was nutzt es, eine Leiche wegzuschaffen, wenn ich gleichzeitig einen Tatort voller Blut zurücklasse?«
»Stimmt. Profis würden Pistolen benutzen, mischte sich jetzt auch Amano freudig ein. »Mit 'nem Schalldämpfer, Pump, fump...«
»Ich habe keine Ahnung, weshalb sie so eine unzeitgemäße Waffe wie ein Schwert gewählt haben, aber den Tatort in Ordnung zu bringen, ist nicht so ein großes Problem. Ich habe schon erwähnt, dass sie die chaotische Situation an diesem Tag ausgenutzt haben könnten. Ich an ihrer Stelle hätte einen Molotowcocktail benutzt. Das kann zwar keine Leiche verbrennen, aber die Blutspuren auf dem Boden und an der Mauer überdeckt es allemal. In dieser Nacht gab es sowieso überall kleinere Brände.«
»Ja, natürlich«, stimmte Amano zu.
»Aber wieso haben sie dann Rei am Leben gelassen? Wieso haben sie ihn nicht auch einfach vor Ort niedergemacht?« Doigaku leistete immer noch tapfer Widerstand, aber Nabeta widersprach mit einem Anflug von Selbstironie:
»Nicht nötig. Seit wann glaubt die Polizei der Aussage eines radikalen Oberschülers? Noch dazu ohne Beweise...« »Verdammt, Rei, hattest du da etwa deinen Helm noch auf?!« fauchte Murasakino Rei dumpf an.
»Hattest du oder hattest du nicht?« klinkte sich auch Doigaku ein.
Rei, der bislang der Diskussion gefolgt war, ohne sich selbst zu äußern, sah sich plötzlich den Vorhaltungen seiner Kameraden ausgesetzt und wurde unruhig. Je nachdem, wie seine Antwort ausfiel, war es denkbar, dass sie die widersprüchlichen Teile seiner Aussage hervorzerren würden, und dann könnte es leicht dazu kommen, dass er die eine Tatsache, die er sogar Gotoda verschwiegen hatte, gestehen müsste. Aber es war ausgerechnet Gotoda, der Rei hier aus der Klemme half.
»Profikiller begehen niemals unnötige Morde, egal mit wem sie es zu tun haben. So etwas bringt nämlich im Ergebnis nur neue Risiken mit sich. Unbeteiligte mit in die Sache hineinzuziehen, ist sogar fast eine Art von Tabu... Trotzdem, Respekt, das war scharf beobachtet. So muss eine Diskussion laufen.«
Doigaku schnaubte offensichtlich unzufrieden: »He, von dir brauch ich kein Lob!«
»Allerdings ist am Verhalten dieser Kerle zweifellos einiges unnatürlich. Der junge Mann mit dem Bibimba hier hatte recht. Es ist schwer vorstellbar, dass sie beabsichtigten, ihre Tat zu vertuschen. Es ist also nach wie vor ein Rätsel, zu welchem Zweck sie die Leiche mitgenommen haben. Aber allein das zu wissen bedeutet bereits einen Fortschritt.«
Doigaku und Murasakino wirkten nicht völlig überzeugt, aber zumindest schien ihnen vorläufig die Lust an weiteren Angriffen auf Rei vergangen zu sein. Doch die Zweifel, die Rei gegenüber Gotoda hegte, hatten sich eher noch verstärkt Für Gotoda, der mit Vergnügen bis zum Überdruss logisch argumentierte, wirkten diese Überzeugungsversuche reich lieh erzwungen. Und auch die seltsame Lobhudelei für Doigaku passte irgendwie gar nicht zu dem ansonsten konsequent sarkastischen Gotoda. Rei konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man sich zwar der Wahrheit in diesem Fall schrittweise näherte, dass Gotoda aber immer dann, wenn man einem bestimmten Punkt zu nahe kam, die Diskussion geschickt in eine andere Richtung lenkte. Rei fragte sich, ob Gotoda nicht vielleicht sogar wusste, was Rei am Tatort gesehen hatte, und erschrak im gleichen Moment über diese Eingebung. Aber das konnte nicht sein. Es war absolut unwahrscheinlich, dass Gotoda es auch nur durch Zufall gesehen hatte. Voller Eifer verneinte Rei immer wieder die Möglichkeit, aber so sehr er sich auch mühte, es gelang ihm nicht, die in ihm heranwachsenden Zweifel zu unterdrücken.
Wenn Gotoda es schon zu dem Zeitpunkt wusste, als er Rei zu Hause aufgesucht hatte, wieso hatte er es dann gegenüber Rei nicht erwähnt? Mehr noch, wenn er davon wusste, als er Rei zur Zusammenarbeit aufgefordert hatte, dann konnte es eigentlich nicht sein, dass Gotoda bloß ein harmloser Kripobeamter war, der aus reinem Trotz seine Ermittlungen heimlich weiterführte.Wer war dieser Gotoda? Erneut warf Rei einen verstohlenen Blick auf diesen Mann vor ihm, der irgendwie an einen Hund erinnerte.
»Kommen wir als nächstes zu den drei Leichen der Serienmorde. Hier gibt es, abgesehen von den eigentümlichen Merkmalen der Tatausführung, hinsichtlich der Beseitigung eine wahre Flut von Elementen, die eine Untersuchung wert wären. Als Fundorte hätten wir einmal das Obergeschoss des eigenen Hauses, einmal ein leerstehendes Haus in der Nachbarschaft und einmal das Ufer unter einer Brücke am Tamagawa. Offenbar gibt es hier keinerlei Gemeinsamkeiten. Außer, dass man alle drei zurückgelassen hat.«
»Falls es nicht doch ... «
»Im Fall zwei war es das Obergeschoss im Zuhause des Opfers. Ein denkbar ungeeigneter Ort für ein Verbrechen. Wenn man an das Risiko denkt, dass da etwas schiefgeht, müssen die Mörder damit schon eine besondere Absicht verfolgt haben.«
»Gerade weil es so ein Ort ist, haben sie die Leiche zurückgelassen.«
»Und was ist dann mit der Leiche im dritten Fall? Auf dem Weg unter der Brücke ist schon früh morgens jede Menge Betrieb. Jogger, Leute, die ihre Hunde ausführen. Alle drei Opfer waren ordentlich gekleidet, und es gibt keine Spuren, die auf Widerstand schließen lassen. Eine Visitenkarte des Mörders haben wir nicht gerade gefunden, aber es ist durchaus möglich, dass die Leiche dorthin geschafft wurde, damit sie auch wirklich gefunden wird.«
»Aber was soll das Ziel sein? Ich meine die Absicht, von
der du redest?«
»Wahrscheinlich Abschreckung.« »Abschreckung? Wen vor was?«
»Könnte auch eine Art Kriegserklärung sein ... «
»Von mir aus! Aber von wem gegen wen?« Murasakino hatte begonnen zu schreien, und Gotoda mischte sich ein, wie um ihn zu besänftigen:
»Das Motiv spielt zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle. Entscheidend ist doch, dass der oder die Täter offenbar die Absicht hatten, die Leiche so zu entsorgen, dass sie auch gefunden wird. Das kann man aus den von Fall zu Fall wechselnden Fundorten schließen.«
»Ein leerstehendes Haus, in den eigenen vier Wänden und auf einem Spazierweg unter einer Brücke. Nur direkt vor einer Polizeiwache wäre die Wahrscheinlichkeit noch höher, entdeckt zu werden.«
»Ich hab's, es ist eine Kriegserklärung an die Polizei!« »Und wieso bringen sie dann ausgerechnet systemkritische Aktivisten um die Ecke? Ich sag's dir doch, du sollst nicht einfach drauflos quatschen!«
»Wenn sich die Methoden und die Ziele bei der Behandlung der Leichen so unterscheiden, dann sind es wohl zwei Tätergruppen mit unterschiedlichen Motiven, wie Rei vor hin schon gesagt hat.« Nabeta zog eine Art Fazit, aber wie der einmal mischte sich Gotoda ein:
»Es mögen zwei Tätergruppen sein, aber es sind drei Motive.«
Rei, der beharrlich geschwiegen hatte, warf Gotoda einen Blick zu, und der Rest der Runde tat es ihm gleich. Die überraschende Wendung ließ ihn unwillkürlich etwas sagen. »Ein Motiv dafür, eine Leiche fortzuschaffen und ihre Existenz zu vertuschen, und ein anderes dafür, die Leichen so zu hinterlassen, dass sie entdeckt werden. Was soll das dritte Motiv sein?«
»Das Motiv dafür, Leichen fortzuschaffen, um den ganzen Fall zu vertuschen. Der beste Beweis dafür ist die Tatsache, dass die Leichen noch nicht entdeckt worden sind.«
Jetzt sprach Gotoda in Rätseln.
»Wie, welche Leichen sind noch nicht entdeckt worden?! »Gab's etwa noch mehr Morde?!«
Endlich dämmerte es Rei, der in Gedanken versunken gewesen war, und er erschrak.
»Doch nicht etwa ...«
»Die Liste der Opfer bzw. möglichen zukünftigen Opfer, die wir aufgestellt hatten, umfasst sieben Mitglieder der SR Fraktion. Drei wurden als Leichen entdeckt, einer kommt noch in die Schule, als ob nichts wäre. Wohin sind die übrigen drei verschwunden?«
»Ich dachte, die drei wären schon vor den drei Morden verschwunden!«
»Die Zeiten der schriftlosen Gesellschaft sind lange vorbei. Nicht sichtbar sein und nicht existent sein sind für uns nicht das Gleiche.« Die Runde hielt den Atem an und verfolgte den Schlagabtausch zwischen Rei und Gotoda. Der letztere leerte den Rest Bier in seinem Glas mit einem Zug und fuhr dann fort: »Es gibt keine konkreten Beweise, aber ich wette mit euch um die Rechnung heute Abend ... die drei sind längst ermordet. Kein Zweifel.«
»Moment mal!« protestierte Murasakino.
»Hör mal gut zu, wir sind alle total pleite. Also lass deine schäbigen...«
»Banalitäten können wir nachher erörtern. Ich will wissen, woraus du schließt, dass die drei tot sein müssen!« fiel Rei Murasakino ins Wort und bedrängte Gotoda.
»Ganz einfach. Das ist eine Frage der Reihenfolge«, antworte Gotoda im Ton der Selbstverständlichkeit. »Wieso sollte jemand, der bereits drei Leichen so offensichtlich zurückgelassen hat, sich bei den übrigen eigens die Mühe machen, sie beiseite zu schaffen? Zumindest vorausgesetzt der oder die Täter, die hinter dieser Mordserie stehen, können vernünftig denken ... Und davon muss man ausgehen, wenn man sieht, wie die Morde ausgeführt und die Leichen platziert wurden und wenn man bedenkt, dass es in keinem der Fälle einen einzigen Zeugen gibt. Es ist also schwer vorstellbar, dass die Behandlung der Leichen rein zufällig war. Wer eine Serie von Morden begehen will, weiß, dass er vom Moment ihrer Entdeckung an von den Justizbehörden verfolgt wird. Um das zu vermeiden, wird er versuchen, die Leichen so lange wie möglich verborgen zu halten. Das gilt um so mehr, wenn die Opfer aus einem sehr eng umgrenzten Kreis stammen. Folglich kann es Fälle geben, in denen ein Täter anfangs seine Leichen beiseite schafft, später aber aus irgendeinem Grund dazu übergeht, sie gut sichtbar zurückzulassen. Aber den umgekehrten Fall gibt es nicht. Soweit einverstanden?
»Das sind jetzt aber alles Spekulationen von dir!«
»Ich sagte bereits, dass es keine konkreten Beweise gibt. »Also sagt dir das dein... Instinkt?«
»Von mir aus nennt es so ... Instinkt und Intuition sind doch nur andere Worte für Schlussfolgerungen, die durch induktives Denken unter Anwendung von Erfahrungen aus Fallbeispielen gezogen werden, wenn man keine Beweise hat. Also zieht es nicht ins Lächerliche. Außerdem haben wir jetzt keine Zeit, herumzulaufen und alles einzeln fein säuberlich mit Beweisen abzusichern.«
»Was soll das heißen, wir haben keine Zeit ... «
»Damit will ich sagen, dass auf unserer potentiellen Opfer liste keine große Auswahl mehr ist. Von sieben Personen sind sechs bereits verschwunden, einer ist übrig. Und das ist euer Kumpel Seiji Aoki.«
»Ich fasse das mal zusammen«, sagte Murasakino mit Nachdruck. »Die drei Verschwundenen sind bereits ermordet, und aufgrund irgendeiner Veränderung der Umstände wurden die Leichen der drei folgenden Opfer zurückgelassen. Das behauptet zumindest der Alte. Wenn wir jetzt zu unserem Leidwesen zu dem Urteil kommen, dass seine Äußerungen richtig und vernünftig sind, dann...«
»Ja, was dann?«, fragte Gotoda.
»Dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Veränderung der Umstände mit dem Auftauchen dieses Mädchens namens Saya und den beiden Ausländern zu tun hat. Auch der Fortgang der Dinge legt nahe, dass die zwei möglichen Täterkreise etwas miteinander zu tun haben müssen. Es ist unklar, welche Art von Feindschaft es zwischen den beiden Tätergruppen gibt, aber aufgrund der Beteiligung der Botschaft eines gewissen Landes lässt sich mutmaßen, dass es sich um eine internationale Verschwörung handelt, hinter der ein Staat oder eine staatliche Organisation steht.«
»Der Mossad, ich hab's doch gleich gesagt«, meldete sich Amano. Murasakinos Miene verriet, dass er jetzt an Wichtigeres zu denken hatte als daran,Amano den üblichen Rüffel zu verpassen, und er fuhr fort: »Nach wie vor mangelt es uns an gesicherten Informationen, aber auch hier müssen wir dem Alten wohl oder übel darin zustimmen, dass es sich mit Gewissheit um eine Angelegenheit von großer Dringlichkeit handelt. Ich schlage daher vor, dass wir Seiji Aoki vorladen und einem Verhör durch das Plenum unterziehen. Und zwar noch heute Abend.«
Alle Blicke erstarrten.
»Aber bloß keine Lynchjustiz!« Als Senior der Runde und Polizeibeamter fühlte Gotoda sich offenbar zu diesem Ratschlag verpflichtet, aber seine Augen verrieten, dass er Muraakinos Vorschlag durchaus interessant fand. »Sagt mal, soll ich auch teilnehmen?«
»Eine Teilnahme von Außenstehenden kommt nicht in Frage. Solange du dabei bist, würde Aoki sowieso kein Wort sagen.«
»Ob er auf die Vorladung reagiert?« fragte Nabeta.
»Selbst wenn er kommt, wer weiß, ob er überhaupt was sagt ... Der Idiot kommt immer noch jeden Tag in die Schule, als ob nichts dabei wäre«, sagte Doigaku.
»Wir müssen ihn irgendwie zum Reden bringen. Wie spielt in dieser Situation keine Rolle.«
»Aber wo soll das Verhör denn stattfinden?« fragte Amano, dem die beunruhigende Stimmung Angst machte, beinahe schüchtern.
»Tja, im Restaurant hier ist wohl nicht so toll ...« »Murasakino schreit sowieso wieder rum.« »Und wer weiß, was Aoki dann anstellt.«
»Unser Klubraum scheidet um diese Uhrzeit auch aus.« »Klubraum geht nicht. Wenn Aoki dort angegriffen wird,
gibt es keine Fluchtmöglichkeit.«
»Dann weiter weg ... Wir holen uns einen Lieferwagen von Amanos Altem. Die Parks in Yokohama sind relativ sicher, da machen nachts auch viele Liebespärchen rum.« Amanos Vater war Bauunternehmer und es war schon öfters vorgekommen, dass der Junior sich einen der Firmenwagen ausgeliehen hatte, um spät nachts mit Nabeta und Rei in einen Park in Yokohama zu fahren. Natürlich ohne Führerschein.
»Abgelehnt. Was wenn ein Liebespärchen auf die Idee kommt, uns zu melden?«
»Und wenn schon, das sieht höchstens nach Rudelspannen aus.«
»Wie wär's bei uns zu Hause? Meine Alten sind bis morgen Abend wegen 'ner Totenmesse außer Haus. Und die Typen werden ja wohl nicht auf die Idee kommen, ein Privathaus zu stürmen, oder? Wenn sich die Nachbarn über den Lärm beschweren, sagen wir, es wäre eine Feier.«
»Und dein kleiner Bruder?«
»Dem gebe ich etwas Geld und schick ihn zu einem Freund zum Übernachten. Also, was meint ihr?«
»Keine Einwände, unter der Bedingung, dass Gewaltanwendung ausgeschlossen ist.« Rei brachte den verbesserten Vorschlag ein, und die Runde stimmte zu.
»Ich sage Aoki Bescheid. Wir treffen uns heute, Punkt 22 Uhr.«
»Und wenn du ihn nicht erreichst?«
»Dann machen wir eben wirklich eine Feier ... Fleisch zum Grillen haben wir ja jede Menge.« Mit einer geschickten Bewegung holte Murasakino eine Plastiktüte aus seiner Tasche und begann unter geflissentlicher Missachtung der schwermütigen Mienen der anderen, das übriggebliebene Fleisch hineinzustopfen.
»Von mir aus nehmt den Kram mit nach Hause, aber was schon gebraten ist, solltet ihr auch noch aufessen«, sagte Gotoda, als wollte er ihnen noch einen zusätzlichen Schlag verpassen. »Kann sein, dass der Laden hier verdammt billig ist, aber ich muss es von einem verdammt kleinen Gehalt bezahlen.«
»Klar doch!« Beflügelt von der deutlichen Antwort Murasakinos streckten Rei und die anderen bereits ihre Essstäbchen nach den halb verkohlten Fleischhäppchen aus.
»Sag mal, was denkst du, wo die Leichen der drei Verschwundenen versteckt sind?« Amano stellte diese gefürchtetste Frage von allen, und Gotoda antwortete ihm:
»Das wissen nur die Götter. Vielleicht sind sie ja schon gefressen worden.« Gotodas hyänenartiges, hämisches Lachen erscholl durch den Raum.
Wenige Stunden später wurde das Verschwinden von Seiji Aoki bekannt. Aoki war nach Unterrichtsende offenbar nicht nach Hause zurückgekehrt, und seine Mutter bedrängte Murasakino mit Fragen nach dem Verbleib ihres Sohnes. Also veranstalteten Rei und seine Freunde in Murasakinos Haus ihr Gelage. Sie tranken große Mengen billigen Reiswein und verschlangen große Mengen Fleisch, das sie ohne Ausnahme alle im Alkoholkater am nächsten Morgen wieder erbrachen.
DIE PARTEI
Allianz
ERSTER TEIL
Allianz
ERSTER TEIL
Rei erfuhr von der Verhaftung Doigakus und Amanos einen Tag nach der gescheiterten Vernehmung Aokis mit dem anschließenden Trinkgelage und der morgendlichen Brechorgie. Genauer gesagt war es beinahe schon wieder Abend, denn nachdem sich Rei mit Hilfe seines Nachschlüssels morgens unbemerkt zu Hause eingeschlichen hatte, war er für beinahe zwölf Stunden in Tiefschlaf versunken. Die Nachricht kam von Nabeta, der sich am Telefon gegenüber den Eltern als Klassenkamerad von Rei ausgegeben hatte. Offenbar wusste auch Nabeta keine Einzelheiten, und man kam überein, eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten. Rei schnappte sich eine Jacke und verließ in Windeseile das Haus. An der Haustür versuchte die von geradezu glühendem Eifer beseelte Mutter, ihren Sohn von seinem schlechten Weg abzubringen, aber Rei schlug sich eine Bresche durch die feindlichen Linien. Freilich nicht gewaltsam mit Tritten oder Schlägen, sondern einfach, indem er die Mutter, die sich an seiner Jacke festklammerte, mitsamt der Jacke zurückließ. Dann machte er sich eilig auf den Weg zum Bahnhof.
Der verabredete Treffpunkt, das Mammut Café direkt vor dem Bahnhof, war zu dieser abendlichen Stunde voller Gäste.
Wie der Name »Roma« schon andeutete, war die Einrichtung mit ihren zahlreichen Balkonen und Nachbildungen von Rüstungen, die auf Treppenabsätzen standen, ziemlich geschmacklos. Da es in der Umgebung aber nur so von Pachinko Spielhallen wimmelte, waren die Gäste alles andere als vornehm. Yakuza Kleinkriminelle aus der näheren Umgebung, Hostessen, Ladenbesitzer und Immobilienhaie ... Rei bahnte sich seinen Weg durch Stockwerke, in denen diese wenig erlesene Gästeschar sich im lockeren Gespräch befand, stieg über labyrinthartige Treppen nach oben und entdeckte schließlich in der Ecke irgendeiner Ebene, in der schon nicht mehr klar war, um welches Stockwerk es sich eigentlich handelte, Nabetas Gesicht. Rei hob seine Hand zu einem flüchtigen Gruß und näherte sich Nabeta, der an einem grell gefärbten Parfait schleckte, was den Schluss zuließ, dass er sich bereits von seinem Alkoholkater erholt hatte. Als Rei sich hingesetzt hatte, fiel im ein, dass er seit dem Morgen nichts mehr gegessen hatte. Er bestellte sich einen Teller mit extra dickem Toastbrot und schwarzem Tee.
Als die stark geschminkte Bedienung gegangen war, beugte Rei sich vor und fragte Nabeta mit leiser Stimme: »Also, wie sieht's aus?«
»Wie soll ich sagen ... Vor zwei Stunden hat mich der alte Gotoda angerufen. Wie's aussieht, haben sie Amano und Doigaku eingebuchtet. Er will die Sache überprüfen und dann direkt hierher kommen.«
»Und Murasakino?«
»Der ist am Rotieren. Wenn es wirklich stimmt, dass sie eingebuchtet wurden, müssen wir uns etwas einfallen lassen. Dem Krisenzentrum Bescheid geben oder was auch immer ... Um Aoki mach ich mir allerdings auch Sorgen.«
»Gibt's von ihm was Neues?«
»Scheint, dass er um die Mittagszeit zu Hause angerufen hat, aber persönlich gesichtet wurde er nicht. Aokis Mutter ist offenbar kurz vor dem Austicken.«
»Scheiße.«
»Du sagst es.«
Nach diesem kurzen Gespräch verfielen beide in Schweigen. Es gab vieles, worüber sie hätten reden können, aber angesichts des Ernstes der Situation brachten Rei und Nabeta noch nicht die Kraft auf, auch nur ein Wort zu sagen. Sie konnten nur warten, bis Gotoda und Murasakino auftauchen und die Situation aufklären würden.
Das Toastbrot kam noch vor Gotoda. Rei zerteilte das nach Butter duftende Toast in zwei Teile, schmierte eine dicke Schicht Marmelade auf eine der Hälften und nahm einen Bissen. Dann goss er reichlich Milch in den schwarzen Tee und unterbrach ab und zu sein Kauen, um daran zu nippen. Als Rei Marmelade auf die zweite Hälfte des Toasts häufte, erschien Murasakino mit einer finsteren Miene. Er warf einen Blick auf Reis Toast und bestellte ein Schinkentoast mit Tee, änderte seine Bestellung aber nach kurzem Nachdenken in ein Eiersandwich mit Kaffee.
»Wie war's?« fragte Nabeta während er an seinem Parfait schleckte.
»Gar nichts war... Im Krisenzentrum wussten sie nichts von einer Verhaftung, aber zur Sicherheit habe ich alle Unterlagen in unserem Klubraum vernichtet.«
»Und Aoki?«
»Auf dem Weg hierher war ich bei seiner Mutter, aber wie es aussieht, ist er immer noch nicht zu Hause gewesen. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, ob er verhaftet wurde, ob er verschwunden ist oder ob er ihnen zuvorkommen wollte und untergetaucht ist. Aokis Alte hat sich an mich geklammert und mir was vor geheult, dass es nicht mehr feierlich war.«
Nach diesem kurzen Bericht verschränkte Murasakino die Arme und schwieg. Als Rei seinen Toast gegessen hatte, kam Murasakinos Eiersandwich, was wiederum Nabeta dazu animierte, noch eine Portion Pfannkuchen zu bestellen. Etwas später, ungefähr als Murasakino sein Sandwich verputzt hatte und Kaffee schlürfend zur Decke starrte und Nabeta gerade damit begonnen hatte, Sirup auf seinen Pfannkuchen zu verteilen, erschien Gotoda. Als er das Chaos auf dem Tisch sah, verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse. Dann setzte er sich und bestellte eine kleine Flasche Bier. Er wartete, bis die Bedienung das leere Geschirr abgeräumt hatte und begann dann zu erzählen:
»Die beiden wurden von einem Streifenwagen kontrolliert, als sie zu zweit auf einem Motorrad an einer Ampel im Azabu Distrikt' warteten. Weil sie sich verdächtig verhielten, wurden sie zu einer freiwilligen polizeilichen Befragung auf die nächste Polizeiwache begleitet. Als man sie auf der Polizeiwache befragte, kam es zu einem plötzlichen Gewaltausbruch und sie schlugen auf einen Beamten der Dienststelle ein. Daraufhin wurden die beiden wegen Körperverletzung und Behinderung einer Amtshandlung sofort festgenommen. Aufgrund der Schülerfahrkarten, die man bei ihnen fand, konnten sie als Yuichi Doigaku und Masaru Amano, Schüler des Jahrgangs Zwölf der Städtischen K-Oberschule, identifiziert werden. Zur Zeit befinden sie sich im Polizeirevier von Azabu in Untersuchungshaft ... «
»Dann stimmt es also!«
»Keiner von beiden wäre so blöd, in einer Polizeiwache auf Beamte einzuprügeln. Der Vorwurf ist frei erfunden.«
»Tja, das kann gut sein«, gab Gotoda ohne weitere Umschweife zu und fuhr dann fort: »Schon die FPB an sich ist verdächtig. Falls man sich an dem Punkt widersetzt, an dem man gebeten wird, mit auf die Wache zu kommen, können sie einen wegen Behinderung einer Amtshandlung verhaften. Allein, dass die Beamten die beiden mit auf die Wache gebracht haben, spricht doch für sich... Sie hatten es gezielt auf sie abgesehen.«
Eine FPB oder »freiwillige polizeiliche Befragung auf einer Wache war mit keinerlei juristischem Zwang verbunden, wenn man die Buchstaben des Polizeigesetzes wörtlich auslegte. Sie war freiwillig und man konnte es ablehnen, mit auf die Polizeiwache zu kommen. In der Praxis war eine solche Ablehnung aber schwierig, weil einige Bedingungen nicht leicht zu erfüllen waren, etwa dass ausreichend Zeugen vor Ort sein mussten. So war die Gefahr recht groß, dass hartnäckiges Verweigern als »Behinderung einer Amtshandlung« angesehen wurde. Einmal auf der Polizeiwache, verwandelte sich ein von außen nicht einsehbares Hinterzimmer nach Gutdünken der Polizisten in einen rechtsfreien Raum, wo man dem Betreffenden nach Lust und Laune mit Tritten und Schlägen Gewalt zufügen konnte und die einzigen Zeugen Polizeibeamte der Wache waren. Selbst wenn davon blaue Flecken zurückblieben, war es beinahe unmöglich, das im Nachhinein zu beweisen, wenn die Polizei einfach den Standpunkt vertrat, dass die Flecken davon herrührten, dass der Betreffende gewütet habe und dabei gestürzt oder umgefallen sei. Es gab außerdem entsprechende Techniken, um das Entstehen offener Wunden zu vermeiden, etwa das Schlagen mit einem Telefonbuch.
Noch schlimmer als im Hinterzimmer einer Wache konnte es im Gewahrsam eines Polizeireviers zugehen. Hier befand man sich in einer von den Augen der Öffentlichkeit abgeschotteten Welt, in weicher die Polizisten beinahe uneingeschränkte Macht über Leben und Tod eines Inhaftierten besaßen. Und dass eine solche Umgebung der ideale Nährboden für falsche Anschuldigungen auf der Basis erzwungener Geständnisse ist, dürfte keine gänzlich neue Erkenntnis sein.
»Sie hatten sogar eigens einen Streifenwagen* bereitgestellt, um sie im Falle einer Flucht verfolgen zu können. Ich muss schon sagen ... Das sind ganz schön dicke Geschütze, die sie da gegen zwei Oberschüler auffahren«, fasste Gotoda das Ganze in einem Ton von Selbstironie zusammen.
»Aber wieso? Was wollen sie von zwei. ..« Nabeta unterbrach sich, als er sah, dass die Bedienung mit dem Bier für Gotoda zum Tisch kam. Gotoda griff sich eine der Bohnen, die die Kellnerin als Snack zum Bier gebracht hatte, goss sich etwas Bier ins Glas und begann dann zu reden:
»Die Polizisten vor Ort haben nur auf Befehl von oben gehandelt, ohne die näheren Umstände zu kennen. Für jemanden, der so mächtig ist, dass er die Einstellung von Ermittlungen erwirken kann, ist das eine Kleinigkeit. Andererseits spricht die Tatsache, dass sie gegen zwei harmlose Oberschüler zu solch offensichtlichen Methoden greifen, dafür, dass die Lage bereits kritischer ist, als wir dachten.«
»Ob es was mit dem Verschwinden von Aoki zu tun hat?« »Schwierig zu sagen, was zuerst passiert ist.« Gotoda bestätigte mit seiner Aussage Reis Vermutung auf subtile Art und nahm dann einen großen Schluck aus seinem Glas.
»Wirklich dumm ist, dass sie jetzt Personalien von uns haben«, sagte Nabeta betrübt, während er seine inzwischen erkalteten Pfannkuchen zerteilte.
»Die hatten sie schon vorher, sonst hätten sie sich nicht gezielt die beiden gegriffen. Wahrscheinlich haben sie inzwischen bei den Eltern angerufen. Will gar nicht wissen, was da zu Hause bei denen los ist. Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht auch noch erwischt.«
Nabeta stimmte Rei zu und stopfte sich mit einer noch betrübteren Miene den Mund mit Pfannkuchen voll. Rei wusste nicht, ob es in allen Familien mit politisch aktiven Schülern so war, aber seine Eltern hatten über das Telefon längst ein äußerst leistungsfähiges Informationsnetz aufgebaut. Die Präzision der Informationen darüber, wer sich wann mit wem wo traf oder wer jetzt wo gerade was machte, hatte dabei ein erstaunliches Niveau erreicht. Einmal war Rei vor den Anleitungslehrer zitiert worden, der ein Flugblatt vor ihm auf den Tisch knallte und dann verkündete, dass Rei das Flugblatt geschrieben, Murasakino es gedruckt und Nabeta es verteilt habe. Und genauso war es auch gewesen. Über so erschreckend präzise Informationen konnte eigentlich nur jemand verfügen, der sich in unmittelbarer Nähe der Jugendlieben aufhielt. Eine sorgfältige Untersuchung der Sache durch Rei und die anderen förderte dann zutage, dass alles wohl damit begonnen hatte, dass Murasakinos Eltern in seinem Papierkorb ein Manuskript von Rei entdeckt hatten. Fortan sahen die Kameraden sich gezwungen, dem Inhalt ihrer privaten Papierkörbe eine geradezu revolutionäre Wachsamkeit entgegenzubringen.
Man musste kein Hellseher sein, um zu wissen, dass die Drähte dieses Informationsnetzes gerade im Augenblick wieder heiß liefen, weil die Eltern sich miteinander am Telefon berieten und Pläne schmiedeten. Die kompromisslose Ideologie der elterlichen Liebe war wirklich zum Fürchten. Jetzt, wo einer der Kameraden verschwunden und zwei inhaftiert waren, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einer Entscheidungsschlacht gegen den von ihnen sogenannten »familiären Imperialismus« gezwungen würden.
»Ich frage mich, was die beiden Typen überhaupt in Azabu zu suchen hatten«, brummte Nabeta vor sich hin in und Rei antwortete in einem lustlosen Tonfall.
»Wahrscheinlich haben sie dieses Auto verfolgt. Zu zweit ohne Führerschein auf dem Motorrad ... «
»Na ja, die beiden waren schon immer abenteuerlustig.« »Die werden so schnell nicht freikommen«, sagte Gotoda mit genervter Stimme und zündete sich eine Echo an. »Ich hab ihnen doch gesagt, dass sie die Finger davon lassen sollen.«
»Verdammt, du bist doch der Bulle hier, also nörgel nicht rum, sondern tu irgendwas für die beiden!« Murasakino, der bisher nur schweigend zugehört hatte, explodierte auf einmal. Die nicht sehr erlesenen Gäste an den umliegenden Tischen hoben wie auf Kommando den Kopf. Zwei junge Männer, die am Nebentisch geraucht hatten, sprangen von ihren Sitzen auf, als sie das Wort »Bulle« hörten. Ihrem Aussehen nach zu urteilen, handelte es sich bei ihnen im Unterschied zu Rei und seinen Freunden um missratene Jugendliche im traditionellen Sinne.
Die bedrohliche Atmosphäre ließ das gesamte Stockwerk zu Eis erstarren. Einer Bedienung entglitt ein Metalltablett und schlug scheppernd auf dem Boden auf. Gotoda erhob sich und senkte kurz den Kopf:
»Entschuldigen Sie bitte die kurze Störung, meine Damen und Herren. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ich wünsche weiterhin angenehme Unterhaltung.
Das klang wie aus einer Ansprache bei einem Hochzeitsbankett. Gotoda setzte sich wieder. Vereinzelt kamen flüsternde Stimmen auf und bald waren die vier wieder vom Geräusch der angeregten Gespräche in ihrer Umgebung eingehüllt. Abgesehen von den beiden jungen Kerlen am Nebentisch, die sich inzwischen verzogen hatten, war damit die Situation wiederhergestellt.
»Idiot, du sollst hier nicht so herumschreien!« fauchte Rei Murasakino aus nächster Nähe an. Dessen Miene war immer noch von seinem Wutausbruch verzerrt, aber als er sich jetzt wiederholte, senkte er tatsächlich seine Stimme.
»Tu irgendwas für die zwei!«
»Rede keinen Quatsch. Genauso wie ihr stinknormale Oberschüler seid, bin ich ein stinknormaler Polizist. Was glaubst du, was es für eine Aktion für mich war, allein diese ganzen Informationen zusammenzukratzen?«
»Tu irgendwas!« Murasakino wiederholte stur seine Forderung, aber Rei beachtete ihn nicht weiter, als er Gotoda eine Frage stellte:
»Was passiert jetzt mit den beiden?«
»Schwer zu sagen, ich habe keine Ahnung, was die da oben im Schilde führen, aber zu einem Ermittlungsverfahren wird's wohl nicht kommen. Falls sie den beiden nur eine Lektion erteilen wollen, ist es einfacher, sie so lange wie möglich im Gewahrsam zu behalten und sie dann freizulassen. Wenn es vor Gericht geht, wird alles umständlicher und kostet Zeit.« Gotoda goss sich das restliche Bier in sein Glas und fuhr dann fort: »Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihnen dabei um eine Warnung oder Einschüchterung ging.
»Wie meinst du das?«
»In einem so großen Verein wie der Polizei kocht jeder sein eigenes Süppchen ... Deshalb ist gar nicht gesagt, dass auf allen Ebenen von oben nach unten alle immer das Gleiche wollen«, sagte Gotoda in einem für seine Verhältnisse merkwürdig nebulösen Ton. »Berichtet lieber mal, was dieses Mädchen so macht.«
»Gar nichts. Kommt zur Schule, als ob nichts wäre.« »Und Seiji Aoki?«
»Hat sich seit gestern nicht mehr zu Hause blicken lassen.
Der Kontakt zu ihm ist abgerissen«, antwortete Nabeta.
»Es liegen keine Meldungen über eine Leiche vor, er sollte also noch am Leben sein...«
»Sagt dir das wieder mal dein Instinkt?«
»Macht euch jedenfalls keine Gedanken wegen der beiden.
Es kann nicht besser werden, aber auch nicht schlimmer. Und für euch wäre es besser, wenn ihr euch eine Weile unauffällig verhaltet.« Mit dem Versprechen, sich wieder zu melden, stand Gotoda von seinem Platz auf, und Nabeta hielt ihm die Rechnung hin. Gotoda, sah flüchtig hin, griff den Zettel, wobei er undeutlich murmelnd einen Fluch von sich gab, und machte sich davon.
»Was machen wir jetzt?« fragte Nabeta mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck Rei.
»Jedenfalls hab ich keine Lust nach Hause zu gehen.« »Ich auch nicht«, sagte Nabeta.
»Ich erst recht nicht«, ergänzte Murasakino.
Zu Hause würde auf alle drei ein Schlachtfeld warten. Nabeta stammte aus einer Beamtenfamilie, sein Vater und sein älterer Bruder waren beide in der Distriktverwaltung tätig. Die Mutter war Bezirksvorsteherin der Frauenorganisation irgendeiner konservativen Partei und die zentrale Figur im besagten Informationsnetz.
Murasakino wurde von seinen Eltern als Rädelsführer irgendeiner Bande angesehen, was natürlich ein grobes Missverständnis war, denn es war einfach nur Murasakinos Sinn für Ordnung und Korrektheit, der ihn alle verantwortlichen Arbeiten übernehmen ließ. In Murasakinos Familie tobte ohnehin schon ein ständiger Kampf, weil seinem Motorrad verrückten jüngeren Bruder wegen zu häufiger Abwesenheit vom Unterricht die Wiederholung des Schuljahrs nahegelegt worden war.
Ganz zu schweigen von Rei. Der beteiligte sich trotz seiner Suspendierung vom Unterricht ständig an heimlichen Aktionen und hatte gerade auf dem Weg hierher wieder einmal den Sperrgürtel seiner Mutter durchbrochen.
Allein der Gedanke daran, dass seine Eltern ihn jetzt fieberhaft gespannt zu Hause erwarteten, ließ Rei niedergeschlagen werden und sein ganzer Körper fühlte sich taub an. Er war fast schon bereit, anstelle von Doigaku und Amano wieder in Haft zu gehen, wenn er dafür nur dieser Situation aus dem Weg gehen könnte. Die drei legten ihr Geld zusammen und bestellten noch einmal eine Tasse Kaffee für jeden. Dann rauchten sie den Aschenbecher voll, bis man sie schließlich aus dem Café hinauswarf. Danach vertrieben sie sich die Zeit, indem sie ziellos durch die Straßen liefen, wohl wissend, dass sie dadurch alles nur noch schlimmer machten. Und schließlich gingen alle drei nach Hause.
ZWEITER TEIL
Rei wurde erneut unter Hausarrest gestellt. Beim ersten Mal hatte er diesen Zustand willentlich herbeigeführt, aber diesmal wurde er ihm gegen seinen Willen aufgezwungen, es war also ein »waschechter« Hausarrest. In der Nacht, in der Rei sich von Murasakino und Nabeta verabschiedet hatte und dann mit der letzten Bahn heimgefahren war, wurde er zu Hause bereits von seinen Eltern erwartet. Der Vater war schon betrunken und trat auf wie ein bösartiger Dämon, die Mutter hatte sich vor lauter Gram um das Wohl ihres Sohnes dazu durchgerungen, endlich hart zu bleiben. Es waren also zwei in ihrer Art recht unterschiedliche Teufel, die Rei hier erwarteten.
»Roter«, »Vaterlandsverräter«, »Volksfeind«, »Schmarotzer«...
Das waren die Worte aus längst vergangenen Zeiten, die Rei entgegengeschleudert wurden. Teekännchen und Keramikbecher flogen durch das Zimmer und die Papierbespannung der Schiebetüren wurde zerrissen, bis der Hund des Nachbarn zu bellen anfing. Rei bediente sich der wirksamsten Methode, um die eigenen Nerven zu schonen, nämlich konsequentes Schweigen, aber das brachte den Vater nur noch mehr in Rage. Als er begann, auf Rei einzuprügeln, warf sich die Mutter schützend vor ihren Sohn und wurde weggestoßen. Sie fiel zu Boden und blieb bewusstlos liegen, worauf Rei in Panik geriet und forderte, die Ambulanz zu rufen. Die Schlacht war damit zu Ende, der Krieg freilich noch lange nicht.
Rei, der leichtsinnigerweise glaubte, die Sache sei damit schon erledigt, wurde am nächsten Tag eines Besseren belehrt. Die Mutter, die morgens als erstes gegen ärztlichen Rat nach Hause zurückgekehrt war, verkündete Rei, dass er bis zur Aufhebung der Suspendierung vom Unterricht unter Hausarrest stehe. Es war ihm strengstens verboten, das Haus zu verlassen, zu telefonieren oder Telefonate anzunehmen, und selbst die drei täglichen Mahlzeiten würde man ihm aufs Zimmer bringen. Außerdem ließ die Mutter, die Reis nächtliche Aktivitäten schon seit längerem beargwöhnt hatte, einen Schlosser kommen, der das Schloss der Haustür auswechselte und Reis Nachschlüssel damit nutzlos machte.
Die ersten drei Tage seines neuerlichen Hausarrestes verbrachte Rei so wie beim letzten Mal, nämlich mit Schlafen. Da Rei kein Kind mehr war, konnte auch ein Hausarrest normalerweise nicht verhindern, dass er von zu Hause floh. Sein persönliches Zimmer war nicht abgeschlossen und zumindest tagsüber konnte auch die Haustür wegen des Kommens und Gehens der Angestellten aus den Büros nicht einfach abgeschlossen werden. Aber es gab zwei Gründe, weshalb Rei seinen Zustand klaglos hinnahm. Hätte er unter diesen Umständen die Warnung der Mutter missachtet und das Haus verlassen, wäre eine weitere Eskalation des Streits in der Familie unvermeidlich geworden, und sein Vater, dieses Beispiel personifizierter Barbarei, wäre dann zweifellos erst recht in seinem Element gewesen. Es war Reis Politik, Handgreiflichkeiten mit seinem Vater nach Möglichkeiten zu vermeiden. Bevor es zu solch extremen Formen der Auseinandersetzung käme, wäre es schon klüger, einen Erstschlag mit der ultimativen Waffe im Kampf gegen den familiären Imperialismus zu führen, das heißt, von zu Hause abzuhauen, dachte Rei. Nach herkömmlicher Denkweise musste diese Haltung als eine persönliche Schwäche Reis ausgelegt werden, aber in seinem Inneren besaß Rei durchaus Argumente, mit denen er seine Strategie rechtfertigte.
Rei wusste nicht, ob Lenin, dieser Befürworter der gewaltsamen Revolution, seine Ehefrau Krupskaja geschlagen hatte, aber für ihn gab es einen klaren Unterschied zwischen politischer Gewalt und körperlicher Gewalt, die beim Individuum aus einem Gefühl der Unsicherheit heraus hervorbricht. Genauso wie imperialistische Eroberungskriege und revolutionäre Kriege zwei verschiedene Dinge waren, wie Rei selbst immer gerne sagte.
Es wäre Unfug, das biologische Individuum Lenin und den Revolutionär Lenin über einen Kamm zu scheren. Die Gefühle eines Individuums für seine Familie und sein Wille und Wollen im Politischen und im Sozialen beruhen ganz klar auf zwei unterschiedlichen seelischen Prozessen. Diese zu vermischen, wäre ein schwerer gedanklicher Fehler. Aber ebenso wie die meisten anderen politischen Aktivisten an den Oberschulen besaß Rei damals überzogene moralische Ansprüche und war voller Ungeduld, wenn es um die Rigorosität der ideologischen Einstellung ging. Kurzum, Rei war ein Jugendlicher (Rei hasste dieses Wort), der einerseits entschlossen war, notfalls Molotowcocktails und Bomben einzusetzen, um die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft zu zerstören, andererseits im Grunde seines Herzens aber so gutmütig war, dass ein Zerwürfnis mit den Eltern ihm unerträglich gewesen wäre. Rei war nicht fähig, sein Ego, dem der gewalttätige und autoritäre Vater seelische Wunden beigebracht hatte, zu relativieren, und mühte sich verzweifelt ab, diese Tatsache ideologisch zu beschönigen. Natürlich war Rei selbst das so nicht bewusst. Ein zweiter (und möglicherweise entscheidenderer) Grund für Reis Passivität war, dass er sich in der miserablen Lage befand, nicht zu wissen, was er einstweilen überhaupt tun konnte. Da es Rei nicht möglich war, Kontakt zu Nabeta und Murasakino herzustellen, konnte er sich nur ausmalen, wie es beiden gerade erging, vermutlich nicht viel besser als ihm.
Also lag Rei auf seinem Bett, betrachtete die Zimmerdecke und hing Gedanken nach, die sich um den aktuellen Fall drehten. Abgesehen von der Zeit, die er für Mahlzeiten, Schlaf und Toilette benötigte, hatte er praktisch die gesamten letzten drei Tage so zugebracht. Etwas anderes hatte er ohnehin nicht zu tun. Da war zum einen ein anonymer Mörder mit unbekanntem Motiv, der die Aktivisten der Schülerorganisation einer unbedeutenden politischen Splittergruppe auf unheimliche Art und Weise ermordete. Und zum anderen gab es dieses Mädchen, das sich Saya nannte und das aus offenbar wieder anderen Motiven die Opfer beobachtete und dabei Unterstützung von zwei Ausländern erhielt.
In Wahrheit hatte Rei aufgrund einer Tatsache, von der nur er ( und vielleicht Gotoda zumindest in teilweise) wusste, bereits seine eigenen Vermutungen über die jeweiligen Motive der beiden Gruppen und über die groben Züge des Streits, der zwischen ihnen herrschte, angestellt. Nach der gegenwärtigen
Lage der Dinge konnte der spurlos verschwundene Aoki jederzeit als Leiche Wiederauftauchen. Dann hätte auch diese Saya keinen Grund mehr, noch länger an Reis Schule zu bleiben. Und mit Aoki wäre auch der einzige Berührungspunkt, der Rei und seine Kameraden mit diesem Fall verband, verloren. Der Fall würde sich, ungelöst wie er war, immer weiter von ihnen entfernen, und auch die Verbindung zu Saya und zu Gotoda würde schließlich erlöschen. Doigaku und Amano würden wohl bald aus der Haft entlassen werden, und wenn Rei nur Schweigen über diese eine Tatsache bewahrte, wäre alles bald wieder so wie früher, so wie vor jener Nacht. Abgesehen vielleicht davon, dass ihr Kamerad Aoki nicht mehr lebte.
Nicht dass Rei sich das gewünscht hätte, aber es war nun einmal die einzige Form, in der Rei sich ein Ende dieses Falls vorstellen konnte. Letztlich waren Rei und Murasakino und die anderen doch nur Oberschüler, die noch in Abhängigkeit von ihren Eltern lebten. Daran hatte die Entwicklung der Dinge Rei auf schmerzhafte Weise erinnert. Saya hingegen war zwar ihrer äußeren Erscheinung nach eine Oberschülerin, aber ihr Inneres wohnte in einer Welt, welche die Vorstellungskraft von Rei und den anderen überstieg. Begleitet wurde sie auf Schritt und Tritt von diesen beiden unheimlichen Ausländern, hinter deren Rücken wiederum eine mächtige Organisation zu stehen schien. Mit solchen Leuten konnten es Rei und seine Kameraden nicht einmal im Traum aufnehmen. Das sagten auch die Ergebnisse der Ermittlungen Gotodas. Rei und die anderen hatten es lediglich geschafft, einige wenige Indizien und Eindrückt zu sammeln, die das bestätigten. Rei wollte Aoki aufrichtig helfen, aber nachdem Aoki selbst verschwunden war und man die beiden anderen aufgrund irgendeiner Intrige verhaftet hatte, war plötzlich alle Tatkraft aus Rei gewichen. Er hatte den Schwanz eingezogen, sich im »familiären Kampf« aufgerieben und ließ es sich nun gefallen, sich diesem für seine Verhältnisse geradezu lächerlichen Hausarrest zu ergeben. Rei musste daran denken, was diese Saya wohl gerade tat. Genau betrachtet hatte er sie seit jener Nacht kein einziges Mal mehr gesehen. Natürlich hatte er ihre raubtierartigen Augen und ihr bleiches Gesicht zu keinem Zeitpunkt vergessen. Und die Angst des Augenblicks, als sie sich anschickte, ihn mit ihrem Schwert niederzumachen, lebte auch jetzt noch höchst lebendig in ihm fort. Aber zugleich empfand Rei das jetzt aus irgendeinem Grund auch als unnatürlich.
Noch ein paar Tage und Reis Suspendierung vom Unterricht würde enden. Falls die Situation während dieser Zeit nicht irgendeine entscheidende Wendung erfahren würde, würde ei das Mädchen vielleicht nie wieder sehen. Bei diesem Gedanken richtete sich Rei plötzlich im Bett auf. War es möglich, dass er sich wünschte, diese Saya noch einmal zu treffen? Rei erschrak über seine eigenen Gedanken. Er selbst hatte sie mit einem Wolf, dem man in einem finsteren Wald begegnet, verglichen. Zweifellos vergisst ein Mensch, der einmal in einem dunklen Wald auf einen Wolf getroffen ist, diese Begegnung niemals. Aber war das, was er nicht vergessen konnte, wirklich die Angst der Begegnung mit dem Wolf? Oder war es nicht vielmehr der Wolf selbst?
Rei stieg aus dem Bett und lief zum Spülbecken hinüber. Er füllte Wasser in den Alu-Teekessel und stellte ihn auf den Gaskocher. Seit der großen Portion Curryreis, die ihm seine Mutter zum Mittagessen gebracht hatte, waren schon mehr als vier Stunden vergangen, und Rei hatte großen Hunger. Er öffnete die Tür unter der Spüle und nahm einen der Beutel mit Instantramen, die er dort versteckt hielt. Er riss die Packung auf, brach den Block aus getrockneten Nudeln in zwei Teile und stopfte sie in den Kessel. Auch die beiden kleinen Beutel, die mit in der Packung waren, riss er auf und fügte das Suppenpulver und das Würzöl den Nudeln hinzu.Jetzt musste er nur noch die Flamme so einstellen, dass das kochende Wasser nicht aus dem Ausguss des Teekessels gedrückt wurde.
Als Mahlzeit waren diese Instantramen im Teekessel ein wenig primitiv, aber die Zubereitung war mit minimalem Aufwand möglich, und durch die erstklassige Hitzeleitung des Kes sels bekamen die Nudeln eine ganz besondere Zartheit. Ein weiterer Vorteil war, dass er anschließend außer dem Teekessel selbst nichts spülen musste. Rei nahm aus dem Becher mit Stiften auf seinem Schreibtisch zwei abgenutzte und schon braun verfärbte Einwegessstäbchen, hockte sich im Schneidersitz auf seinen Stuhl und wartete, dass das Wasser kochte. In diesem Moment klopfte es an der Tür, und Rei runzelte die Stirn. Vorsichtig löschte Rei die Flamme und öffnete die Tür. Dort stand seine Mutter und machte ein übellauniges Gesicht.
»Ein Buchladen hat angerufen. Damit wir uns verstehen, du kannst die Sachen abholen, sobald du wieder zur Schule gehen darfst.« Es schien, als ob sie noch etwas sagen wollte, aber dann überreichte sie Rei einfach nur einen Notizzettel, warf einen ihrer bekannt misstrauischen Blicke auf den Sohn und ließ ihn dann alleine. Als Rei hinter der geschlossenen Tür den Zettel überflog, veränderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig.
Buchhandlung Hyodo am Bahnhof Ochanomizu »Der Einzelgänger« von Ryo Kamiu eingetroffen,
1700 Yen sehr seltener Titel, heute noch zugreifen
1700 Yen sehr seltener Titel, heute noch zugreifen
Es war eine Nachricht von Aoki. »Hyodo«, das war Aokis politischer Deckname. Es war ein Pseudonym, das von den Aktivisten aus Sicherheitsgründen in Sitzungsprotokollen, Nachrichten, Manuskripten und persönlichen Tagebüchern im Hinblick auf eine mögliche Beschlagnahme durch die Polizei verwendet wurde. Die Verwendung solcher Pseudonyme war unter Aktivisten eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber in letzter Zeit hatten Rei und die anderen häufig aus Bequemlichkeit darauf verzichtet. Nur Aoki, der neuerdings ein großer Verfechter dieser Sache gewesen war, hatte hartnäckig an ihrer Verwendung festgehalten. »Kamiu« war der politische Deckname von Rei, der »Bahnhof Ochanomizu« war der Treffpunkt, 1700« stand für die Uhrzeit (17.00 Uhr) und der Buchtitel Der Einzelgänger« bedeutete wohl, dass Rei alleine kommen sollte. Die letzte Zeile hatte Reis Mutter nachträglich durchgestrichen, aber sie sollte wohl einfach bedeuten, dass die Sache dringend war und keinen Aufschub duldete. Wenn man das Ganze also in Klartext übersetzt, ergab sich daraus folgende Nachricht:
An Rei
Bitte komm beute Nachmittag um 17.00 Uhr ohne Begleitung zum Bahnhof Ocbanomizu Die Angelegenheit ist dringend
Seiji Aoki
Seiji Aoki
Diese völlig unverhoffte Veränderung der Situation verunsicherte Rei. Er hatte nicht damit gerechnet, eine Meldung direkt von dem verschwundenen Aoki zu erhalten, aber nach Lage der Dinge war es nicht völlig unerklärlich. Aoki hatte für Rei und die anderen nur Schmähungen übrig gehabt und war aus Sturheit weiter in die Schule gekommen. Aber vielleicht hatte er die Gefahr ja doch noch erkannt und war freiwillig untergetaucht. Dann wäre es nur normal, dass er nach dem Untertauchen heimlich Kontakt zu einem Kameraden aufnahm. Und dass Aoki sich dafür Rei ausgesucht hatte, mit dem er besser zurechtkam als mit Murasakino und dem Rest, war ja durch aus verständlich. Und wenn alles möglichst unauffällig gesche hen musste, war es auch nur natürlich, dass Rei alleine zu den Treffen kommen sollte. Wenn Aoki so in Gefahr war, dass e: hatte untertauchen müssen, dann war das Treffen auch gewiß dringlich. Es konnte leicht sein, dass dies die letzte Gelegenheit war, mit Aoki persönlich zu sprechen.
Andererseits ... Gab es denn überhaupt (Rei war so damit beschäftigt alle denkbaren Möglichkeiten zu erwägen, dass er sogar vergaß, den Gaskocher wieder anzuzünden) einen Beweis dafür, dass die Nachricht tatsächlich von Aoki persönlich kam! Immerhin war nicht auszuschließen, dass die Kerle, die für die Verhaftung von Doigaku und Amano durch die Polizei gesorgt hatten, jetzt auch Rei aus dem Verkehr ziehen wollten. Aber Rei konnte sich schlecht vorstellen, dass sie soviel Zeit und Mühe auf ihn verwenden würden, jetzt, wo er ohnehin unter Hausarrest stand. Außerdem war der politische Deckname Aokis nur ihm selbst und den Kameraden bekannt. Solang niemand von ihnen diesen Decknamen verraten hatte, konnten Außenstehende nichts von ihm wissen. Also war davon aus zugehen, dass der Anruf echt war. Und wenn er echt war, was wollte Aoki ihm dann mitteilen? Am liebsten hätte Rei sich mit jemandem besprochen, aber an direkten Kontakt zu Nabet oder Murasakino war nicht zu denken. Außerdem drängte die Zeit. Für einen kurzen Moment kam Rei Gotodas Gesicht in den Sinn, aber er selbst hatte sich entschieden, dass die Kontakte zwischen ihnen nur von Gotoda ausgehen sollten, weil Rei der Meinung war, dass er nicht einfach so im Polizeirevier anrufen konnte. Wenigstens eine Zigarette wünschte Rei sich jetzt, aber seine letzte hatte er bereits kurz nach dem Mittag essen geraucht. Ein Blick auf die Uhr auf seinem Schreibtisch sagte Rei, dass es knapp werden würde, wenn er um 17.00 Uhr in Ochanomizu sein wollte, selbst wenn er jetzt sofort aus dem Haus ginge. Wenn er jetzt das Haus verließ, um sich mit Aoki zu treffen, konnte es sein, dass entweder er oder sein Vater demnächst von einer Ambulanz abgeholt würde. Aber er hatte keine Wahl. Rei kratzte alles, was er an Geld besaß, zusammen and steckte es in seine Tasche. Dann nahm er seine Schuhe in die Hand und eilte so schnell und leise wie möglich die Treppe hinunter.
DRITTER TEIL
Am Bahnhof Ochanomizu herrschte wie immer großes Gedränge. In diesem Viertel Tokios konzentrierten sich nicht nur viele Buchläden und Antiquariate, sondern es gab auch viele Verlage, die sich auf Bücher zu ideologischen Themen, Publikationen der neuen Linken und ähnliches spezialisiert hatten. In Begleitung von Nabeta, Aoki und den anderen kam Rei regelmäßig einmal in der Woche hierher. Das Viertel war ihm daher bestens vertraut.
An einem Kiosk im Bahnhof kaufte Rei ein Päckchen Long Peace und lenkte seine Schritte dann zielstrebig zu einem Auffangbehälter für Zigarettenkippen, der in einer Ecke des Raums mit den Fahrkartenschaltern stand. Hier trafen Rei und die anderen sich immer, wenn sie einen Ausflug nach Ochanomizu machten. Wenn Aoki irgendwo erscheinen würde, dann hier.
Aoki war nirgendwo zu sehen, und als Rei einen Blick auf seine Armbanduhr warf, sah er, dass es noch einige Minuten vor der verabredeten Zeit war riss das gerade gekaufte Päckchen Long Peace auf, naht eine Zigarette heraus und zündete sie sich an. Er fühlte sich mit einer Zigarette in der Öffentlichkeit seltsam unsicher und rauchte daher fast nie außerhalb der eigenen vier Wände, aber hier in diesem Viertel war das anders. Hier konzentrierten sich viele Universitäten, und in fast allen probten die Studenten zur Zeit den Aufstand. Es gab Universitätsgebäude, die schon seit mehr als einem halben Jahr besetzt gehalten wurden. Und entsprechend war auch die Atmosphäre, die von den überall herumlaufenden Studenten im Viertel verbreitet wurde. Wenn man hier einen Stein warf, war die Wahrscheinlichkeit hoch, einen Aktivisten oder Sympathisanten zu treffen. Ochanomizu war das Mekka der Studentenbewegung.
So tauchte auch jetzt vor den Augen des wartenden Rei eine Gruppe von gut zwanzig rot behelmten Studenten auf, die Flugblätter verteilten und sich beim Sammeln von Unterschriften und Spendengeldern ihre Stimmen heiser schrien. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung befand sich eine kleine Polizeiwache, die ein bejammernswertes Bild abgab. Allein während des vergangenen Jahres war sie mehrmals in Brand gesetzt worden, und bei der Demo der Einheitsfront neulich hatte sie wieder einige Molotowcocktails abbekommen. Rei rauchte seine Zigarette und betrachtete gedankenverloren das verrußte Gebäude, als er einen leichten Stoß im Rücken spürte und sich reflexartig umdrehen wollte.
»Nicht umdrehen!« fauchte eine leise Stimme. Es war die Stimme von Aoki. »Weitergehen. Über die Kreuzung und dann den Gehweg auf der rechten Seite entlang. Mach genau, was ich sage, Rei!«
Rei zögerte einen Moment, gab dann aber Aokis drängen dem Ton nach und begann loszulaufen. Rei lief den sanften Hügel hinab, der vom Bahnhof aus Richtung Kambocho führte Schon nach gut 100 Metern endeten die billigen Kneipen und Buchhandlungen für Studenten und an ihre Stelle trat eine Mauer, welche die Gebäude der rechtswissenschaftlichen Fakultät der M-Universität umgab. Entlang der Mauer stand eine lange Reihe von Schildern, die in der eckig aussehenden sogenannten »Studentenschrift« beschriftet waren. Rei ging langsam an den Schildern vorbei und fragte sich, wie weit sie gehen würden und ob Aoki überhaupt noch hinter ihm sei. In seiner Verunsicherung wollte Rei gerade stehenbleiben, aber wie verabredet ertönte just in diesem Moment von hinten Aokis Stimme, die ihn anwies, an der nächsten Ecke rechts abzubiegen.
Als Rei schließlich abgebogen war, sah er, dass der Weg nun bergauf führte und dass hier mit einem Schlag deutlich weniger Menschen unterwegs waren. Die Steigung verlangsamte Reis Schritt. Hinter sich spürte er Aokis Aura, die mit einem merkwürdigen Druckgefühl einherging. Als sie den Eingang einer Art Nebengebäude erreichten, trat Aoki plötzlich neben Rei, griff seien Oberarm und zog ihn in das Gebäude. Aoki drängte weiter, aber Rei befreite sich aus seiner Umklammerung.
»He, wo bringst du mich überhaupt hin?« Reis Frage geriet unwillkürlich aggressiv, wohl auch weil er von Aokis ganzem Gehabe ziemlich genervt war.
»Ein Kader unseres Komitees will dir ein paar Fragen stellen. Also tu mir den Gefallen...«
»He, Moment mal!« Rei verlor den Kopf. Sollte nicht eigentlich er Aoki befragen? Er sah es überhaupt nicht ein, sich vom Kader irgendeiner Fraktion, noch dazu einer so unrühmlichen und berüchtigten wie der SR-Fraktion, befragen zu lassen.
»Er will nur mal mit dir reden. Erzähl ihm, was ihr herausgefunden habt und das war's ... Von einem Verhör oder so was redet doch kein Mensch.«
Als das Wort Verhör fiel, bekam Rei es mit der Angst zu tun und vergaß dabei, dass er selbst erst kürzlich noch an einem Beschluss mitgewirkt hatte, der Aoki einem Verhör unterziehen sollte.
»Ist egal,ich mach da nicht mit! Sag mir lieber, was mit dir ... • »Hör mal zu!« Mit scharfer Stimme unterbrach Aoki Rei. »Sechs unserer Kameraden sind tot. Das ist kein persönliches Problem von mir. Da will jemand unsere ganze Organisation kaputtmachen.«
»Das ist das Problem eurer Splittergruppe!«
»Ist das dein Ernst? Auf der Straße draußen versteckt ihr euch nur zu gern hinter uns Splittergruppen! Ihr nennt euch Parteilose und dabei führt ihr euch selbst wie eine verdammte Splittergruppe auf!«
»Was fällt dir ein!« Jetzt war auch Rei verärgert und begann zu schreien. Eine Studentin, die gerade an ihnen vorbeigelaufen war, blieb stehen und sah sich nach ihnen um. Rei und Aoki stierten sich einen Moment an, aber schließlich wurde Rei klar, dass Streit hier zu nichts führen würde und er gab als erster nach. »Niemand führt sich wie eine Splittergruppe auf. Aber mit dem, was wir tun, wollen wir dich persönlich schützen und nicht eine bestimmte Gruppe ... Mensch, deinetwegen sind Doigaku und Amano sogar ... «
»... verhaftet worden, ich weiß.« Rei erschrak sich und seine Stimme stockte. »Ich hab doch gesagt, ihr sollt damit aufhören! Diese Idioten mussten ja unbedingt den Helden spielen! Aokis Stimme klang verächtlich, aber seine Miene wirkte eher gequält. »Jedenfalls kann ich bei meinem Handeln nicht auf persönliche Gefühle Rücksicht nehmen.«
»Hör mal zu, wie wär's denn damit ...« Rei hatte einen Einfall und sprach ihn direkt aus. »Ich werde erzählen, was ich weiß, aber du musst mir auch sagen, was ihr raus gefunden habt. Wir sind gleichberechtigt, und jeder kann sein Gesicht wahren. Wie wär's?«
»Schon wieder ein Manöver?« Aokis Mundwinkel entspannten sich, und er lächelte gequält. »Ich kann das nicht alleine entscheiden. Aber wenn es auf Informationen beschränkt bleibt, die diesen Fall betreffen, sollte es möglich sein. Ich werde mal nachfragen.«
Rei war mit seiner Flucht von zu Hause das Risiko einer ultimativen Konfrontation mit seiner Familie eingegangen. Er konnte jetzt nicht einfach mit leeren Händen nach Hause gehen. Außerdem war es die einmalige Gelegenheit, einen Kader der SR-Fraktion direkt zur Situation zu befragen. Das konnte nicht einmal Gotoda, ohne den Kader festzunehmen. Die Sache roch nicht ganz ungefährlich, aber wenn Aoki anwesend war, würde schon nichts schiefgehen. Rei freundete sich immer mehr mit seinem eigenen Vorschlag an und malte sich schon zufrieden Gotodas Gesicht aus, wenn er ihm die gewonnenen Informationen unter die Nase reiben würde.
»Einfach nur ein bisschen reden!« betonte er noch einmal. »Ja, nur ein bisschen reden«, antwortete Aoki.
Rei stand noch nicht lange vor dem scheinbar älteren Gebäude, als er schon begann, seinen Leichtsinn zu bereuen. Es kam durchaus vor, dass eine kleine studentische Partei, die keine der legalen politischen Parteien als Dachorganisation besaß, ihr Hauptquartier irgendwo auf dem Gelände einer Universität hatte. Solche kleinen Parteien finanzierten sich hauptsächlich durch Tributzahlungen ihrer Mitglieder, den Verkauf der Parteizeitung einer übergeordneten Organisation, oder Spendensammlungen auf der Straße. Größere Parteien, die zum sogenannten »Mainstream« gehörten, hatten auch die Möglichkeit, Studentenvereine, studentische Kooperativen und ähnliches unter ihre Fittiche zu nehmen und sich über deren Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder zu Uni-Festen oder Betriebskostenzuschüsse zu finanzieren. Es gab sogar Parteien, die so weit gingen, Märkte für biologische Lebensmittel zu betreiben. Die Finanzkraft hing also sehr stark von der Größe der jeweiligen Organisation ab. Für eine kleine Partei oder Fraktion war deshalb ein in studentischer Selbstverwaltung befindliches Gebäude oder - noch besser - ein studentisch besetztes Gebäude auf dem Uni-Gelände sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Selbstverteidigung eine gute Wahl.
Auch das dreigeschossige Gebäude, in dem die SR-Fraktion ihr Hauptquartier hatte, schien schon seit längerem besetzt und durch Barrikaden abgeriegelt zu sein. Über die seltsam verrußten Mauem des Gebäudes krochen verrostete Lüftungsrohre, was einen insgesamt düsteren Eindruck beim Betrachter hinterließ. Obwohl es bereits dunkel zu werden begann, war in keinem der Fenster Licht zu sehen. Der Wind pfiff durch die Gräser, die um das Gebäude herum hoch aufwuchsen, und sorgte dafür, dass Reis schon leicht angeschlagene Stimmung sich noch weiter trübte.
Ohne auf Reis Stimmungslage Rücksicht zu nehmen, kroch Aoki durch eine schmale Lücke in der Barrikade, die vor dem Eingang des Gebäudes aufgetürmt war. Rei, der draußen zurückgeblieben war, dachte einen Moment daran, einfach seine Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Aber wenn er jetzt, nachdem er soweit gegangen war, plötzlich Furcht zeigte, wäre er sich wie ein kleines Kind vorgekommen. Außerdem hatte er die Unterredung selbst vorgeschlagen. Sich jetzt zu weigern, hätte leicht bedeuten können,Aokis Vertrauen dauerhaft zu verlieren.
In dem Moment als Rei das Gebäude betreten hatte, spürte er, wie ihm ein kalter Schauder den Rücken hinunterlief und ihn zusammenfahren ließ. Je besser sich seine Augen an die Dunkelheit im Inneren gewöhnten, desto mehr konnte er erkennen. Auf dem Flur im Erdgeschoss, der sich direkt vor ihm geradeaus erstreckte, lagen Stellplakatwände und Holzlatten wild durcheinander, überall auf den Wänden waren in großen Buchstaben Parolen geschrieben. Soweit entsprach das, was er sah, der klassischen Innenansicht eines besetzten Gebäudes. Aber hinzu kam, dass auf allem eine merkwürdige, schwere Kälte zu lasten schien und - noch schlimmer - dass jeglicher Hinweis auf menschliches Leben fehlte. Das Gebäude schien völlig verlassen.
»Hier entlang.«
Rei blickte auf, als er die Stimme hörte. Aoki, der am Absatz einer von einem Nachtlicht schwach beleuchteten Treppe stand, winkte ihm, näher zu kommen.
Das Zimmer in der dritten Etage, in das Rei von Aoki geführt wurde, war leer. Es schien eine Art Fensterfront zu geben, vor der, wenn man genau hinsah, ein schwarzer Vorhang aus dickem Stoff bis zum Boden herabhing. Da es im Zimmer kein Licht gab, war es hier noch dunkler als im Flur, und es dauerte einige Sekunden, bis Rei bemerkte, dass vor dem Vorhang eine Bank stand, auf der ein Mann saß. Aoki brachte aus einer Ecke einen Stuhl, den er krachend in der Mitte des Raums abstellte. Rei setzte sich, und Aoki zog sich bis an die Wand zurück. Daraufhin begann der Mann zu sprechen.
»Hyodo hat mir schon einiges erzählt. Mein Name ist, sagen wir, Kariya ... «
Der Mann sprach mit einer leisen, aber weit tragenden Stimme. Rei sah ihn an. Er stützte sich mit den Ellbogen auf seine leicht geöffneten Knie und sein Kinn ruhte auf den gefalteten Händen. Seine Haare waren ganz nach hinten gekämmt, was für einen politischen Aktivisten eher selten war. Seine breite Stirn und seine Hände wirkten ungewöhnlich weiß, was aber vielleicht an seiner tiefschwarzen Kleidung lag. Der Blick des Mannes war auf den Fußboden unmittelbar vor Rei gerichtet, aber seine Augen lagen so tief in ihren Höhlen, dass Rei sie nicht genau sehen konnte.
»Los, rede«, fuhr der Mann, der sich Kariya nannte, ohne die geringste Regung fort.
»Moment mal«, unterbrach Rei ihn. Um sich Mut zu machen, atmete Rei tief durch und konzentrierte alle Kraft in seinem Bauch. »Wenn ich hier mit Informationen rausrücken soll, musst du mir auch etwas erzählen. Das ist meine Bedingung. Ich habe kein Interesse, mich in eure inneren Angelegenheiten einzumischen. Es reicht also, wenn du nur über die Sachen redest über die du auch reden darfst.« Nach den ersten paar Worten hatte Rei schnell zu seinem gewohnten Redefluss gefunden. Rei fand, dass ihm das gut gelungen war, aber Kariya fuhr in einem Ton fort, der den Eindruck erweckte, als ob er Rei überhaupt nicht gehört hätte.
»Los, rede...«
Reis Mine versteinerte sich, weil er glaubte, in der Haltung des Mannes die für Parteiaktivisten typische Arroganz und Selbstgefälligkeit zu erkennen. Der Mann zeigte keinerlei Anstalten, auf Reis Reaktion Rücksicht zu nehmen und fuhr unbekümmert fort.
»Was hast du in jener Nacht gesehen?«
Was hast du in jener Nacht gesehen ... Rei hörte, wie diese Worte, begleitet von einem Deä vu Gefühl, immer und immer wieder in seinem Kopf ertönten, und er haderte mit seinem unerbittlichen Schicksal. Als erster hatte Gotoda ihm diese Frage gestellt, als nächster Aoki. Und jedes mal musste Rei dabei ein ganz unvernünftiges Schuldgefühl ertragen, das sich im Inneren seines Herzens ausbreitete. Aus irgendeinem Grund konnte Rei es niemandem erzählen. Und jetzt fragte auch dieser Mann wieder danach.
Der Mann hob seinen Kopf, löste die verschränkten Hände und stand mit einer Bewegung von der Bank auf, die der Idee der Schwerkraft Hohn zu sprechen schien. Er war überraschend groß, viel größer, als Rei es dieser zusammengekauerten Gestalt auf der Bank zugetraut hätte, aber dieser Eindruck kam von seinen ungewöhnlich langen Armen und Beinen. Irgend etwas war an ihm anders. Dieser Mann namens Kariya besaß die Gestalt eines Menschen und unterschied sich doch auf subtile, aber entscheidende Art und Weise von einem ebensolchen.
»Du musst es gesehen haben. Das Wesen, das von diesem Mädchen getötet wurde ... «
Als Rei das hörte, versteifte sich sein Körper plötzlich, als ob ein elektrischer Schlag ihn getroffen hätte. Rei öffnete reflexartig den Mund, um etwas zu antworten, aber heraus lediglich ein rauer Atemstoß in der Art eines Keuchens. Der Mann trat vor und sah dabei auf Rei hinab, der sich auf seinem Stuhl unbeholfen wand.
»Dieser Kripobeamte, der sich Gotoda nennt ... Wer ist er, was weiß er alles und wieso schnüffelt er herum?«
Als der Mann immer näher kam, konnte Rei sehen, dass seine Augen wie bei manchen Arten von nachtaktiven Tieren leuchteten, indem sie das schwach einfallende Umgebungslicht reflektierten. Unwillkürlich wandte Rei seinen Blick ab und sah hilfesuchend zu Aoki hinüber, der an der Wand stand. Aoki lehnte mit dem Rücken an der Wand, hatte die Arme locker zusammengeschlagen und den Blick zu Boden gerichtet. Seiner Miene war in keiner Weise anzumerken, dass hier unmittelbar vor seinen Augen ein Freund in Bedrängnis geraten war. Dieses Gesicht war in jeder Hinsicht nicht mehr das Gesicht des Freundes, den Rei einmal gekannte hatte. Rei überkam ein Gefühl von Ohnmacht und Verzweiflung, als ihm klar wurde, dass er hier in eine Falle getappt war.
»Los, rede! Sag alles, was du weißt!«
Auf einmal war der Mann so nahe, dass er Reis Knie berührte.
Er starrte Rei jetzt offen und urverwandt in die Augen. Es waren die Augen, die Gotoda als böse bezeichnet hatte. Als Rei von dem Mann an der Schulter gepackt wurde, durchlief seinen Körper ein Gefühl, als ob er sich gleich in die Hose machen müsste, und seine in Abwehrhaltung verkrampften Muskeln entspannten sich wie bei einem heißen Bad. Dieser Zustand unterschied sich jedoch von dem der Lähmung. Es war mehr ein Gefühl, als ob seine Sinne aufs Äußerste geschärft wären und zugleich seine Seele seinen Körper verlassen hätte, um ihn von außen zu betrachten.
Vor Reis Augen hoben sich die dünnen Lippen des Mannes in den Mundwinkeln und ein murmelndes Lachen ertönte. Der Mann kniete sich auf den Boden, tat so, als ob er Reis linke Hand hochhalten wolle und zog ihn dann zu sich hin. Rei spürte, wie die Finger des Mannes, die ebenso sehnig und gelenkig wie die eines Streichmusikers waren, über seine Handgelenke glitten. Reis Armbanduhr fiel zu Boden. Mit leicht geneigtem Kopf näherte sich der Mund des Mannes einer Vene, die unter der Haut von Reis Handgelenk deutlich hervortrat. Rei betrachtete die Szene wie unbeteiligt. Das letzte, was Rei vor Augen hatte, war nicht das Gesicht seiner schreienden und weinenden Mutter und auch nicht die ratlosen Gesichter von Murasakino und den anderen. Es war Gotodas Gesicht, das wie immer an einen verschüchterten, herrenlosen Hund erinnerte. Der Kerl hatte Rei in die Sache hineingezogen, und jetzt konnte er ihn nicht mehr gebrauchen. Während Rei unter Verdrängung seiner eigenen Fahrlässigkeit Gotoda verfluchte, schloss er gefasst wie ein Grundschüler bei einer Schutzimpfung die Augen.
Eins, zwei, drei ... Rei zählte die Sekunden, aber der erwartete scharfe Stich ließ auf sich warten. Der Mann hatte seine Glasmurmelartigen Augen zur Decke gerichtet und blieb regungslos. Seine Miene war merkwürdig entspannt, und der bis eben noch vorhandene dämonische Ausdruck wie weggewischt. Sein Unterkiefer klaffte ein klein wenig auf. Als Rei erschrocken seinen Blick zu Aoki hinüber wandte, war auch der wie erstarrt und zeigte eine Miene, als ob er nach irgend etwas weit Entferntem lauschte. Es war ein unheimliches Gefühl, so als ob für alle außer Rei die Zeit stehengeblieben sei. Plötzlich regte sich der Mann, ließ mit einer wegwerfenden Bewegung Reis Arm fallen, stand auf und ging dann mit schnellen Schritten aus dem Zimmer. Aoki folgte ihm.
Die Schatten der beiden entfernten sich, und Rei, der eher völlig ratlos als erleichtert war, versuchte aufzustehen, aber seine Beine verhedderten sich und er stürzte. Rei hielt seine wie bei einem Krampfanfall zitternden Knie fest und stöhnte, aber ein Geruch nach kaltem Rauch, der vom Fußboden in seine Lungen strömte, ließ sein gelähmtes Bewusstsein rasch Wiedererwachen.
Von nebenan hörte er das Getrampel von mehreren, sich im Laufschritt nähernden Personen. Irgendwo war das Klirren von zerbrechendem Glas zu hören. Rei schnellte geradezu hoch und eilte nach draußen in den Flur. Von irgendwoher war eine große Zahl von Männern gekommen, die jetzt mit Eisenrohren und Stangen bewaffnet an Rei vorbeirannten und über die Treppe nach unten verschwanden. Es war klar, dass hier irgendeine Notsituation vorliegen musste, aber es war mehr als ungewöhnlich, dass keiner der Männer Rei beachtete, ja, dass noch nicht einmal einer von ihnen laut rief. Von der Treppe her war zu hören, wie unten ein Haufen zu einer Barrikade aufgetürmter Schließfächer umstürzte. Rei unterdrückte eine geradezu quälende Unruhe und versuchte fieberhaft, die Lage zu erfassen.
Es war ausgeschlossen, dass ein mobiles Einsatzkommando der Polizei ohne Ankündigung oder Warnung in ein besetztes Haus stürmen würde. Die Polizei musste ihrem Charakter nach öffentliche Aufgaben wahrnehmen, da war ein Überraschungsangriff gar kein Thema. Denkbar war deshalb lediglich der Überfall durch eine fremde Partei oder Fraktion, aber dann war unerklärlich, wieso die Leute gerade eben Rei als Außenstehenden nicht mal eines Blickes gewürdigt hatten. Rei schüttelte seinen Kopf und unterdrückte alle Fragen. Unter diesen Umständen war es sinnlos, sich in Gedanken zu verstricken. Die Lage war vorläufig unklar, aber nachdem er mit knapper Not diesem Kariya entflohen war, wäre es dumm, wenn er jetzt in einen Krieg zwischen zwei Fraktionen geraten würde und man ihm dabei den Schädel zertrümmerte. Rei entschied sich, dass Flucht seine einzige Option war, egal wer hier gerade angriff. Also lief er in die entgegengesetzte Richtung wie die Männer.
Als Rei die Haupttreppe des Gebäudes erreichte, schlüpfte er nach kurzem Zögern durch die dort aufgerichteten Barrikaden und begann, die Treppe hinabzusteigen. Es wäre auch möglich gewesen, sich in ein geeignetes Zimmer zu flüchten und dort zu verstecken, aber falls die Angreifer die Oberhand behielten, bestand die Möglichkeit, dass sie ihn dort aufspürten und windelweich prügelten. Und falls die Verteidiger Siegreich blieben, hätte er damit eine günstige Gelegenheit :zur Flucht vertan. Rei wollte so schnell wie möglich aus dieser Bruthöhle für Monster wie diesen Kariya entkommen. Mit großen, beinahe fliegenden Schritten nahm Rei auf dem Weg nach unten jeweils mehrere Stufen auf einmal, blieb aber auf einem Absatz der Treppe wie angewurzelt stehen. Als Rei sah, wie unter ihm Saya mit ihrem wehenden Rock auf dem Flur der zweiten Etage erschien, unterdrückte er einen Schrei und warf sich zu Boden. Auf allen Vieren und so schnell wie möglich kroch er zappelnd die Treppe, die er eben nach unten gekommen war, wieder hinauf. Beinahe hätte der Schreck ihn vollständig gelähmt. Rei verfluchte sein unglückseliges Schicksal, das ihn ausgerechnet hier unter diesen Umständen auf Saya treffen ließ, und am liebsten hätte er mit lauter Stimme geheult und geschrien. Aber natürlich konnte er es sich jetzt nicht leisten, starr vor Schreck zu sein oder herum zu heulen. Seinen letzten Überlebenswillen auf bringend, rollte er sich auf den Flur der dritten Etage und verkroch sich in den Schatten der Barrikade.
Vor dem völlig von Schweiß durchnässten und sich mit unterdrücktem Atem verbergenden Rei erschien Saya. Sie trat einen Schritt in den Flur, wobei sie den Kopf leicht anhob, die Augen zusammenkniff und so wirkte, als ob sie ihre Aufmerksamkeit irgendwo in die Ferne richtete, um etwas aufzuspüren. In diesem Moment erschien hinter Sayas Rücken plötzlich ein Mann, der sie mit einem hoch erhobenen Eisenrohr angriff. Saya führte die rechte Hand an den Knauf der Schwertscheide aus Holz, den sie in der linken Hand hielt und führte einen präzisen, wie vorausberechneten Stoß hinter sich, der die Magengrube des Mannes traf.
Der Mann wurde zurückgeschleudert, als ob er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen sei, und stürzte die Treppe hinunter, wodurch er aus Reis Blickfeld verschwand. Saya drehte sich nicht nach ihm um, ja sie änderte noch nicht einmal die Geschwindigkeit. Mit einem Schritt, der vermuten ließ, dass sie den Aufenthaltsort ihrer Beute aufgespürt hatte, setzte Saya dann ihren Weg über die Treppe in Richtung Dach fort und verschwand. Rei kroch aus seinem Versteck in der Barrikade hervor und spähte die Treppe hinunter. Auf dem nächsten Absatz lagen drei Männer übereinander. Die beiden Unteren waren offenbar von dem Stürzenden mitgerissen worden.
Rei spitzte die Ohren und lauschte nach unten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass all diese Männer von Saya allein besiegt worden waren und von der Atmosphäre des Kampfs, die eben noch geherrscht hatte, war nichts mehr zu spüren. Wenn er von hier fliehen wollte, dann war jetzt, wo Saya an ihm vorbeigegangen war, der richtige Zeitpunkt. Das dachte Rei zumindest, aber er konnte nicht einfach von hier fortgehen. Wenn Saya hier eingedrungen war, konnte ihr Angriff nur ein einziges Ziel haben. Diesen Kerl namens Kariya. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Aoki an Kariyas Seite aufhielt, war extrem hoch. Vielleicht gab es keinen Grund, weshalb Saya Aoki unbedingt töten musste, aber was, wenn Aoki unter Einsatz seines Lebens versuchen würde, Kariya zu beschützen? Rei konnte den Blutdurst nicht vergessen, mit dem Sayas Blick ihn in jener Nacht durchbohrt hatte.
Rei wusste, dass er ein ziemlicher Feigling war, ab er war keineswegs selbstbewusst genug, Aoki hier im Stich zu lassen, wegzurennen und für den Rest seines langen Lebens mit der Wahrheit und dem Vorwurf zu leben, ein echter Feigling zu sein. Rei hob ein Eisenrohr vom Boden auf. Ihm war völlig klar, dass er damit keine Chance gegen Sayas unglaubliche Schwerttechnik hatte. Davon hatte er sich eben noch mit eigenen Augen überzeugen können. Aber ganz ohne Waffe in einen potentiell tödlichen Kampf zu gehen, erschien ihm irgendwie ungenügend. Als Rei die Treppe hochstieg und Saya nach oben folgte, wünschte er sich, dass er wenigstens so etwas wie eine Maschinenpistole gehabt hätte.
Die Sonne war schon untergegangen und das Flachdach des Gebäudes in Dunkelheit gehüllt. Noch nicht einmal ein Nachtlicht gab es hier. Allein mit dem schwachen Licht als Orientierungshilfe, das aus den Fenstern des angrenzenden Gebäudes drang, hockte Rei sich nieder und sah sich nach allen Seiten um. Weil es im Inneren des Gebäudes dunkel gewesen war, gewöhnten sich seine Augen auch hier schnell an die Finsternis. Als Rei der beiden Gestalten gewahr wurde, die sich erschreckender weise gar nicht weit von ihm entfernt gegenüberstanden, hielt er den Atem an. Die Gestalt mit dem im Nachtwind flatternden Rock war Saya. Die Gestalt weiter hinten war aufgrund ihrer ungewöhnlichen Silhouette unschwer als Kariya zu erkennen.
Saya stand ganz leicht schräg zu Kariya. In ihrer Linken hielt sie die Schwertseheide aus Holz, die sie von der leicht gebeugten Hüfte aus hinter ihren Rücken streckte, um sie vor Kariya zu verbergen. Selbst Rei, der vom Schwertkampf überhaupt keine Ahnung hatte, erkannte, dass es sich hierbei um das sogenannte Iai handelte, womit eine spezielle Bereitschaftshaltung gemeint war, aus der man mit dem Schwert in einer Bewegung blankziehen und einen Hieb führen konnte.
Demgegenüber stand Kariya einfach nur so da,auch er allerdings völlig regungslos. Und unbewaffnet. Unverständlich war, weshalb eine so meisterliche Schwertkämpferin wie Saya den unbewaffneten Kariya nicht einfach angriff, aber die ganz ungewöhnliche Aura von Blutdurst, welche die Szenerie beherrschte, war ausreichend, um Rei einzuschüchtern. Er wollte sich entlang des Dachaufbaus, der hinter ihm verlief, zurückziehen, als seine Füße an irgend etwas hängenblieben und er nach hinten umfiel. Die Eisenstange fiel mit einem lauten Krach zu Boden. Für einen kurzen Moment blickte Saya sich hinter ihren Rücken um, und diesen Moment nutzte Kariya, um aktiv zu werden. Er täuschte einen Angriff vor, um Sayas folgendem Hieb mit einem Ausfallschritt nach hinten knapp auszuweichen, um mittels seiner langen Arme und Beine einen Satz wie bei einer Rolle rückwärts zu vollführen und anschließend auf dem Eisengeländer zu landen, das den Rand des Flachdachs umgab. Kariyas trockenes Lachen war undeutlich zu hören, und Saya, die ihr bleiches Gesicht verzog, ließ die Spitze ihrer Klinge zu Boden sinken, als ob sie die Lust zum Kämpfen verloren hätte. Rei, der am Boden lag und die Szene beinahe geistesabwesend betrachtete, konnte nicht wissen, dass Kariya in dem Moment, als er sich zur Flucht entschlossen und der Reichweite von Sayas Schwert entkommen war, das Duell bereits für sich entschieden hatte. Wenn Saya sich jetzt auf ihn zu bewegte, um die Lücke zu schließen, würde er einfach hinunterspringen und davonlaufen. Ein normaler Mensch hätte keine Chance, diesen Sturz zu überleben, aber mit den übermenschlichen körperlichen Fähigkeiten, die Kariya eben erst gezeigt hatte, war es durchaus möglich, an Fenstern oder Lüftungsrohren entlang nach unten zu gleiten.
Aber das tat Kariya nicht. Auf dem Geländer stehend öffnete er seine Knie, beugte sich nach vorne und streckte seine langen Arme wie die Schwingen eines Vogels nach hinten aus. Mit einem unangenehm knirschenden Geräusch lösten sich seine Schultern und beide hinter dem Rücken verschränkten Arme begannen, sich in einem aberwitzigen Winkel zu falten und knicken. Zugleich trat schlagartig der Brustkorb hervor, so dass die Kleidung zerriss und unter der gedehnten Haut die einzelnen Rippen hervortraten. Die Haut verschwand aus dem Gesicht, die weit geöffneten Augen und der Oberkiefer wurden entblößt, die Ohrläppchen verdrehten sich und aus dem aufgerissenen Mund wuchsen Fangzähne.
Es war ein Vorgang, dem ein irgendwie noch stimmungsvoll klingendes Wort wie »Verwandlung« nicht annähernd gerecht wurde. Was hier geschah, war eine äußerst unheilverkündende Metamorphose.
Die Veränderungen blieben aber nicht nur auf die Gestalt beschränkt, sondern betrafen auch die Haut am gesamten Körper. Die angespannte Haut verlor rasch ihre Lebenskraft, verfärbte sich bläulich-schwarz, und am stark nach innen gewölbten Bauch bildeten sich hässliche Falten. Schließlich, wie um dieser grotesken Transformation eine Krone aufzusetzen, spalteten sich die Unterarme krachend der Länge nach in zwei Teile, und aus dem Spalt erwuchs eine dünne Haut, die sich bis zum Rumpf ausdehnte und so eine Art Flughaut bildete. Die drei mittleren Finger jeder Hand wuchsen nach innen und verwandelten sich in Klauen.
Wenn man das Aussehen dieses Wesens partout mit etwas vergleichen wollte, dann teils mit einer riesigen, mit Gleithäuten ausgestatteten Ratte, teils mit einer verwunschenen menschlichen Bestie, deren Knochengerüst nur noch vage an das eines Menschen erinnerte. Eine Verwechslungsgefahr mit einem streunenden Hund oder gar einem Menschen bestand hier nicht im geringsten.
Rei, der nach seinem Sturz immer noch wie gelähmt vor Schreck auf dem Boden lag, flüsterte immer wieder Etwas vor sich hin. Das war es. Es war das Etwas, die Leiche, die Rei in jener Nacht gesehen hatte. Diese riesigen, mit Klauen bewehrten Schwingen, die man zusammengefaltet und in den schwarzen Sack geschoben hatte. Dieses etwas, das zu irreal war, um irgend jemand davon erzählen zu können und zu Alptraumhaft, um es jemals vergessen zu können. Und dieser Alptraum war nun vor Reis Augen erneut zur Realität geworden.
Eine Windböe kam auf, und Saya nutzte die Gelegenheit, um plötzlich zuzuschlagen. Mit dem Schwert an ihrer rechten Seite und leichten Schritten, wie als ob sie über Wasser ginge, hatte das Mädchen augenblicklich die Distanz zu der Bestie überbrückt. Deren Schwingen blähten sich im Wind und breiteten sich geräuschvoll aus. Mit dem gesenkten Schwert führte Saya einen kraftvollen Hieb nach oben, aber als die Klinge auf das Eisengeländer traf und die Funken stoben, hatte die Bestie bereits abgehoben. Dann legte sie sich einmal auf die Seite und verschwand aus Reis Sichtfeld, tauchte nach einem Moment wieder auf und verschwand mit einem einzigen Flügelschlag in der Dunkelheit. Welch eine elegante Flucht. Jetzt war nur noch der Wind zu hören, fast als ob es diese merkwürdige Szene eben und den Kampf niemals gegeben hätte.
Saya blieb einen Moment stehen und starrte in die Richtung, in welche die Bestie davongeflogen war. Dann warf sie einen flüchtigen Blick auf die Klinge ihres Schwerts und wandte sich mit einem enttäuschten Zungenschnalzen um. Mit leisen Schritten ging sie zu der weggeworfenen Schwertseheide aus Holz und hob sie auf. Ein metallisch klickendes Geräusch war zu hören und Rei, der wieder klaren Verstandes war, bemühte sich verzweifelt, auf die Beine zu kommen. Erst jetzt bemerkte er, dass hier Aoki lag, über den er vorhin offenbar gestolpert war. Während er noch zauderte, ob er Aoki wecken oder einfach nur fliehen sollte, stand Saya schon unmittelbar vor ihm. Diesmal würde sie ihn töten. Es war das zweite Mal, und dieses Mal war er nicht nur einfach ein Zeuge. Ohne durch die von Rei verursachte Störung hätte Sayas Beute keine Chance gehabt. Und wenn doch, würde das auch keinen Unterschied machen. Es genügte ja, wenn Saya davon überzeugt wäre, dass es so sei. Sie würde es ihm nicht durchgehen lassen. Niemals. Zum zweiten Mal an diesem Tag schloss Rei mit seinem Leben ab und schloss die Augen. Eins, zwei, drei ... zählte er stumm vor sich hin. Als er bei sechs angelangt war, erfasste ihn ein winziger Schimmer Hoffnung, und er öffnete seine Augen einen Spalt weit. Saya stand da und sah auf ihn hinab. Der kalt auflodernde Blutdurst, den er in jener Nacht in ihrem Blick gespürt hatte, war erloschen, und sie sah ihn an, wie man einen Hund am Straßenrand ansieht. Genau, ich bin ein Hund. Nur ein Hund am Straßenrand, der es nicht wert ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Nein, besser noch, ich bin ein Hund, den man ausgesetzt hat, ein armer kleiner Welpe ... So dachte Rei mit verzweifelter Inbrunst, als er Saya anstarrte. Könnte ich mich nur in einen Welpen verwandeln und mit dem Schwanz wedeln ... Aber im Augenblick als Rei das dachte, machte ein Aufblitzen der Schwertscheide seine törichten Phantasien zunichte.
VIERTER TEIL
Rei wachte mit einen Stöhnen auf. Er erkannte, dass er sich auf der Rückbank eines fahrenden Autos befand und versuchte, sich aufzurichten, aber im selben Augenblick, als er begann, sich auf dem verschwenderisch tiefen Sitz zu winden, durchschoss ein heftiger Schmerz seinen Kopf und raubte ihm alle Kraft. Rei griff sich an die Stelle am Hinterkopf, wo Sayas Schlag ihn getroffen hatte, und stöhnte erneut.
»Na, aufgewacht?«
Rei blickte nach vorne in die Richtung, aus der die Stimme kam und erlebte eine bittere Enttäuschung. Auf den Vordersitzen saßen die beiden Ausländer, die gewöhnlich Saya begleiteten. Der jüngere der beiden, der die Leiche eingesammelt hatte, steuerte den Wagen. Auf dem Beifahrersitz saß der hochgewachsene Ältere. Er hatte Rei angesprochen. Eigentlich hatte Rei niemand anderen erwartet, ja, er hatte sich noch nicht einmal gewünscht, zu Hause in seinem Bett aufzuwachen, aber die Tatsache, dass er im Auto dieser beiden Männer saß, war Beweis genug, dass diese verfluchte Nacht für ihn noch nicht zu Ende war.
»Es wird noch eine Weile weh tun. Saya ist eben nicht so rücksichtsvoll wie ich«, fuhr der Mann fort.
»Ich habe eine dicke Beule!« beschwerte sich Rei nach Kräften über seine Lage, während er die Schwellung an seinem Hinterkopf betastete.
»Dank dieser Beule musst du keine bleibenden Schäden befürchten. Saya hat dir mit einem Schlag auf den Hinterkopf das Bewusstsein geraubt, ohne dir lebensgefährliche Verletzungen wie einen Schädelbruch oder eine Hirnblutung zuzufügen. Das sind fortgeschrittene Methoden, so was will gekonnt sein.«
Das klang so, als ob Rei sich noch bei Saya bedanken sollte.
Als Rei sich angewidert nach hinten sinken ließ, bemerkte er zum ersten Mal, dass auf der Rückbank neben ihm noch jemand saß.
»Hi, wie geht's«, murmelte der halb in dem luxuriösen Ledersitz versunkene Mann, während er gedankenverloren nach vorne schaute. Es war Gotoda.
»Was machst du denn hier?!« fragte der eher verblüffte als
erschrockene Rei.
»Sie haben mich geschnappt. Genau wie dich.« »Wie? Hast du mich etwa beschattet?«
»Als ich gesehen habe, wie du in Begleitung dieses Aoki in das besetzte Haus gegangen bist, war ich unter Zugzwang. Das kommt eben dabei raus, wenn Amateure Mist bauen.«
»Und dann?«
»Als Polizist kann ich schlecht einfach so in ein besetztes Haus spazieren. Aber während ich noch in Verlegenheit war, was ich tun sollte, hat diese Braut schon ihren Angriff gestartet. Ich wollte das Chaos beim Angriff ausnutzen, um dich da rauszuholen, aber leider bin ich drinnen auf die beiden Kerle hier getroffen. Das war's«, schloss Gotoda in nüchternem Ton seine Erklärung ab.
»Ich dachte, du wärst ein Bulle?« Gotoda war also doch nicht zu gebrauchen. Mehr aus einem Gefühl des Elends als aus Verärgerung heraus griff Rei ihn an.
»Mit einer Polizeimarke kommt man nicht gegen eine Pistole an«, antwortete Gotoda gelassen. »Ich habe meine Grundsätze. Dazu gehört, dass ich mich nicht mit Gegnern anlege, die eine Schusswaffe haben.«
»Tut mir leid, wenn ich die Herrschaften bei ihrer Unterhaltung störe«, mischte sich der ältere Mann ein. »In den Sitztaschen befinden sich Augenbinden. Und denkt daran, es wird nicht geschummelt. Ihr erspart mir damit, dass ich zu fortgeschritteneren Methoden greifen muss.« Der Mann auf dem Fahrersitz schien sich vor Lachen zu schütteln. Selbstverständlich war Rei nicht zum Lachen zumute, es machte ihn einfach nur zornig, wenn Leute ihre Überlegenheit so zur Schau stellten. Aber er hatte auch keine Lust, weitere Schläge zu riskieren.
Rei und Gotoda taten, wie ihnen geheißen worden war und holten die Augenbinden aus den Sitztaschen. Kurz bevor Rei die Maske anlegte, warf er noch einen Blick durch die getönten Scheiben nach draußen, aber der Wagen schien auf einer Autobahn zu fahren und die vorbeiziehende Landschaft kam Rei nicht bekannt vor.
»Aoki hat gesagt, dass schon sechs von seinen Leuten getötet wurden«, flüsterte der um seine Sicht beraubte Rei.
»Na und«, antwortete Gotoda.
»Von drei Leuten sind die Leichen aufgetaucht, aber woher wusste er, dass auch die anderen drei ermordet wurden?«
»Weil die Kerle sie selbst umgebracht haben«, antwortete Gotoda im Ton der Gewissheit und fuhr dann fort. »Vielleicht haben sie sich nicht persönlich die Hände schmutzig gemacht, aber als Komplizen waren sie allemal beteiligt.«
Ja, wird wohl so sein.« Die Morde waren wohl von diesem Monster namens Kariya begangen worden, und nach der Art und Weise, wie Aoki Rei an Kariya ausgeliefert hatte, war Aoki zweifellos ein Komplize. Reis Stimmung verschlechterte sich, als ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging. Er hatte bemerkt, dass mit Aoki irgend etwas nicht stimmte, es aber auf das egozentrische Gehabe geschoben, das für Parteileute so typisch war. In gewissem Sinne war Aoki ja selbst nur ein Opfer. Zumindest wollte Rei das zu gern glauben. Ansonsten hätte man ja schon viel früher auf die Möglichkeit kommen müssen, dass die Gründe für die Mordserie an den Mitgliedern einer bestimmten politischen Gruppierung im Inneren der Gruppierung selbst zu suchen waren. Für Rei war die Erkenntnis, dass Aoki mehr als nur ein einfaches Opfer sein musste, einfach niederschmetternd.
»He, lass dich nicht so hängen ... Du bist noch nicht in dem Alter, wo man an seinen Freunden zweifeln sollte«, murmelte Gotoda, als ob er Reis Stimmung erraten hätte.
»Seit wann hast du es gewusst?«
»Seit ich in eurem Versammlungsraum war. Ich habe dich ja gewarnt.«
»Aber nur mich.«
»Manche Sachen kapiert eben nicht jeder. Und manche kapieren es zwar, wollen es sich aber einfach nicht wahrhaben. Das ist unangenehm, aber nicht zu ändern ... Die Menschen sind nun mal so.«
»Von was redest du?«
»Von was wohl«, antwortete Gotoda genervt. »Ich rede von dem Monster, dem du jetzt schon zweimal begegnet bist.«
Rei richtete sich unwillkürlich auf, aber just in diesem Moment bremste das Auto und lenkte scharf ein, so dass Rei die Trägheit des Wagens voll zu spüren bekam und gegen den Vordersitz geschleudert wurde. Der Wagen schien sich in einer Autobahnausfahrt zu befinden.
»Entschuldigung, wenn ich die Herrschaften beim Plaudern störe ...«, mischte der ältere der beiden Männer sich wieder ein. »Da ihr schon die Augenbinden aufhabt, seid doch so gut und haltet auch euren Mund geschlossen.« Die Ausdrucksweise des Mannes war freundlich und präzise, ließ aber einen Charakter durchschimmern, der keinen Widerspruch duldete. Gotoda, der zwar keinen Charakter besaß, es aber in Sachen Unverfrorenheit ohne weiteres mit ihm aufnehmen konnte, schoss zurück.
»Hat aber keiner gesagt, dass wir nicht reden dürfen.« »Doch, jetzt hab ich's gesagt.«
Rei und Gotoda schwiegen.
Nach ungefähr zehn Minuten Fahrt hielt der Wagen einmal an, bog dann scharf nach links ab und das Reifengeräusch veränderte sich. Es klang jetzt so, als ob sie auf einer Schotterstraße fuhren. Nach einigen Minuten weiterer Fahrt blieb der Wagen schließlich stehen und die beiden Männer ließen Rei und Gotoda aussteigen. Draußen war von den üblichen Stadtgeräuschen überhaupt nichts zu hören.
Auf der Fahrt hierher hatte Rei sich vorgestellt, dass man sie in die israelische Botschaft bringen würde. Natürlich war Rei nie in der israelischen Botschaft gewesen, aber die beinahe einschüchternde Ruhe, die hier an diesem Ort herrschte, ließ es unwahrscheinlich erscheinen, dass es sich um das Botschaftsgelände handelte. Rei atmete die frische Abendluft tief ein, und erkannte den Duft dicht gepflanzter Bäume. Er schien sich im Vorgarten eines großen Anwesens zu befinden.
»Ihr nehmt die Augenbinden bitte erst ab, wenn ich es euch sage. Ansonsten ... «
»Fortgeschrittene Methoden, schon klar«, sagte Gotoda genervt.
Das ein oder andere Mal gerieten Rei und Gotoda an Stufen ins Straucheln, aber schließlich gelangten sie unter der Führung der beiden ins Innere eines Gebäudes. Dem Trittgeräusch ihrer Schuhe nach zu urteilen, mussten die Räume hier sehr hohe Decken haben. Es roch nach Parkett und Holztäflung und allerlei Blumen und mehr. Eine Unmenge edler Düfte erfüllte die Luft. Nachdem man sie solange herumgeführt hatte, dass sie vermutlich sogar ohne Augenbinde inzwischen die Orientierung verloren hätten, durften Rei und Gotoda schließlich stehenbleiben.
»Dürfen wir die Augenbinden jetzt abnehmen?« fragte Gotoda. »Es tut mir Leid, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe. Sie dürfen die Augenbinden jetzt abnehmen.«
Irritiert von der ihnen unbekannten Stimme nahmen Gotoda und Rei ihre Augenbinden ab. Die ungewohnte Helligkeit im Raum ließ sie blinzeln. Reis Wissen über Architektur waren nicht gerade umfassend, aber dass dieser Raum außergewöhnlich luxuriös war, erfasste auch er auf den ersten Blick. Allein die hölzernen Säulen, Verstrebungen und Wandtäflungen waren lückenlos mit geschnitzten Darstellungen von Pflanzen aller Art verziert und ziemlich eindrucksvoll. Was Rei aber restlos in seinen Bann zog, war die unglaubliche Anzahl verschiedenster Tiere, mit der alle vier Wände ringsum großflächig
bemalt waren. Da gab es fleischfressende Raubtiere wie Tiger, Löwe, Leopard, Gepard und Wolf, aber auch Pflanzenfresser wie Gazelle, Elefant, Zebra, Schaf, Bison, Kamel, Elch, Giraffe und vieles mehr. Hinzu kamen Primaten wie Gorillas, Orang Utans, Schimpansen und Paviane. Selbst Beuteltiere wie das Känguru oder der Beutelwolf waren vertreten, auch Nagetiere wie Eichhörnchen, Riesenflughörnchen, Lemming und Wasserschwein, nebst Flossenfüßlern wie Robben und Seehunden und am Ende sogar Tiere, die nicht genau zuzuordnen waren, etwa der Ameisenbär, das Gürteltier, das Schnabeltier oder das Schuppentier. Sie alle waren hier aufs farbenfrohste und mit sorgfältiger Pinselführung dargestellt. Und das war noch nicht alles. An der Decke, die sich mit einer sanften Wölbung über die Köpfe spannte, tanzten Vögel in Schwärmen unterschiedlicher Größe vor einem prachtvollen Himmel wild durcheinander, und der Holzboden unter ihren Füßen war erschöpfend mit Intarsien geschmückt, welche unzählige Arten von Fischen abbildeten.
»Stark«, murmelte Rei und war dann stumm vor Staunen. Die an den Wänden angeordneten wilden Tiere, die an der Decke schwebenden Vögel, die im Fußboden eingearbeiteten Fische ... Dieser Raum war nichts anderes als ein dreidimensionales Panorama der irdischen Fauna. Wie viele Monate wohl eine Schar exquisiter Maler benötigt hatte, um eine solche Pracht zu schaffen? Und was das alles gekostet haben musste. Schon allein beim Gedanken daran konnte einem in diesem Zimmer schwindlig werden. Es war unklar, welche Absichten der Auftraggeber dieses Werks verfolgte, aber zweifellos war hier ein ganz eigentümlicher Raum geschaffen worden, dessen Erhabenheit beinahe an eine Kapelle erinnerte.
»Beeindruckend. Ein Raum wie ein naturkundlicher Bildband ... Kinder hätten hier bestimmt ihre helle Freude«, sagte Gotoda, der das Ganze eher sachlich betrachtete. »Bedauerlicherweise habe ich noch nie Kinder in diesen Raum eingeladen. Aber wollen Sie sich nicht setzen?«
Rei, der endlich wieder zu sich kam, wandte sein Gesicht dem Sprecher zu. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch aus Holz, der ebenfalls Pflanzen nachempfunden war. Um den Tisch herum waren drei Stühle mit Rückenlehnen aufgestellt. Ebenso wie der alte Mann, der auf einem der Stühle saß, wirkten diese Möbel wie eine Art Minimalausstattung, um die atmosphärische Wirkung des Raumes möglichst wenig zu stören.
Rei folgte der Bitte und nahm Platz. Dann betrachtete er den alten Mann vor sich, der dem Anschein nach kein Japaner war. Er sprach zwar fließend Japanisch, aber seine Nationalität war nicht zu bestimmen. Er war von kleinem Körperbau und beinahe bis auf die Knochen abgemagert. Seine grauen Haare waren glatt gekämmt, er trug einen sehr förmlichen und korrekt wirkenden Anzug und sein Rücken war lang und gestreckt. Aus seinen Augen sprach ein beinahe furchteinflößender Intellekt, die Nase erinnerte an die eines Greifvogels und seine dünnen Lippen waren zu einem hartnäckigen Strich zusammengeschnürt. Er war das Idealbild eines alten Mannes, man könnte sagen, die Verkörperung dessen, was die meisten Männer im Alter wohl gerne wären. Seine Ausstrahlung drängte Rei schnell in die Defensive. Jemandem wie ihm konnten ein Mann um die vierzig, der wie die Schlampigkeit in Person daherkam, und ein junger Bursche, dessen einzige Stärke seine Frechheit war, auch im Team nichts entgegensetzen.
Ein Mann, der wie eine Art Butler aussah, eigentlich nichts anderes sein konnte und deshalb wohl auch einer war, kam herein. Begleitet vom Geräusch klirrender Gläser schob er einen Getränkewagen vor sich her. Der Mann, der so aussah, als ob er jeden Morgen die Zeitung und bei dieser Gelegenheit auch sich selbst bügelte, hielt neben dem Alten an, verbeugte sich kurz und öffnete dann mit einer eleganten Handbewegung eine Flasche Wein, aus der er eine kleine Menge in das Glas goss, das vor dem Alten stand. Der Alte verzichtete auf das Probieren und winkte kurz ab, woraufhin der Butler mit beinahe ungeduldiger Schnelligkeit die auf dem Tisch aufgereihten Gläser füllte.
»Kann ich einen Aschenbecher haben?«
Gotoda fragte in einem Ton, als ob er mit einer Bedienung in einem Café spräche. Der Butler runzelte kurz die Stirn, aber auf ein kurzes Nicken des Alten hin verbeugte er sich wiederum wortlos und verließ den Raum ohne den Wagen.
»Bitte trinken Sie«, forderte der Alte Rei und Gotoda auf, ohne selbst Anstalten zu machen, sein Glas in die Hand zu nehmen. Was Wein betraf, so hatte Rei bislang nur Bekanntschaft mit »Akadama Portwein« gemacht, und er hatte dieses süßlich klebrige Zeug gehasst. Er wollte viel lieber Bier als Wein trinken, und wenn man schon dabei war, etwas zu beißen hätte er auch gerne gehabt. Die Riesenportion Curryreis vom Mittag war schon viel zu lange her. Sein Hungergefühl hatte bereits seinen Höhepunkt erreicht, als er in Ochanomizu in dem besetzten Haus herumgerannt war. Allerdings war hier nicht damit zu rechnen, dass der Alte für ihn eine Portion Schnitzel auf Reis anliefern lassen würde, wie Sportlehrer Kume das hin und wieder gerne tat. Abgesehen davon, dass dieser Ort alles andere als angemessen war, um ein angeliefertes Essen zu verdrücken. Rei gab die Idee also auf und begann Wein zu trinken.
Er spürte einen ganz leicht säuerlichen Geschmack und eine fast nicht wahrnehmbare Herbheit, aber im Moment als er den Wein heruntergeschluckt hatte, breitete sich in seiner Mundhöhle ein unbeschreiblicher Duft aus, der bis in die Nase reichte und von dort wieder auszutreten schien. Von der Speiseröhre bis zum Magenausgang wurde sein Inneres gänzlich von etwas Frischem durchdrungen. Rei kam zu dem Schluss, dass das ein ziemlich gutes Zeug war, abgesehen vielleicht davon, dass sich in seinem Magen ein Feuer entzündet hatte, das seinen Hunger noch verstärkte.
»Ein Bordeaux ... Wohl ein Lafite...«, murmelte Gotoda und Rei riss die Augen auf. Um ein Haar hätte er vor Überraschung dem Alten den Wein ins Gesicht geprustet. Wieso sollte ein Kerl wie Gotoda Ahnung von Wein haben? Wahrscheinlich bluffte er nur. Aber Rei entging nicht, dass der Blick, mit dem der Alte Gotoda ansah, sich ganz leicht veränderte. Diese Veränderung ging allerdings sogleich wieder in einem vagen Lächeln unter. Der Alte erhob das Wort:
Jetzt, wo Sie sich etwas entspannt haben, würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.«
»Moment mal«, sagte Rei und stellte sein Glas ab. Vielleicht lag es daran, dass der Wein seine Wirkung bei ihm getan hatte, jedenfalls erwachte in dem Augenblick, da klar war, dass es sich hier um ein Gespräch ohne Gewaltandrohung handeln würde, einmal mehr Reis anmaßendes Selbstbewusstsein gegenüber Älteren, das so etwas wie eine »Spezialnummer« und seine einzige Kunstfertigkeit darstellte. Natürlich waren die beiden Männer, die so gerne »fortgeschrittene Methoden« anwendeten, immer noch irgendwo hier im Gebäude, und der Alte könnte sie sicherlich jederzeit herbeizitieren, aber für den Augenblick waren sie hier allein. Also konzentrierte Rei alle Kraft in seinem Bauch und ging zum Angriff über.
»Zuerst möchte ich etwas wissen. Wenn ich eine Antwort darauf bekomme, bleib ich gerne bis morgen früh hier Gast.«
Gotoda entfuhr ein Ausruf des Erstaunens und seine Miene zollte Rei Anerkennung. Der Alte sah Rei fest in die Augen, setzte ein großzügiges Lächeln auf und sagte dann:
»Ich fürchte, in meinem Alter ist es nicht mehr möglich, Nächte durchzumachen. Aber gut, ich höre...«
»Ich wage gar nicht zu fragen, wo wir hier sind, aber ich will wenigstens wissen, wer du bist. Ein harmloser Bürger bist du jedenfalls nicht. Die entführen nämlich keine Minderjährigen und Polizeibeamte im Dienst.«
»Ist das alles?«
»Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich hab keine Ahnung, ob du der liebe Opa, der Boss oder der Manager von diesem gefährlichen Mädchen namens Saya bist, aber ich will etwas über sie wissen. Ich bin kein Experte in Schwertkampf oder Kampfsport, aber die Bewegungen, die sie bei dem Kampf in dem besetzten Haus gezeigt hat, waren irgendwie... übermenschlich. Und noch etwas ... Es ist nur ein Eindruck gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass zwischen ihr und dem Kerl, den sie umbringen wollte, eine Art Gemeinsamkeit bestand.«
»Natürlich...«
»Da wäre noch was. Was ist aus meinem Kumpel Aoki geworden? Als ich nach ihm sehen wollte, hat mich das Mädchen bewusstlos geschlagen. Ich möchte wissen, ob er noch am Leben ist.«
»War das alles?«
Rei zögerte. Da war noch etwas, was er unbedingt fragen wollte, unbedingt überprüfen musste, aber er zauderte.
»Wenn du fragen willst, dann jetzt«, spornte ihn Gotoda in einem sorglosen Ton an, während er gedankenverloren die Decke betrachtete. Rei leerte den restlichen Wein in seinem Glas in einem Zug und richtete dann seine Augen auf den Alten.
»Dieses Ding ... Ich meine, diese Leiche, die ich da gesehen habe... Und dieses Monster, das mich heute töten wollte und dann von Saya verjagt wurde... Was war das eigentlich?«
Als Rei es ausgesprochen hatte, kam es ihm geradezu lächerlich vor, dass er sich bisher so damit herumgequält hatte. Natürlich lag es auch daran, dass er davon ausging, dass alle hier Anwesenden die Sache als eine Tatsache anerkannten. Die Entdeckung, dass eine Sache, so sonderbar sie auch sein mochte, sich in dem Moment, in dem man sie aussprach, in eine einfache Tatsache verwandelte, die man hinterfragen konnte, war etwas überraschend Neues für Rei. Rei hatte sich in einer Lage befunden, in der nicht sicher war, ob er jemals lebend nach Hause kehren würde, aber jetzt fühlte er sich zum ersten Mal, seit er in diese Affäre geraten war, frisch und erleichtert. Der Alte lächelte zufrieden und goss Rei noch etwas Wein nach.
»Gut, fangen wir mit mir an. Bedauerlicherweise darf ich meinen Namen hier nicht preisgeben. Ich gehöre einer Nichtregierungsorganisation an, die man sich am besten als eine Art Stiftung vorstellen sollte. Ich bin für die Aktivitäten dieser Organisation hier in Japan verantwortlich. Natürlich bin ich weder der Großvater dieses Mädchens noch ihr Chef. Das Wort Manager kommt der Wahrheit vielleicht tatsächlich am nächsten. Allerdings glaube ich kaum, dass dieses Mädchen von sich selbst behaupten würde, dass sie irgend jemand managt. Und was deinen persönlichen Eindruck bezüglich des Mädchens betrifft, junger Mann... Man kann zwar nicht behaupten, dass du damit voll ins Schwarze triffst, aber zumindest kommt dein Eindruck dem Kern der Sache schon recht nahe. Allerdings glaube ich, dass die Wahrheit letztlich anders aussieht, als die Möglichkeiten, die du gerade in Betracht ziehst.«
»Ich für meinen Teil, hätte keine Fragen«, mischte sich Gotoda mit einem Ton ein, der die gemächliche Sprechweise des Alten nachzuäffen schien, aber der ließ sich nicht im geringsten aus dem Tritt bringen.
»Beim Verständnis der Dinge gilt es manchmal, eine Reihenfolge zu beachten. Dies gilt um so mehr bei Sachverhalten, die dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Meine Vorgehensweise mag ihnen weitschweifig und umständlich erscheinen, aber ich bitte um Verständnis dafür, dass ich sie mit dem, was ich erzählen werde, nicht unnötig verwirren will.«
»Und was ist mit Aoki?« Rei konnte spüren, dass die Sache sich lange hinziehen würde und drängte den Alten.
»Er ist am Leben. Beseitigt werden sollte nur der Herrscher, nicht das gemeine Volk. Dieser Aoki war lediglich ein Gefolgsmann. Zu unseren Grundsätzen gehört es, niemals unnötig Blut zu vergießen.«
Rei wollte fragen, was genau mit den Worten »Herrscher« und »Gefolgsmann« gemeint war, dachte dann aber, dass er jetzt ohnehin keine Antwort erhalten würde und schwieg.
»Dieses Mädchen ... Sie ist von Natur aus erbarmungslos, und neigt dazu, über die Stränge zu schlagen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass er verletzt wurde, etwa einen Knochenbruch davongetragen hat.« Als ob das belustigend sei, schüttelte der Alte sich leicht. Rei hatte am eigenen Leib erfahren, wie sie »über die Stränge« schlagen konnte. Wenn Aoki wirklich mit einem Knochenbruch davonkommen würde, wäre das mehr, als Rei zu hoffen gewagt hatte. Rei vergaß, in welcher Situation er sich befand und seufzte erleichtert. Bei dem ganzen Tumult vor Ort war er sicher, dass jemand einen Notruf gemacht hatte und auch ein Krankenwagen gekommen war.
»Also kommen wir zur letzten Frage.«
Gotoda, der in äußerst nachlässiger Haltung auf dem Stuhl lümmelte, blickte ein wenig auf.
»Die Sache, die du beobachtet hast...«
»Das hab ich nicht nur beobachtet, es hat mich beinahe umgebracht!« korrigierte Rei.
»Ich glaube nicht, dass es die Absicht hatte, dich zu töten ...
Wie dem auch sei. Es ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht bedenklich, dieses Wesen Monster oder Ungeheuer zu nennen. Der Grund ist ganz einfach. Es ist ein Mensch. Kein Homo sapiens, aber zweifellos ein Lebewesen aus der Familie der Menschenartigen in der Ordnung der Primaten.«
»Menschen wachsen keine Flügel und sie fliegen auch nicht.« »Mir wäre lieber, du würdest von Menschen sprechen, deren Arme sich in Flügel verwandeln, mit deren Hilfe sie gleiten«, berichtigte diesmal der Alte.
»Nun, wenn denn es unbedingt sein muss, wäre ich aus Respekt vor der Tradition unter Umständen bereit, sie als Vampire zu bezeichnen...«
Rei und Gotoda schwiegen, während der Alte seinen Mund verzog und ein merkwürdiges Lachen ertönen ließ. Der Butler von vorhin kam mit einem Tablett zurück, auf dem sich ein silberner Aschenbecher und eine Zigarettenschatulle befanden. Der Aschenbecher war ein handwerklich eindrucksvoll gearbeitetes Stück, um das sich eine Art Borte aus einem Efeu Muster rankte. Zweifellos war er nicht geschaffen worden, um darin die Asche einer Billigzigarette wie Gotodas Echo abzuklopfen. Es schien dem Geschmack dieses alten Mannes zu entsprechen, nicht nur den Raum mit Motiven von Pflanzen und Tieren zu verzieren, sondern auch allerlei Alltagsgegenstände.
Gotoda ließ sich nicht erst bitten, griff sofort nach der Zigarettenschatulle und zündete sich eine Zigarette mit einem ebenfalls silbernen Feuerzeug an, in das eine Libelle eingearbeitet war. Ein dezent aromatischer Duft verbreitete sich, und auch Rei geriet in Versuchung, diese Zigaretten zu probieren, überlegte es sich dann aber anders und kramte eine Long Peace aus der Tasche hervor. Gotoda und Rei rauchten gierig ihre Zigaretten, während der Alte, der offenbar weder dem Tabak noch dem Wein zusprach, ihnen schweigend zusah.
»Sie scheinen nicht allzu verwundert zu sein?« fuhr der Alte endlich fort.
»Die Vampire, die ich kenne, sehen anders aus!«
»Dann erzähle mir doch interessehalber, wie die Vampire so sind, die du kennst, junger Mann.« In Reis Schädel flackerten energisch Bruchstücke aus diversen Vampirfilmen auf, die er kannte. »Vampire sind groß, bleich und tragen schwarze Mäntel mit rotem Innenfutter. Sie sind adlig und leben in Schlössern oder Burgen, manche von ihnen sind auch schwul. Tagsüber schlafen sie in Särgen, nachts beißen sie jungfräulichen Schönheiten oder einfach nur Schönheiten in den Hals und saugen ihr Blut aus. Ihre Opfer sterben zunächst und werden dann selbst als Vampire wieder zum Leben erweckt. Wenn man ihnen einen Holzpflock ins Herz treibt, schreien sie auf und zerfallen zu Asche. Sie haben eine Abneigung gegen Kreuze, Knoblauch und das Tageslicht, manche verwandeln sich in Fledermäuse oder Wölfe, und solange man sie nicht umbringt, sind sie unsterblich und altern nicht.« Während Rei das einfach so daher sagte, war ihm die Plattheit, dessen was er sagte, bewusst geworden.
»War das alles?«
»Ich rede von Vampiren, die in Filmen vorkommen. Von Fiktion.«
»Allerdings. Das Produkt sexueller Phantasien vulgärer Filmproduzenten. Und der Roman von Bram Stoker, bei dem sich alle bedienen, ist ebenfalls nicht mehr als ein dümmliches Machwerk. Wie sieht es mit den volkstümlichen Legenden aus, bei denen sich Bram Stoker bedient hat?«
»Sie sind gut genährt, ihre Gesichter entweder rötlich oder dunkel, die meisten von ihnen sind Bauern, die nach ihrer Beerdigung aus den Gräbern kriechen und bei ihren Opfern auf die Gegend um das Herz zielen. Sehr häufig verwandeln sie sich in nachtaktive Tiere. Kurzum, es handelt sich um lokale Ausdrucksformen einer Rationalisierung des Alltagsphänomens Tod, in dem Bilder verwesender Leichen und der um ihre Gräber schleichenden Aasfresser eine Verbindung eingehen.« Gotoda sprach in einem nüchternen Tonfall, als ob er all das von einem Blatt ablesen würde. Er drückte seine Zigarette in dem zu guten Aschenbecher aus und fuhr dann fort: »Aber egal, was wir in den Vampiren sehen - das Produkt sexueller Phantasien der Unterhaltungsindustrie oder Legenden, die in einem historischen Prozess von einer informell minderbemittelten Bevölkerung zum Zwecke der Vereinheitlichung ihres Weltbildes geschaffen wurden - Es ändert nichts daran, dass es reine Phantasiegebilde sind, die in Wirklichkeit nicht existieren.«
Hier mischte sich der Alte wieder ein.
»Allerdings existieren tatsächlich Menschen, die man Vampire nennen könnte. Oder sollte ich genauer Blutsauger sagen Mit ihren fiktiven Artgenossen stimmen sie in drei Punkten überein. Erstens, sie saugen Blut, zweitens, sie sind empfindlich gegen ultraviolettes Licht und drittens, sie können ihr körperliches Erscheinungsbild verändern. Leider sind sie keineswegs unsterblich. Ihnen ist eine erstaunliche Langlebigkeit beschieden, aber ihre Alterung läuft einfach nur sehr langsam ab. Dem Tod können letztlich auch sie nicht entrinnen.•
»Dann leben sie also doch nicht ewig, sagte Rei beinahe enttäuscht.
»Die Unsterblichkeit ist nur eine absolute Idee. Weißt du, die Konzepte des Alterns und des Todes bilden ein Grundprinzip des Phänomens Leben. Wenn etwas nicht altert oder nicht stirbt, dann bedeutet das soviel, wie dass es nicht lebt. Sie mögen eigentümliche Wesen sein, aber man sollte niemals vergessen, dass es Lebewesen sind.«
»Dann lassen wir mal die Unsterblichkeit beiseite. Aber ich hab das Gefühl, dass diese drei Punkte, die du da aufgezählt hast, schon etwas mehr als nur eigentümlich sind.« Im Falle des ehrwürdigen alten Mannes schreckte selbst Rei etwas davor zurück, ihn einfach zu duzen. Aber Rei war zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich schlimmer sei, dass der Alte noch flicht einmal seinen Namen nennen wollte. Es war nicht klar, ob der alte Mann einfach nur eine grenzenlose Toleranz besaß oder ob sein Stolz es ihm verbot, sich über die Unhöflichkeiten eines jungen Burschen zu erzürnen (Rei ging davon aus, dass es das letztere war), jedenfalls antwortete er völlig unbekümmert auf Reis Einwurf.
»Der Akt des Blutsaugens ist bei einer ganzen Reihe von Lebewesen eine Form der Nahrungsbeschaffung und von daher schwerlich eigentümlich zu nennen. Nicht nur bei primitiven Ringelwürmern wie dem Blutegel oder den aalartigen Rundmäulern, sondern auch bei Gliederfüßern und Insekten ist das Aussaugen von Körperflüssigkeit eine verbreitete Methode. Aber auch unter Säugetieren wie den zu den Flattertieren gehörenden Fledermäusen gibt es Beispiele für Arten, deren einziges Mittel zur Aufnahme von Nährstoffen das Saugen von Blut ist. Sicherlich finden sich unter den höher entwickelten Säugetieren nur wenige, die sich zur Lebenserhaltung einzig und allein dem Blutsaugen widmen, aber unter den sogenannten Fleischfressern laben sich fast alle auch am Blut ihrer Beute. Der Ausdruck von der blutdürstigen Bestie ist daher mehr als nur eine Metapher. Eher ist es so, dass unsere Abscheu und Angst vor derartigen Tieren zwei der Faktoren waren, die durch Assoziation die Vampire hervorgebracht haben, nicht umgekehrt. Das betrifft auch die nachtaktiven Tiere, die empfindlich gegen ultraviolettes Licht sind. Ich denke, wenn man sich klarmacht, welche Gefühle die Menschen ihnen entgegengebracht haben müssen, versteht man sofort, dass das nur logisch ist.«
»Aber von Tieren, die sich verwandeln können, hab ich noch nie was gehört«, ließ Rei nicht locker.
»Nicht im Sinne einer tatsächlichen Umgestaltung oder Metamorphose. Aber selbst wenn wir unumkehrbare Prozesse wie das Häuten der Reptilien oder die Verwandlung der Insekten vom Ei über die Larve zum fertigen Tier beiseite lassen, gibt es tatsächlich einige wenige Arten, die ihren Körper einschließlich der Haut umgestalten können. Hierzu zählen etwa das Chamäleon, die Kragenechse, das Stachelschwein oder das Tannenzapfentier.«
»Das Stachelschwein macht sich doch einfach nur rund und stellt seine Stacheln auf. Es verwandelt nicht seine Arme in Flügel und fliegt damit herum.«
»Mir wäre lieber, wenn du vom Gleiten redest, wie gesagt..
Der Flug mittels Flügelschlag aus Muskelkraft, wie ihn die Vögel beherrschen, hatte seine Anfänge darin, dass Tiere mit hoher Geschwindigkeit auf ihren Hinterpfoten über den Boden liefen und dabei mit ihren Vorderpfoten das Gleichgewicht halten mussten. Wesen hingegen, bei denen die Ursprünge des Flugs im Hinabgleiten von Bäumen liegen, werden niemals im eigentlichen Sinne fliegen können, egal wie sehr sie sich weiterentwickeln.«
»Heißt das, die Vorfahren der Vampire waren Baumbewohner? »Bei der Diskussion darüber, welche Seitenlinien und Sekundärarten der Mensch während seiner Entwicklungsgeschichte hervorgebracht hat, ist das in der Tat eine hochinteressante Frage.« Der alte Mann zeigte für einen Augenblick ein ironisches Lächeln, fuhr alsbald aber in seinem Vortragsmäßigen Ton fort. »Es ist, wie du sagst. Die Beispiele, die ich eben genannt habe, beruhen strenggenommen nur auf Änderungen der Körperhaltung oder einer Bewegung der Haut. Es sind keine Änderungen der Gestalt, keine Metamorphosen im eigentlichen Sinne. Sehen wir von Weichtieren und anderen primitiven Lebewesen einmal ab ... Tiere, die in ein Knochengerüst gezwängt sind, haben gar keinen Spielraum, eine Körperfunktion zu entwickeln, die den Umbau ihres Körpers erlauben würde. Die höheren Säugetiere haben doch in der Vergangenheit schon im Rahmen der Differenzierung ihrer Körperfunktionen ihre äußere Gestalt weitgehend verwandelt. Denken wir etwa an die Anpassung der Hände und Füße in Hinblick auf das Beute machen oder die Behauptung gegenüber anderen Arten oder etwa an die Entwicklung des Gehirns in Hinblick auf den Gebrauch von Werkzeugen. Für diese Wesen, besonders für jene mit einem hochentwickelten Nervensystem, ist eine Neuanordnung des Knochengerüsts, das heißt eine physische Verwandlung, nur schwerlich möglich. Das beweist schon die Tatsache, dass es kein Wesen mit einer solchen Körperfunktion gibt, zumindest wenn man sich auf die gegenwärtig existierenden Arten beschränkt.«
»Dann ist es also doch ...«, sagte Rei während er sich nach vorne beugte, aber der Alte unterbrach ihn und fuhr fort.
»Ich sagte beschränkt auf die gegenwärtig existierenden Arten ... Ich behaupte nicht, dass es in der Geschichte der Evolution niemals einen Selektionsdruck gegeben hat, der die Entwicklung einer Metamorphose Funktion des Körpers anregte. Wenn man sich die Mannigfaltigkeit des Systems Evolution vergegenwärtigt, ist leicht vorstellbar, dass die Evolution einst allerlei Möglichkeiten verfolgt hat, die außerhalb dessen lagen, was uns heute an Formen und Funktionen bekannt ist. Die meisten von ihnen werden freilich heute ausgestorben sein.«
»Angenommen, die Vampire wären ein besonderes Beispiel, die nicht ausgestorben sind, sondern überlebt haben. Wieso konnten sie überleben?«
»Weil sie Menschen waren.« Der Alte lehnte sich gemütlich in seinen Stuhl zurück und faltete die Hände vor der Brust. Er bestand fast nur aus Haut und Knochen, aber auf seiner Haut waren die für alte Menschen charakteristischen Altersflecken nirgendwo zu sehen, was ihn im Gegenteil fast ein wenig krank aussehen ließ.
»Das verstehe ich nicht.« Rei hatte ein wenig das Gefühl, dass er den Erzählkünsten des Alten erlegen war. Da Gotoda sich, für ihn ungewöhnlich, in Schweigen hüllte, blieb Rei nichts anderes übrig, als den Alten zu drängen.
»Ein Mensch, der seine Arme in Flügel verwandelt, mit denen er durch die Luft gleiten kann ... So hatte ich mich eben ausgedrückt, aber strenggenommen ist das nicht ganz korrekt. Genauer gesagt müssten wir von einem Menschen sprechen, der fähig ist, den Homo sapiens täuschend echt zu imitieren, indem er alle Teile seines Körpers, einschließlich der Flügel, verdichtet. Das zumindest haben anatomische Untersuchungen ihrer Körper zutage gefördert.«
Die Vorstellung von der Autopsie eines Vampirs beschwor in Reis Kopf unheilvolle Bilder herauf. Er musste daran denken, was man wohl mit der Leiche angestellt hatte, die von den beiden Männern mitgenommen worden war, und er erschrak über seine eigene Phantasie. Hatte der Alte nicht von einer »Nichtregierungsorganisation« oder so etwas gesprochen? Wenn man es sich genau überlegte, waren doch auch die Mafia oder die Yakuza nichts anderes als Nichtregierungsorganisationen, die nicht gerne »unnötig Blut vergossen«. Dafür aber um so mehr, wenn es nötig war. Egal, wie spitzfindig man die Sache von außen betrachtete, der Alte war bestimmt auch so einer von denen, die ohne mit der Wimper zu zucken Blut vergießen oder - schlimmer noch - einen Vampir sezieren würden. Als Rei sich das vorstellte, wurde ihm schlagartig klar, wie tollkühn es von ihm gewesen war, den Alten so frech zu duzen und augenblicklich verließ ihn der Mut. Aber der Alte fuhr in seiner Erzählung fort, als ob er nichts von Reis Gedanken wüsste.
»Ihre Haut besitzt eine erstaunliche Elastizität und vermag die durch die Metamorphose bedingten physischen Unregelmäßigkeiten ausreichend abzudecken. Unterhalb der Haut unterstützt ein einzigartiges Muskelgewebe diesen wahrhaft stupenden Mechanismus, der die Umordnung des Knochengerüsts vornimmt. Dieses Gewebe muss nicht nur großen Belastungen beim Gleiten standhalten, sondern unterscheidet sich durch seine Ausstattung mit dem System zur Umordnung des Knochengerüsts auch hinsichtlich seiner Struktur ganz wesentlich vom unsrigen. Insbesondere die Sehnen, welche das Muskelgewebe mit den Gelenken verbinden, sind in ihrer Zähigkeit bewundernswert. Hinsichtlich ihrer Körperkraft sind sie zweifellos die stärksten und mächtigsten Primaten, die es jemals gab. wusstest du eigentlich, mein Junge, dass diese gutmütig dreinschauenden Schimpansen über ausreichend Muskelkraft verfügen, um die Arme eines Menschen in Stücke zu reißen, wenn ihnen gerade danach ist?«
»wusste ich nicht«, gestand Rei ein.
»Die auf Bäumen lebenden Menschenaffen haben bedeutend mehr Muskelkraft in den vorderen als in den hinteren Extremitäten. Was nebenbei beweist, dass die Flugfähigkeit der Vampirmenschen ihren Ursprung nicht am Boden, sondern im Herabgleiten von Bäumen hatte ... Ihre Vorfahren teilen sie sich nicht mit den Fledermäusen, die mit dem Kopf nach unten von Bäumen hängen, sondern mit den Schimpansen, die sich mit ihren langen Armen von Baum zu Baum hangeln. Ist das nicht erheiternd?« Der Alte schien irgend etwas lustig zu finden, jedenfalls schüttelte er sich ganz leicht, und ihm entfuhr ein verhaltenes Lachen.
»Entschuldigung, ich komme vom Thema ab ... Wir waren bei der Frage, weshalb die durch Selektion herausgebildete Fähigkeit zur Metamorphose bei den Vampiren erhalten geblieben ist und sich weiterentwickelt hat, wo sie doch hätte aussterben sollen.« Das Lachen war vom Gesicht des Alten verschwunden.
»Machen wir es kurz, es hat mit dem besonderen Umstand zu tun, dass sie inmitten der Menschen, inmitten dieser auf unserer Erde beispiellosen Spezies, leben mussten. Der Gegner, mit dem sie ums überleben kämpften und auf den sie die Selektion ihrer Fähigkeiten ausrichteten, war nicht die Natur, sondern der Mensch. Also jenes Wesen, das zwar aus einer anderen Seitenlinie der Evolution entstammte, das aber dennoch ihr Gefährte war. Seit der Zeit, als unsere Vorfahren Horden von Affen waren, die mit Werkzeugen umgehen konnten, haben sie überlebt indem sie uns imitiert, als Parasiten unter uns gelebt und uns zu ihrer Beute gemacht haben. Das einzige Objekt ihrer Evolution waren wir, der Mensch.«
»Die Mensch-der-Jäger-Hypothese?« Gotoda, der bislang geschwiegen hatte, mischte sich hier ein, und der Alte pflichtete ihm mit einem deutlichen Nicken bei. »Mensch-der-Jäger-Hypothese? Was soll das sein?« fragte Rei Gotoda zugewandt.
»Hast du den Film 2001:A Space Odyssey von Stanley Kubrick gesehen?«
»Klar. Spitzen mäßiger Film.« »Genau diese Sache.«
Was für eine Sache? Aber noch bevor Rei Gelegenheit hatte, sich über Gotodas allzu nebulöse Antwort aufzuregen, sprang der alte Mann erläuternd ein:
»Diese Hypothese besagt, dass einem Teil der Menschenaffen, in dem Moment, als sie zum ersten Mal zu einer Waffe griffen, um damit zu töten, auch zum ersten Mal die Augen für ihre Fähigkeiten als Menschen geöffnet wurden.«
Rei erinnerte sich an die berühmte Szene aus dem Film, als eine Gruppe von Affenmenschen eine andere Gruppe überfällt und mit einem Gazellen Knochen oder etwas ähnlichem auf die Gegner einschlägt, sie totschlägt und der in die Luft geworfene Knochen schließlich in Zeitlupe zu einem Raumschiff wird.
»Ach, das«, murmelte Rei. »Genau das«, antwortete Gotoda.
»In der Geschichte des Menschen hat die Jagd einen festen Platz. Unsere Intelligenz, unsere Neugier, unsere Gefühle, unser soziales Leben, sie alle sind das Ergebnis unserer erfolgreichen Anpassung an das Jagen. Das Leben des Menschen als Jäger hat die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung der Zivilisation geschaffen.« Der alte Mann war fortgefahren, ohne dem scheinbar absurden Dialog zwischen den beiden Beachtung zu schenken. »Für das Jagen benötigt man Waffen, der Gebrauch von Waffen regt das aufrechte Gehen an. Wer auf allen Vieren kriecht, kann nämlich keine Waffe benutzen. Der aufrechte Gang wiederum macht den Transport von Kleinkindern, Waffen und Nahrungsmitteln möglich. Mit dem Männchen als Ernährer, dem Weibchen als Erzieher und dem Kleinkind als einem schwachem Nichternährer, der wesentlich langsamer heranwächst als bei allen anderen Arten, wurde eine grundlegende soziale Einheit, nämlich die Familie, geschaffen. Höhere Fertigkeiten in der Jagd erforderten effektivere Werkzeuge, effektivere Technik und effektivere Zusammenarbeit, weshalb sie die Entwicklung einer Gesellschaft beschleunigten und die Entwicklung größerer Gehirne mit sich brachten, was wiederum in einer Art Kettenreaktion Kleinkinder hervorbrachte, die sowohl biologisch als auch sozial in hohem Maße abhängig waren. Kurzum, alles, was den Menschen ausmacht, ist aus der Jagd und, als ihrem Ergebnis, dem Fleischverzehr, hervorgegangen.«
Rei hatte die Bitte des Alten um ein Gespräch eigentlich dafür nutzen wollen, endlich aus der Reserve zu kommen und in die Offensive überzugehen, aber jetzt hatte der Alte sich unbemerkt eine absolute Führungsrolle gesichert. Natürlich bereitete diese Situation Rei Verdruss, aber da er andererseits immer noch keinen blassen Schimmer hatte, worauf der redselige Alte eigentlich hinauswollte, musste er angesichts seiner beinahe erdrückenden Gelehrsamkeit vorläufig klein beigeben.
»Sagt dir der Name Raymond Dart etwas?« »Keine Ahnung«, antwortete Rei bockig.
»Dart war Wissenschaftler an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg. Im Jahr 1924 hat er in Transvaal in Südafrika ein bedeutendes Fossil entdeckt.«
»Australopithecus Africanus«, murmelte Gotoda, als ob er einen Zauberspruch aufsagen würde. »Er war gut 120 cm groß, ging aufrecht, besaß Schneide- und Eckzähne und hatte ein Gehirn, das so groß war wie das eines Gorillas. Er war ein fleischfressender Affe, der, geologisch ausgedrückt, zu Beginn des Quartärs, also vor gut 2 Millionen Jahren, im Osten Afrikas umherstreifte. Dart folgerte, dass dieses Fossil von einem Wesen stammte, das von der Jagd lebte und ein Zwischenstadium zwischen Affe und Mensch repräsentierte. Als er diese Schlussfolgerungen veröffentlichte, wurde er von der Fachwelt allerdings heftig niedergemacht.«
Der alte Mann nickte zufrieden, und Gotoda fuhr fort: »Unter den damaligen Gelehrten war die Theorie vom Ursprung der menschlichen Rasse in Asien weit verbreitet. Außerdem war man von der fixen Idee besessen, dass die Größe des Gehirns der bestimmende Faktor war, der die menschliche Evolution vorantrieb. Darts Hypothese schien dem geradezu diametral zu widersprechen. In seinem 1953 veröffentlichten Aufsatz Der räuberische Wandel vom Menschenaffen zum Menschen behauptet Dart, dass die Australopithecus gewöhnliche Mörder waren, die ihre Beute gewaltsam fingen, sie zu Tode quälten, in Stücke rissen und den Durst ihrer gierigen Kehlen mit dem warmen Blut ihrer Opfer stillten. Nach Dart waren sie fleischfressende Bestien, die das abgerissene rote Fleisch gierig hinunterschlangen, und dabei ihre Artgenossen ebenso kaltblütig töteten und aßen, wie sie es mit anderen wilden Tieren taten.«
»Da frage ich mich, ob dieser Dart wirklich ein Wissenschaftler war«, mischte sich Rei reichlich genervt ein.
»Nun, die Jäger Hypothese war von Anfang an mit schwarzem Humor und moralischer Kritik durchsetzt. Dart etwa sagte:
Sie waren ebenso gute Jäger wie wir Menschen. Vielleicht waren sie sogar die besseren Jäger, denn sie hatten keine Hemmungen.«
»Allerdings gibt es eine Reihe von Forschem, die diese Ansicht nicht teilen«, mischte sich jetzt der alte Mann ein. »Die charakteristische Veranlagung zum Mörder, die der Mensch besitzt, ist aus seiner im Grunde friedlichen Natur als Pflanzenfresser ohne natürliche Waffen hervorgetreten. Deshalb fehlt ihm jener Sicherheitsmechanismus, der alle fleischfressenden Tiere davor bewahrt, ihre Tötungskraft zu missbrauchen. In der Evolution des Menschen war bis zu dem Punkt, als die Entdeckung künstlicher Waffen schlagartig das Gleichgewicht zwischen Tötungskraft und sozialer Kontrolle zerstörte, gar kein Mechanismus notwendig, um spontane Morde zu verhindern. Durch den Gebrauch von Waffen war es uns möglich, eine Distanz zwischen uns und der zu tötenden Beute zu schaffen, was uns die unangenehme Erfahrung ersparte, sie mit eigenen Händen und Zähnen töten zu müssen. Wenn wir gezwungen wären, unsere Beute mit natürlichen Waffen wie Händen und Zähnen zu töten, würde uns bewusst werden, was wir da in Wirklichkeit tun, und dann würde kein geistig gesunder Mensch aus Vergnügen auch nur auf eine Hasenjagd gehen...«
»Der Mensch als eine Taube, der man auf einmal den Schnabel eines Raben gegeben hat ... Das ist von Lorenz, nicht wahr?« mischte sich diesmal Gotoda ein und verzog seinen Mund. »Wie dem auch sei, es ändert nichts an der Behauptung, dass das Töten das Wesen des Menschen ausmacht. Der Mensch ist weder in Unschuld geboren noch stammt er aus Asien.«
»Das ist Ardrey, African Genesis, nicht wahr«, sagte Gotoda erläuternd, als wolle er damit Rei besänftigen, der vom düsteren und pedantischen Dialog der beiden genervt war. »Ardrey war eigentlich ein Dramatiker, der mit diesem populärwissenschaftlichen Buch über Darts Ideen und die Jäger-Hypothese einen großen Erfolg landete. Die Hypothese an sich gab es schon seit längerem, aber Dart hatte sie mit scheinbar wissenschaftlichen Beweisen unterlegt. Die Idee, dass die Jagd und der von ihr ausgehende Selektionsdruck aus Menschenaffen Menschen gemacht, ihnen den Geschmack an der Gewalt eingeprägt und sie von der Tierwelt und den Naturgesetzen abgehoben hat, war unter Intellektuellen und Kulturmenschen eine Weile richtig in Mode. Der von dir als Meisterwerk gelobte Film von Kubrick ist nur ein Beispiel dafür. In diesem Film war der Auslöser für den Menschenaffen, sich der Waffen zu bedienen, eine Metallplatte, welche Außerirdische auf der Erde als Mitbringsel zurückgelassen hatten.«
»Das war die Offenbarung der kosmischen Intelligenz«, verbesserte ihn Rei, der den Film noch als Mittelschüler gesehen hatte und schwer beeindruckt von ihm gewesen war. Er war sogar in die Nachbarstadt gefahren, um sich den Soundtrack zu kaufen, und unter seinen Freunden war es damals zu einer heftigen Diskussion über die besagte Metallplatte gekommen.
»Was für eine dümmliche Szene! Das war doch wenig mehr als das Hirngespinst eines Filmregisseurs, noch nicht einmal wert Hypothese genannt zu werden ... Selbstverständlich war der wirkliche Anlass für die Affenmenschen,Waffen in die Hand zu nehmen und mit dem Töten zu beginnen, nicht so eine romantische Begegnung. Es war das Klima«, lies der alte Mann Rei abblitzen.
»Das Pliozän, das dem Quartär unmittelbar vorausging, war ein Zeitalter extremer Trockenheit. Das Grünland Ostafrikas wurde immer weiter zurückgedrängt, bis nur noch einige wenige Urwälder in Zentralafrika übrig waren. Um den sehr begrenzten Raum dieses letzten Paradieses entbrannte für die verschiedensten Tierarten ein heftiger Überlebenskampf. Auch die Menschenaffen, die unsere Vorfahren sind, waren da keine Ausnahme. Im Streit um die Früchte des Waldes dürften die auf den Bäumen lebenden Menschenaffen den Sieg davongetragen haben. Sie blieben im Dschungel und wurden die Vorfahren der heutigen Gorillas. Die Verlierer wurden aus den Wäldern in die Steppe vertrieben, wo sie zum Australopithecus wurden. In der Steppe nahmen sie eine aufrechte Haltung ein, weil das für die Jagd von Vorteil war. Sie eigneten sich den aufrechten Gang an, ebenso wie die Jagd und den Fleischverzehr. Das dachten zumindest die Unterstützer von Dart.«
Rei, der nichts anderes als die Offenbarung der kosmischen Intelligenz auf der Rechnung hatte, war etwas enttäuscht, als er hörte, dass ausgerechnet das Klima der Anfang aller Laster des Menschen gewesen sein sollte.
»Die Vorfahren der Menschen, die im Garten Eden von der verbotenen Frucht gegessen hatten, wurden aus dem Paradies vertrieben ... In der geschichtlichen Realität war es freilich so, dass die Menschenaffen, die sich im Dschungel nicht ernähren konnten, ins Ödland vertrieben wurden, wo sie das Verbrechen des Fleischverzehrs begangen. Was danach kam, beruht auf meiner Phantasie ... Vielleicht hatten sich unter die aus dem Dschungel vertriebenen Menschenaffen ja einige Wesen gemischt, die ihnen zwar rein äußerlich ähnlich waren, sich in Wirklichkeit aber von ihnen unterschieden. Sie gehörten zu den baumbewohnenden Menschenaffen, also jenen, die sie selbst vertrieben hatten, genauer gesagt, sie waren Angehörige einer kleinen Minderheit unter ihnen. Wenn man nun annimmt, dass diese Minderheit von Menschenaffen zu diesem Zeitpunkt schon nachtaktiv war und die Fähigkeit besaß, zur Nahrungsaufnahme von Bäumen herunterzugleiten, dann ist zu vermuten, dass sie sich als Ernährungsweise das Blutsaugen angeeignet haben. Der Grund dafür liegt darin, dass der Akt des Fliegens eine Art Wettlauf zwischen dem Energieverbrauch und der Nahrungsaufnahme ist. Zum Fliegen muss man Nahrung aufnehmen, aber eine Aufnahme großer Mengen an Nahrung auf einmal erhöht das Körpergewicht, was wiederum das Fliegen direkt erschwert. Für die Vögel, die mit Flügelschlag fliegen, bedeutet das, dass sich die Evolution bei ihnen voll auf die Flugfähigkeit konzentrierte, und die Weiterentwicklung aller möglichen anderen Körperfunktionen aufgab. dass sie trotzdem beinahe den ganzen Tag auf der Suche nach Nahrung herumfliegen müssen, zeigt deutlich, wie wenig effektiv das Fliegen als Daseinsform eigentlich ist. Die Vögel fliegen, um zu fressen und fressen, um zu fliegen. Also blieb den Vampiren, die ja zudem noch echte Säugetiere waren, nur eine Möglichkeit. Sie mussten eine noch effektivere Form der Nahrungsaufnahme etablieren.«
»Das Saugen von Blut unter Weglassung des Verdauungsprozesses.«
»Wobei Bedingung war, dass dieses Ziel mit möglichst geringer Anstrengung erreicht wurde. Wenn sie es so umständlich und zeitaufwendig angegangen wären wie die großspurigen Vampire in den Filmen, hätten sie es nicht weit gebracht ... Tagsüber den Energieverbrauch soweit wie möglich drosseln, nachts an die schlafende Beute heranschleichen und Blut saugen. Vielleicht sonderten sie, ähnlich wie die blutsaugenden Fledermäuse, Substanzen ab, welche die Blutgerinnung ihrer Opfer hemmte und sie betäubte, aber solange sie nicht völlig ausgehungert waren, dürften sie ihre Beute kaum völlig leer gesaugt haben. Wer seine Beute tötet, zieht nämlich nur Aufmerksamkeit auf sich, und solange das Beutetier am Leben ist, ist auch der Nachschub an Blut gesichert. Die effektivste Methode, um sich an die Beute heranzuschleichen ist, sie zu imitieren. Man verbirgt sich in der Nähe einer Horde Menschenaffen, auf die man es abgesehen hat und während der Nacht mischt man sich unter die Horde, die in einer Höhle oder einer Grube schläft, und saugt Blut, wobei man wie einer von ihnen aussieht. An dieser grundsätzlichen Existenzform hat sich im laufe der Geschichte bei ihnen nichts geändert. Ist es nicht denkbar, dass die Erinnerungen einzelner, welche die Blutsauger bei ihren Aktivitäten beobachteten, überliefert wurden und dass sich so im laufe der Zeit das Bild vom Vampir festgesetzt hat? Selbstverständlich dürften ein Teil von ihnen im Dschungel zurückgeblieben sein, aber sie gerieten zusammen mit ihren Wirtstieren, den Menschenaffen, in eine Sackgasse der Evolution und starben aus. Im Gegensatz dazu überlebten jene, die den Dschungel verlassen hatten, als ständige Begleiter des Australopithecus und entwickelten sich parallel zu ihm fort. An und ab kreuzten sie sich mit ihm und erhöhten dabei ihre Hirnmasse immer weiter, und so sind sie bis zu uns auf den heutigen Tag gekommen, ohne ihre spezielle Lebensweise aufzugeben ... Das meinte ich vorhin damit, als ich sagte, sie hätten überlebt, weil sie Menschen waren.«
»Glückwunsch zu soviel blühender Phantasie. Wenn ich mir diese Wahnvorstellungen so anhöre, erscheint mir die These von den Außerirdischen und der Metallplatte plötzlich wieder um einiges glaubhafter«, sagte Gotoda in einem ironischen Ton. »Wo sind denn die Beweise dafür? Okay, für Darts Hypothese haben wir den versteinerten Australopithecus, aber wieso gibt's dann keine Fossilien von Vampirmenschen, wenn die sich angeblich parallel zu ihm entwickelt haben?«
»Ich weiß durchaus, dass beinahe mit jedem neu entdeckten Fossil auch wieder eine neue These über den Ursprung der Menschheit auf den Tisch kommt. Selbst wenn man nur die zwei Millionen Jahre seit dem Australopithecus betrachtet, reicht die Anzahl der von uns gefundenen Fossilien kaum aus, um von wissenschaftlich fundierten Beweisen sprechen zu können. Es ist nicht mehr als ein Psalm von wenigen Zeilen, der in die Ecke eines riesigen weißen Blattes geschrieben wurde und dort auf seine Interpretation wartet. Tatsache ist, dass die Erforschung der menschlichen Evolution zur Zeit noch immer nicht nur eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern auch ein ideologischer Disput ist, bei dem alle Beteiligten nur das sehen, was sie sehen wollen. Solange alle die Fakten nur entsprechend den eigenen vorgefassten Meinungen und Theorien interpretieren, könnte man den fossilen Oberarmknochen eines Vampir-Menschenaffen finden und niemand würde auch nur auf die Idee kommen, dass der zur Aufnahme einer Flughaut für den Gleitflug dienen könnte. Was soll man dazu noch sagen, wenn jemand ihre moderne Form im leibhaftigen Original gesehen hat und trotzdem lieber an die Geschichte mit der Metallplatte und den Außerirdischen glauben möchte?«
»Angenommen, diese Wesen sind tatsächlich die lebenden Nachfahren der blutsaugenden Menschenaffen, von denen du erzählst. Was ist dann euer Ziel? Wollt ihr Rache nehmen für all das Blut, das sie über Generationen aus unseren Vorfahren gesaugt haben? Ich sehe keine Notwendigkeit für die ganze Heimlichtuerei, mit der ihr die Sache hier betreibt.«
Jedes mal, wenn Gotoda den Alten duzte, zuckte Rei auf dem Stuhl zusammen, aber der Alte machte immer noch ein völlig unbeeindrucktes Gesicht.
»Ich erlaube mir, die Gründe dafür etwas später zu erläutern.
Wie eingangs erwähnt wollte ich Ihnen mit dem eben gesagten lediglich das Verständnis erleichtern. Und bitte verstehen Sie, dass es schon eine Ausnahme darstellt, dass wir hier überhaupt über diese Sache reden.«
Ich gebe euch die einmalige Gelegenheit etwas zu lernen, also hört gefälligst auch zu - SO ungefähr verstand Rei das, was der Alte sagte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich eine Long Peace anzustecken, worauf Gotoda bettelnd seine Hand ausstreckte. Die Zigaretten, die auf dem Tisch lagen, schienen ihm nicht zu schmecken. Rei, der den Eindruck hatte, dass der Alte noch eine ganze Weile weitererzählen würde, nahm eine Zigarette aus dem Päckchen und gab sie Gotoda. Der Alte wartete, bis beide ihre Zigaretten angezündet hatten und fuhr dann fort:
»Ich habe Dart hier nicht angeführt, weil ich meine Vorstellungen damit untermauern wollte, dass ich seine Thesen unterstützte. Nein, ich hege sogar ernste Zweifel an ihrer wissenschaftlichen Berechtigung. Erst in den letzten Jahren fand man heraus, dass die Vorliebe für Fleischverzehr keineswegs eine eigentümliche Besonderheit des Menschen ist, die ihn von den Menschenaffen unterscheidet. Unter den Schimpansen etwa ist es durchaus gebräuchlich, Beutefleisch von anderen Räubern zu stehlen oder sich gegenseitig umzubringen und zu verspeisen. Folglich ist es nicht mehr möglich, allein aufgrund des Fressverhaltens zu erklären, wieso unsere Urahnen sich nicht zu Schimpansen, sondern zu Australopithecus entwickelt haben. Durch eine Studie wurde festgestellt, dass die Nahrung eines bestimmten Jägervolks, das gegenwärtig in der Kalahari-Wüste lebt, zu zwei Dritteln pflanzlich ist. Damit verliert Darts Gedanke, dass unsere Vorfahren nach ihrer Vertreibung aus dem Dschungel in der Steppe nur überleben konnten, weil sie zu Fleischfressern wurden, seine Grundlage. Es ist offensichtlich, dass solche neu gewonnenen Fakten und ihre Interpretation den Widerspruch der Anthropologen gegen die Jäger-Hypothese stärken. Und dennoch übt die Jäger-Hypothese nach wie vor eine starke Anziehungskraft auf mich aus. Und überhaupt ... Weshalb möchten sich eigentlich so viele Menschen zur Jäger-Hypothese äußern? Weil die Jäger-Hypothese, ebenso wie viele andere Geschichten, die den Ursprung des Menschen erklären, nichts anderes als eine Art ideologisches Instrument ist. Das lässt sich schon daraus erahnen, dass die Kritik an der Jäger-Hypothese auch aus verschiedensten politischen Lagern kam. Ein pazifistischer Anthropologe kritisiert zum Beispiel, dass die Jäger-Hypothese die Ursache für Kriege und Gewaltverbrechen unter den Menschen auf unsere Urahnen in grauer Vorzeit schiebt und somit nur eine Ausrede ist, um uns von der Verantwortung für unsere unmenschlichen Taten freizusprechen. Die Feministinnen wiederum erkannten in der anthropologischen Vorstellung vom Menschen als Jäger ein Bild des Mannes, das mit Technik und grundlegendem Broterwerb assoziiert wird. Sie kritisierten diese Vorstellung, weil sie die Aggressivität des Mannes als notwendig für die Jagd und den Schutz von Frau und Kind akzeptiert und zudem die Überlegenheit des Mannes gegenüber der Frau unterstreicht. Andere Kritiker wiederum lehnten die Geschichte vom Killer-Menschenaffen grundsätzlich ab. Sie sei eine Mischung aus Evolutionstheorie und biologischen Fakten, die man in die Logik westlicher Mythen gezwängt hätte und darüber hinaus nichts als eine wieder aufgewärmte Version der Geschichte vom verlorenen Paradies, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Möglicherweise trifft eine Kritik voll ins Schwarze. Nämlich die, dass das, was die Menschen an der Jäger Hypothese so fasziniert, nicht das Geringste mit ihren wissenschaftlichen Beweisen zu tun hat.Vielleicht hat Dart ja mit den wissenschaftlichen Beweisen gar nicht die Basis für eine Anerkennung der Jäger-Hypothese und die mit ihr einhergehenden Zweifel am Menschen geliefert, sondern einfach nur eine Rechtfertigung? Andererseits... Denken Sie noch mal darüber nach. Die Vorstellung vom Homo sapiens als geistesgestörter Menschenaffe, der einer friedlichen Natur auf seinem Weg fortlaufend blutbesudeltes Futter entreißt, ist ein äußerst deprimierender Gedanke. Und trotzdem waren solche Weltbilder und solches Denken über den Menschen schon weit verbreitet, lange bevor Dart seinen Aufsatz veröffentlicht hat. Könnte es sein, dass uns die Jäger-Hypothese deshalb so fasziniert, weil sie indirekt grundlegende Wertvorstellungen unserer Kultur stützt? Ist das fortwährende Eintreten für die Legende vom Killer-Menschenaffen vielleicht weniger Spiegelung des Kalten Kriegs oder Ausdruck unserer Wehmut nach der Geschichte vom verlorenen Paradies, sondern vielmehr Zeichen dafür, dass sie zumindest in einem symbolischen Sinne eine grundlegende Wahrheit darstellt? Wie denken Sie darüber?«
»Die verdammte Kreatur, zu der wir uns am Ende mühevoll entwickelt haben, waren wir von Anfang an«, murmelte Gotoda mit einer wahrhaft melancholischen Miene und bettelte Rei um eine weitere Zigarette an.
»Wer hat das denn gesagt?« »Hab ich vergessen.«
FÜNFTER TEIL
»Natürlich wollten die meisten Befürworter der Jäger-Hypothese den Homo sapiens nicht einfach zu einem blutrünstigen wilden Tier erklären. Ganz im Gegenteil, sie dachten, dass die Spezies Mensch sich als Subjekt der Jagd mit Waffen von den anderen Tieren und den Naturgesetzen abgekoppelt hatte.Jagst du eigentlich, junger Mann?«
»Nein, und ich will's auch gar nicht! So was ist doch bloß ein Freizeitspaß von irgendwelchen Idioten aus der Bourgeoisie oder Idioten, die einen auf Bourgeoisie machen wollen.« Rei hatte eigentlich eine kurze, klare Antwort geben wollen, aber der Umstand, dass er sich bisher kaum hatte äußern können, ließ ihn geschwätzig werden. »Ich kapiere überhaupt nicht, was daran Spaß machen soll, Vögel und wilde Tiere zu töten. Ich hab Zweifel am Charakter von solchen Typen. Solange die Jäger sich bei Unfällen selbst in die Luft jagen oder sich versehentlich gegenseitig erschießen, soll's mir egal sein. Aber wenn sie irgendein armes Tantchen, das im Wald Pilze sammelt, über den Haufen schießen, weil sie es mit einem Wildschwein verwechseln oder sogar Tiere umbringen, ist das für mich unentschuldbar. Es ist wirklich ein Hobby von der übelsten Sorte.« Im Moment, als Rei seine Litanei beendet hatte, hasste er sich schlagartig selbst dafür, unnötige Dinge geplappert zu haben, nach denen er gar nicht gefragt worden war, aber den Alten schien Reis Reaktion eher zufriedenzustellen und er nickte.
»Wie sieht es bei Ihnen aus?«
»Es gehört zu meinen Grundsätzen, nach Möglichkeit keine Waffe zu tragen«, antwortete Gotoda ohne Umschweife. Für einen japanischen Polizeibeamten war das natürlich eine geradezu vorbildliche Einstellung, aber in Gotodas Fall hatte die Antwort noch in einem ganz anderen Sinne Überzeugungskraft.
»Im Gegensatz zu früher wird die Jagd heute nicht mehr als ein praktisches und noch dazu als das einzige Mittel betrachtet, um günstig an Eiweiß zu kommen. Sie wird nur noch als ein Zeitvertreib verstanden oder als eine symbolische Handlung, ähnlich einem religiösen Ritual. Ebenso wird die eigentümliche Erregung, welche die Handlung des Jagens beim Jäger hervorruft, nur noch in ihrer symbolischen Bedeutung verstanden.«
»Was für eine symbolische Bedeutung soll das haben, wenn man eine Beute in die Enge treibt und sie dann tötet? Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass es ein Beweis für die Barbarei des Menschen ist.« Nachdem Rei seine Abscheu gegen die Jagd bereits kundgetan hatte, spürte er ein kaum zu unterdrückendes Verlangen, diesen alten Mann, der ihm wie die Intelligenz in Person erschien, herauszufordern. Und so hatte er diese überspitzte Behauptung gewagt. Er wusste, dass das gefährlich war, aber langsam hatte er einfach genug davon, dem Alten bei der Zurschaustellung seines pedantischen Wissens als williger Zuhörer dienen zu müssen.
»Welches Bild von sich selbst hat der Mensch in seinem Verhältnis zum Tier entworfen? Wenn man über diese Frage nachdenken will, lohnt es sich durchaus, den Akt des Jagens einmal näher zu betrachten. Wenn du wissen möchtest, weshalb du die Jagd so verabscheust und was sie zu bedeuten hat, dann solltest du geduldig zuhören«, sagte der Alte, als hätte er Reis innerste Gedanken durchschaut, und fuhr dann mit seinem Vortrag fort.
»Die Menschen, die wir Jäger nennen, zeigen überall auf der Welt und durch die gesamte Geschichte hindurch eine einheitliche, merkwürdige Tendenz. Sie behaupten von sich, ein Feind des einzelnen Tieres, zugleich aber ein Freund des Tierreichs als Ganzes zu sein und betonen ihre freundschaftliche Verbundenheit mit dem nicht-menschlichen Territorium, in welchem die Tiere leben, das heißt mit der Wildheit und der Natur.«
Rei musste an diese Möchtegern Outdoor Typen mittleren Alters denken, die ständig in irgendwelchen Zeitschriften oder Fernsehsendungen auftauchten. Die sangen allesamt ein Loblied auf das Leben in der freien Natur und zeigten Verachtung für das Leben in der Stadt, was sie natürlich nicht davon abhielt, ihre Allradkisten mit den neuesten technischen Errungenschaften der Zivilisation vollzupacken und damit in die Berge oder ans Meer zu fahren. Es waren schlampige und dumme Kerle, die haufenweise Geld für Jagd- und Angelausrüstungen ausgaben, sich an den Massen von Essen satt fraßen, die sie mit ihrer Outdoor Ausrüstung selbst kochten ( obwohl sie zu Hause nie einen Kochtopf in die Hand nehmen würden) und wollten in ihrer Arroganz diese Lebensweise auch noch andere Leuten aufzwingen. Rei hasste diese Outdoor Typen mit ihrem pervertierten Sendungsbewusstsein wie die Pest.
»Der Jäger ist ein mehrdeutiges Wesen, das sich stets in einem Grenzgebiet aufhält. In der altgriechischen Literatur ist der Jäger an zwei eigentlich gegensätzliche Gottheiten gebunden:
Apollon, der das Licht der Vernunft bringt, und Dionysos, der die heilige Ekstase bringt. In diesen beiden Gottheiten, die im Kontrast die Ordnung des Menschen und die Wildheit der Tiere darstellen, spiegelt sich die symbolische Bedeutung der Jagd. Die Jagd geschah notwendigerweise auf einer Grenzlinie, an der sich das Territorium des Menschen und das Wilde begegneten, und die beiden Gottheiten standen sich auf beiden Seiten dieser Grenze gegenüber. Die Grenzlinie, auf der sich der Jäger befand, war der Randbereich der menschlichen Welt, ein Ort, der auf die undeutliche Grenze zwischen Mensch und Tier wies. Am klarsten zeigt das niemand anderes als Artemis, die Göttin der Jagd. Sie ist so etwas wie die Verkörperung all der Vieldeutigkeiten, die der Jäger umfasst. Als Göttin tötet sie die wilden Tiere mit ihrem Schmerz bringenden Pfeil, gleichzeitig ist sie ihr Freund und ihr Beschützer...«
Rei überlegte sich, ob der Alte vielleicht früher selbst einmal Jäger gewesen war. Vielleicht war er ein Mann, der eine große Zahl wilder Tiere abgeschlachtet hatte und jetzt in diesem Zimmer, das wie ein Andachtsraum für diese Tiere wirkte, seinen Lebensabend umgeben von den Ikonen der Wildnis verbrachte. Diese Vorstellung ließ den alten Mann in Reis Innerem unwillkürlich ungeheuer einsam und verlassen erscheinen.
»In den Zeiten nach den alten Griechen, die in der Jagd eine symbolische Bedeutung gesehen hatten, wurde die Jagd in Europa, begünstigt auch durch das Wachstum der Bevölkerung und die zunehmende Verdrängung der Natur, zu einem privilegierten Zeitvertreib der Königs- und Adelsfamilien. Eine zunehmende Formalisierung der Jagd, die mit der Distanzierung von ihrem eigentlichen Wesen, dem Beute machen, einherging, begann im Frankreich des 13.Jahrhunderts und breitete sich von dort über die Zwischenstation England rasch in Europa aus. Die Jagd wurde zum Vorrecht der herrschenden Klasse, und dieses Privileg wurde grausam und gnadenlos durchgesetzt. Den Bauern wurde nicht nur die Jagd verboten, sondern auch der Besitz von Pfeil und Bogen. Zudem wurde ihnen befohlen, ihre Hunde zu Krüppeln zu machen, damit diese das Wild nicht jagen konnten. Auf der anderen Seite wurden die Bauern gezwungen, als Treiber bei der Jagd und als Lastenträger zu arbeiten, und die Wilderei wurde mit drakonischen Strafen belegt. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die große Ungerechtigkeit, die mit dem Jagdprivileg verbunden war, in anderen Schichten der Gesellschaft die Sichtweise der Jagd veränderte. In einer Erzählung, die im England des 14.Jahrhunderts entstanden ist, jagt Robin Hood noch die Hirsche im königlichen Reservat von Sherwood Forest, aber bald begann Kritik an der Jagd selbst aufzukommen. Erasmus von Rotterdam, der illegitime Sohn eines Priesters, kritisiert in seinem Werk Lob der Torheit die Jagd als ein einfaches Abschlachten und zudem eine große Zeitverschwendung. Für Thomas More, den Autor von Utopia, war die Jagd ein Symbol des Niedergangs der Menschheit, und er betrachtete sie als einen vulgären und niederträchtigen Akt. Sicherlich weißt du, dass Shakespeare in seinen Werken die Jagd wiederholt als Metapher für Mord und Vergewaltigung benutzt hat.«
»Nein, wusste ich nicht«, antwortete Rei, der von der Pedanterie des Alten ebenso wie von seiner eigenen Unwissenheit und Ungebildetheit genervt war.
»Ihr Herrn, ein stattlich Jagen steht bevor ... weit und entlegen dehnt der Wald sich aus und beut viel unbetretne Räume dar, wie auserwählt für Raub und Freveltat ... Dahin lockt einzeln euer schmuckes Reh, und fällt es mit Gewalt, wenn nicht mit Gutem. Das ist aus Titus Andronicus.«
Gotoda trug das Zitat in einem betont gelangweilten Tonfall vor, als wollte er den alten Mann damit aufziehen.
»Du solltest nicht nur Marx und Lenin lesen, sondern auch mal den ein oder anderen Klassiker, Junge.«
»Danke, ich komme schon zurecht«, antwortete Rei, aber in Wirklichkeit hatte er noch nicht einmal Marx oder Lenin mit besonderem Eifer gelesen und fürchtete sich davor, dass der Alte näher auf sie zu sprechen kommen könnte.
»Am heftigsten war allerdings die Kritik ihres Zeitgenossen Montaigne. Er dachte ebenso wie More, dass das Vergnügen an der Jagd einen substantiellen Niedergang des menschlichen Geistes widerspiegele. In seinem Essay Über die Grausamkeit schreibt er folgendes: Stets erschien es mir als ein sehr unerquicklich' Schauspiel, wenn ein Hirsch völlig entkräftet und außer Atem, keinen anderen Ausweg sah und sich vor seine Verfolger warf, um Gnade vor ihren Klingen zu erbitten.«
»Ich fände es auch unerträglich, wenn ich so etwas mit ansehen müsste.«
»Ich fände es auch unerträglich. Aber in der damaligen Gesellschaft wurden Tiere noch allgemein mit einer Mischung aus grausamer Teilnahmslosigkeit und Sadismus behandelt. Die Ansichten von More und den anderen repräsentieren nur eine kleine Minderheit. Ich möchte, dass du nicht vergisst, dass es noch einmal gut fünf Jahrhunderte gedauert hat, bis ihre Ansichten allgemeine Unterstützung fanden.«
Rei stellte sich vor, wie es wäre, wenn er selbst sich zu Boden werfen und um Gnade flehen müsste. Ob der Alte den Anblick wohl auch unerträglich fände? Mit einem Seufzer vertrieb Rei dieses Hirngespinst aus seinem Kopf. Gegen einen mitleiderregenden Hirsch käme er sowieso nicht an.
»Was glaubst du, woher diese Anspannung kommt, die in ihren Schriften spürbar ist, wenn es um die Jagd geht?«
»Von ihrer Abneigung gegen die herrschende Klasse«, sagte Rei wie aus der Pistole geschossen.
»Natürlich ... Man sieht, unser junger Mann hier kämpft in den Reihen der Systemgegner«, sagte der Alte mit einem großzügigen Lächeln. »Leider muss ich dich enttäuschen. Weder Shakespeare noch More haben Schriften hinterlassen, die eine mögliche Abneigung gegen den Adel zeigen, und Montaigne war selbst ein Adliger. Es müssen also andere Gründe als eine Klassen bedingte Abneigung gewesen sein, die sie so unerfreulich über die Jagd denken ließen. Einer dieser Gründe war die klassische Bildung. Die Schriftsteller des 16.Jahrhunderts waren dem Humanismus der Renaissance und dem mit ihm einhergehenden Studium der Klassiker zugetan, wozu auch die Kulturen Griechenlands und Roms gehörten. Tatsächlich erinnert Mores Utopia an Sallust, während Montaigne klar von Ovid und Plutarch beeinflusst wurde.«
»Tja, dann war's wohl das«, warf Rei ein.
»Aber das alles erklärt noch nicht, wie es dazu kam, dass sie auf das Denken einer ganz bestimmten Epoche aufmerksam wurden. Man könnte auch sagen, dass es ihre Denkweise war, die sie dazu brachte, diese Klassiker zu wählen.« Rei ärgerte sich einmal mehr über die wichtigtuerische Redeweise des Alten, als Gotoda ihm zu Hilfe kam: »Selbst wenn man annimmt, dass der Klassenkampf und die Ansichten der Klassiker in irgendeiner Weise mit der Jagd kritischen Stimmung zusammenhängen, die im 16.Jahrhundert zum ersten Mal auftauchte,ist das keine ausreichende Erklärung. Es muss noch andere Ursachen für die Kritik an der Jagd gegeben haben. Es muss mit einer Art neuer Skepsis zu tun haben, was den Standort des Menschen und seinem Verhältnis zum Tier betrifft.«
»Montaignes Zweifel an der Jagd hat ihren Ursprung in Zweifeln an der besonderen Stellung des Menschen. Montaigne weigerte sich, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Tieren und Menschen anzuerkennen. Er behauptete, dass die geistige Begabung, die man für ein eigentümliches Merkmal des Menschen hielt, auch im Verhalten der Tiere sichtbar sei und gestand den Tieren außer der Sprache beinahe alle geistigen Aktivitäten des Menschen zu. Er ging sogar so weit zu sagen, dass es nicht ein Mangel der Tiere sei, dass die Menschen nicht mit ihnen kommunizieren könnten, sondern ein Mangel der Menschen. Die Menschen können nicht verstehen, was die Tiere sagen, aber umgekehrt ist es genauso. Sie schmeicheln uns, drohen uns und flehen uns an, aber das tun wir auch mit ihnen. Ich denke Montaignes Zweifel spiegeln eine wachsende Unsicherheit, wie sie damals unter den Intellektuellen herrschte. Im Gegensatz zum mittelalterlichen Weltbild, in dessen Mittelpunkt das Schicksal des in Sünde gefallenen Menschen stand, wurde die Welt der Renaissance multipolarer, wenn man so will. Nicolaus Cusanus, der dachte, dass die Maschine mit Namen Erde keinen Rand habe ... Kopernikus, der das heliozentrische Weltbild vertrat und behauptete, die Erde sei nur ein Planet, der um die Sonne kreise ... Giordano Bruno, der sich vorstellte, dass die Erde nicht mehr als ein einzelner Stern im Universum sei. .. Die Entdeckung der außereuropäischen Welt im Zuge der Seefahrten der Entdecker und Eroberer ... Der Aufstieg des Protestantismus in Nordeuropa ... All das führte zu Konflikten mit dem traditionellen Weltbild und den überkommenen Werten, und wurde zur Quelle zahlloser Zweifel. Montaigne machte tiefgreifende Skepsis deutlich, was die Überlegenheit des Menschen gegenüber dem Tier betraf. Aber diese Art von grundsätzlichen Zweifeln sind für den Menschen ganz und gar nicht angenehm und nicht lange erträglich. Schließlich betrat eine Anzahl von großen systematischen Denkern die Bühne, welche diese Zweifel in Wissenschaft umwandelten.«
Gotoda erhob sich, ging zum Getränkewagen und begann, die vorhandenen Alkoholika zu begutachten. Einmal abgesehen davon, ob er beim Probieren des Weins geblufft hatte oder nicht, es war eine unbestreitbare Tatsache, dass Wein einfach nicht zu diesem Mann passte. Um einen Drink zu finden, der ihm zusagte, legte sich Gotoda jetzt ganz schön ins Zeug. Er nahm nach und nach die Stopfen von verschiedenen geschliffenen Kristallglas Flaschen ab und schnüffelte wie ein Hund am Inhalt.
»Kann man an der Schule, die du besuchst, einen Kurs in Philosophie belegen?« fragte der Alte Rei und offenbarte damit seine Unwissenheit über das japanische Schulsystem und seine Lehrpläne.
»Philosophie gibt es nicht, aber so etwas ähnliches ... Es nennt sich Ethik«, antwortete Rei und musste dabei an seinen Ethik-Lehrer denken. Er war ein knallharter Reaktionär und einer der Anführer einer Gruppe von Lehrern, die Rei und seine Freunde abgrundtief hassten.
»Bei uns gibt es einen Lehrer, der Sekine heißt. Er ist berühmt dafür, dass er jedes Jahr das gleiche Beispiel bringt, wenn er erklären will, was Dialektik ist. Er meint, wenn Kerze und Lampe sich dialektisch aufheben, gibt es eine Glühbirne.«
Der Alte sah Rei mit einem äußerst mitleidigen Blick an. Vielleicht wollte er Reis philosophische Vorkenntnisse überprüfen, aber wie es schien, war er zu dem Urteil gekommen, dass hier jedes weitere Fragen sinnlos sei. Also schwieg er und wartete geduldig darauf, dass Gotoda mit seiner Auswahl fertig würde.
Auch ohne Sekine, der keinen Pfifferling auf seine Schiller gab, wusste Rei, dass seine philosophischen Vorkenntnisse nicht gerade berauschend waren. Nabeta, der Philosophie sehr mochte, machte ständig großes Aufhebens um Heidegger, Wittgenstein und andere, aber Rei hatte noch nicht allzu viel in dieser Richtung ernsthaft gelesen. Da waren, abgesehen von den unter Parteimitgliedern als tendenziell existentialistisch verschrienen Ökonomisch-philosophischen Manuskripten und dem Werk Die deutsche Ideologie, das er wegen seines geringen Umfangs gewählt hatte, eigentlich nur ein paar wenige Sachen von Kierkegaard und Sartre.
Als Gotoda sich einen Scotch ausgesucht hatte und zurück an seinem Platz war, begann der Alte unvermittelt mit der Fortsetzung seines Vortrags, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben.
»In der philosophischen Schule des Mechanismus, die während des 17. Jahrhunderts unter den Intellektuellen Europas beliebt war, wurde das Reich der Natur als riesiger Mechanismus angesehen.«
Gleich geht's los, dachte Rei und machte sich bereit, in dem er reflexartig seine Kräfte um seinen Bauchnabel sammelte.
»Manche dachten, dass nur der Mensch ein Bewusstsein besitze und dass Tiere nichts als Roboter aus Fleisch seien. Aber diese Art des Denkens war eigentlich nicht völlig neu. Über die Ansicht, dass das Universum nichts anderes als eine von Gott geschaffene Maschine sei, die sich von selbst bewegte, und dass es darüber hinaus ein göttliches Uhrwerk sei, das keinerlei Einstellung bedürfe, hatte es schon seit längerem eine Debatte unter den religiösen Gelehrten Europas gegeben. Auch die alten griechischen Philosophen hatten die Ansicht vertreten, dass kein Tier außer dem Menschen über einen freien Willen verfüge. Das Neue an der mechanistischen Philosophie war, dass ihrer Ansicht nach die Dinge nicht schicksalhaft vorausbestimmt waren, sondern dass alles Mögliche messbar war. Sie betrachteten die Natur als einen ganz bestimmten Mechanismus, ein in Bewegung befindliches System, welches der Mensch durch Erforschung entdecken konnte. Die Grundlage dieses Denkens waren mächtige neue mathematische Methoden aus den sich damals rasant entwickelnden Feldern der Algebra, der Logarithmen, der analytischen Geometrie und der Differential- und Integralrechnung die es ermöglichten, mathematische Hypothesen über physikalische Phänomene aufzustellen. Die Revolutionierung der Mechanik, die mit den Versuchen Galileis begonnen hatte, erreichte fünfzig Jahre später mit der Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch Newton ihren Höhepunkt. Die Physik revolutionierte die Welt. Die philosophischen Theorien des Mittelalters über die Bewegung der Welt waren überflüssig geworden und wurden durch moderne Theorien ersetzt, deren Ziel eine vollständige Erklärung und Messung des Universums war. Die Hydrostatik, Meteorologie, Optik, Astronomie ... Weil diese Theorien wunderbar auf leblose Dinge anwendbar waren, entstand ein neues Weltbild, in dem stärker als bisher das Unbelebte betont wurde. Es war das mechanistische Weltbild, welches jetzt die Naturphänomene ausreichend zu erklären vermochte. Die Forscher dieses neuen Zeitalters suchten nach Mechanismen im Körper von Tieren, eifrige Anatomen schnitten bei Vivisektionen die Körper von sich windenden Hunden und Katzen auf. Sie wollten herausfinden, welche Wirkung zu sehen wäre, wenn sie diesen Nerv durchschneiden oder jene Ader abbinden würden. Das Herz war in ihren Augen eine Pumpe, die Blut bewegt, die Venen und Arterien ihre Schläuche. Die europäischen Wissenschaftler waren geradezu verrückt nach derartigen Versuchen. Sie erklärten die Wirkung von Muskeln, von Lymphflüssigkeit oder von Nerven mit mechanischen oder hydrologischen Theorien. Ausgehend von der Annahme, dass schon das Bewegen von Armen und Beinen Leben sei, ging Thomas Hobbes, einer der repräsentativen Denker dieser Zeit, sogar so weit, dass er die Meinung vertrat, in einer automatischen Puppe existiere künstliches Leben und der Geist des Menschen sei nicht mehr als der gasförmige Teil der Maschine Körper.«
»Das war im Leviathan«, sagte Gotoda, während er an seinem Scotch nippte.
»Im Unterschied zu dem eher emotionslosen und areligiösen Hobbes dachte der feinfühligere und frömmere Rene Descartes, dass die unvergängliche Seele des Menschen sorgfältig an einem Ort außerhalb der Wirkung der Weltmaschine verstaut sei. Der Grund, weshalb er die Seele gesondert behandelte, war einfach. Er lag darin, dass er gegenüber allen anderen Dingen einen grundsätzlichen, tiefgreifenden Zweifel hegte. Descartes dachte wie folgt: Die einzige Kenntnis, die ich direkt erfahren kann und der ich vertrauen kann, ist mein Denken. Alles, was ich in der Welt fühlen kann, einschließlich meines eigenen Körpers, ist möglicherweise eine Sinnestäuschung, aber das Bewusstsein des eigenen Denkens ist gewiss. Die einzige untrügliche Wahrheit, die es im Universum gibt, ist die Erkenntnis des eigenen Wahrnehmungsaktes. Von diesem einen Punkt ausgehend diskutiert Descartes die Existenz von Universum und Gott.«
»Cogito, ergo sum - Ich denke, also bin ich. Das erste Prinzip von Descartes.«
Das wusste sogar Rei. »Das Ich denkt und existiert wirklich, es ist unteilbar und unzerstörbar. Also muss es unsterblich sein, aber zugleich weiß es von sich selbst, dass es nicht vollkommen ist. Folglich muss das Ich den Gedanken der Vollkommenheit von etwas anderem, vollkommenen erhalten haben. Deshalb muss etwas Vollkommenes existieren, und das ist genau das, was wir Gott nennen. Es gibt keinen Grund, weshalb Gott mich mit einer Sinnestäuschung quälen sollte, deshalb muss die materielle Welt sicher existieren.«
»Was denn, am Ende ist es auch bloß Religion«, wandte Rei ein, und der Alte zeigte ein säuerliches Lächeln.
»Für Descartes war das, was den Geist bildete und das, was den Körper bildete, gleichermaßen wirkliche aber zugleich völlig unterschiedliche Existenzen. Er dachte, dass im Universum entweder nur reine Materie oder reiner Geist existieren könne und einzig der Mensch eine mysteriöse Zusammensetzung aus beidem, Geist und Materie, sei.Tiere zählte er selbstverständlich zur Materie, die weder Gefühle noch Sinne besaß. Und was den Geist betrifft: Da Tiere nicht sprechen können, versteht es sich von selbst, dass sie auch nicht denken können Mit solchen Argumenten als Schutzschild führten die Anhänger von Descartes ohne Gewissensbisse oder Mitgefühl in aller Seelenruhe ihre physiologischen Versuche durch. Ohne das geringste Zeichen von Mitleid traten sie ihre eigenen Hunde, sezierten Katzen und lachten jene aus, die Mitleid mit Tieren zeigten. Die Schreie der Tiere bezeichneten sie als die Geräusehe entzwei gehender Maschinen. Wilde Tiere wurden als Uhren bezeichnet, die Schreie, die sie von sich gaben, wenn man sie schlug, waren die Geräusche kleiner mechanischer Federn, die man ausgelöst hatte und denen weder Sinne noch Gefühle zugrunde lagen.«
»Das ist ja furchtbar...« Rei wurde übel. Was hatte der Kerl sich nur dabei gedacht ... Rei spürte, wie das Bild, das er vorn Menschen Descartes gehabt hatte, krachend zusammenstürzte »Du findest das also furchtbar. Aber ähnliche Geschichten hatte es auch in der mittelalterlichen philosophischen Theorie gegeben, die Descartes und seine Leute ablehnten: Ein angesehener Mönch trat einmal vor den Augen einer frommen und herzensguten Nonne in den Bauch einer trächtigen Hündin. Als der Nonne vor Bestürzung alle Farbe aus dem Gesicht wich, schimpfte der Mönch sie aus und sagte, der Hund sei nichts als Fleisch ohne Seele oder ob sie etwa daran zweifeln wolle, dass Gott nur den Menschen mit einer Seele ausgestattet habe.«
Dem Alten entfuhr ein trockenes Lachen.
»Nun, sie waren weder kaltblütig noch grausam. Sie empfanden es als ihre göttliche Pflicht und zugleich eine große Ehre zu beweisen, dass der Mensch Mensch ist und seine daraus resultierende Erhabenheit zu verkünden. Ob Wissenschaft oder Religion ... Stets wenn der Mensch von der Eigentümlichkeit des Menschen erzählt, gerät er in diese Fallgrube und immer wieder folgen daraus absurde Überheblichkeit und Torheit.«
»Bedauerlicherweise muss ich da in allen Punkten zustimmen.« Mit einer bitteren Miene nahm Gotoda einen Schluck Scotch. Als Rei das sah, holte er sich vom Getränkewagen ein Glas und Gotoda goss in das zweite Glas eine bernsteinfarbene Flüssigkeit. Der Scotch schien etwas ganz Besonderes zu sein, und Rei schluckte ihn mit einer Vorahnung von Alkoholkater hinunter.
»Kurzum, eine solche Lehre ist grausam. Descartes' Weltsicht, wonach ein unvergängliches, sich selbst betrachtendes geistiges Medium im mechanischen Innenleben eines sterblichen Körpers umherfährt, führte zu einer überaus traurigen Entwicklung. Wie konnte ein so kaltes Bild der Welt die Vorstellungskraft eines so mächtigen Geistes beherrschen? Der Grund dafür ist, dass es das Ziel der neuen Philosophie war, nicht wie die Scholastik des Mittelalters mit unproduktiven Theorien herumzuspielen, sondern das Territorium des Menschen auszuweiten und seinen Einfluss auf die Welt zu stärken. Francis Bacon, ein Zeitgenosse von Descartes, hatte vorausgesagt, dass der Weg des experimentellen Nachforschens durch den Menschen Beschränkungen der Unabhängigkeit der Natur mit sich bringen würde, was sich später durch die Naturphilosophie und Naturwissenschaft auch weitgehend bewahrheiten sollte. Ironischerweise hat genau diese Naturwissenschaft aber dazu geführt, dass das Geistige, welches Descartes und Bacon dem Menschen als etwas von der Natur unabhängiges zugestanden hatten, nicht mehr von der Materie unterschieden wurde... Wenn man darüber nachdenkt, kam das eigentlich zwangsläufig. Die Wissenschaft ist stets auf der Suche nach allgemeingültigen Regeln. Ihr Ideal ist ein möglichst einfaches, einheitliches System, mit dem man alle Phänomene erklären kann. Mehr noch, weil die Wissenschaft diese Theorie in Gestalt von Technik, die auf Experimenten beruhte, Wirklichkeit werden ließ, ließ sich der Zuwachs an Macht, den der Mensch durch sie erfuhr, auf sehr praktische Art und Weise rechtfertigen. Die Wissenschaft stellt das Universum notwendigerweise als eine Welt dar, die nach ihrem Gebrauchsnutzen für den Menschen bewertet wird und aus gleichförmiger Materie besteht. Der Pakt, den die Wissenschaft mit uns schließt, ist immer ein faustischer. Denn dafür, dass wir diese aus gleichförmiger Materie bestehende Welt beherrschen dürfen, müssen wir darin einwilligen, dass auch wir aus ebenso gleichförmiger Materie bestehen. Also kamen die westlichen Denkschulen überein, einen Versuch zu starten, einen Ausweg aus diesem Pakt zu finden und dem Menschen und dem Lauf der Welt den Geist zurückzugeben, den man ihnen genommen hatte. Und dieser Versuch begann am Körper der Tiere.«
Gotoda bettelte zum dritten Mal um eine Zigarette. Dafür forderte Rei von Gotoda noch einen doppelten Scotch.
»He, der Scotch ist nicht gerade billig!«
»Ich glaube nicht, dass der Scotch dir gehört, stellte Rei das qualitative Ungleichgewicht ihres Tauschhandels heraus. »Aber die Zigaretten, die gehören mir.«
»Darf ich fortfahren?« fragte der alte Mann höflich.
»Aber bitte doch«, antwortete Gotoda, während er Scotch in Reis Glas goss.
»Eines der Mittel um aus der Sackgasse zu kommen, in die Descartes' Schule sich manövriert hatte, war es, die Existenz der den Geist bildenden Dinge abzulehnen und anzuerkennen, dass das Denken eine Funktion des Körpers ist. Die einen lehnten diesen Weg als eine Leugnung Gottes ab, andere entgegneten, dass ein allmächtiger Gott auch einem Fetzen Fleisch Geist verleihen könne, wenn er es nur wolle. Es sah zunächst so aus, als ob diese Situation die Debatte in einen Gleichgewichtszustand versetzt hätte. Aber letztlich war es ja das Ziel gewesen, den von den Wissenschaften beinahe vertriebenen Geist zu retten. Wenn man nicht erneut in eine Sackgasse zurückkehren wollte, blieb als einzig gangbarer Weg die letzte der beiden Möglichkeiten. Also nahmen die Unterstützer des Denkens, dass Gott jedweder Materie die Fähigkeit zum Empfinden und Denken verleihen konnte, wenn er das wollte, nach und nach zu. Im 18.Jahrhundert lehnte die Mehrzahl der Denker Descartes' Vorstellung vom Tier als einer unbeseelten Maschine ab. Man begann sich darauf zu einigen, dass das Denken eine gemeinsame Fähigkeit von Mensch und Tier sei, nur dass sie beim Menschen geringfügig höher ausgebildet sei. Je niedriger die Mauer zwischen Geist und Materie wurde, desto stärker verschwand auch die Mauer zwischen Mensch und Tier. Das Resultat war, dass man unerwartet vor ein neues Problem gestellt wurde: Die Frage nach dem Leiden der Tiere.«
»Das Leiden der Tiere ...«, wiederholte Rei in mürrischem Tonfall. »Du hast doch selbst gesagt, dass sie Descartes' Ansicht vom Tier als einer seelenlosen Maschine verworfen haben. Wieso soll das Leiden der Tiere dann noch ein Problem sein?«
»Mein Junge, dir als Japaner fällt es vielleicht schwer, das zu verstehen, aber bei der Entwicklung des westlichen Denkens hat sich immer alles um einen Mittelpunkt - Gott - gedreht Wenn du das nicht verstehst, wirst du wohl auch nicht verstehen, was ich dir im folgenden erzählen werde. Also, hör mir gut zu. Leiden existieren nicht einfach, sie werden einem von jemandem zugefügt. Passion wäre der christliche Ausdruck dafür.« Der alte Mann verzog ein klein wenig den Mund und schloss die Augen. Diese Miene, die der Alte gelegentlich zeigte, erschien Rei irgendwie schmerzerfüllt.
»Die Leiden der Menschen dienen einem höheren, größeren Zweck. Egal, ob die Leiden ihren Ursprung in den Freveltaten eines anderen haben oder ob es Gewissensbisse sind oder Unglücksfälle, sie führen uns auf dem schmalen Pfad ins Himmelreich. Zumindest haben die Theologen eine Debatte geführt, wonach das möglich wäre. Schmerz ist ein Ausdruck göttlicher Gerechtigkeit, Gewissensbisse und Unglück sind Ausdruck göttlichen Segens.«
»Und was soll daran vernünftig sein?« maulte Rei. »Da geht's doch nur darum, die Opfer gewaltsamer Unterdrückung und wirtschaftlicher Ausbeutung mit einem leeren Versprechen von Erlösung im Jenseits zum Schweigen zu bringen. Eine Allerweltsmethode der religiösen Herrscher, wenn sie mit der weltlichen Macht unter einer Decke stecken.«
»Du meinst Religion als Opium für das Volk? Freilich, da du ein Marxist bist, ist es nur natürlich, dass du so denkst.«
»Ich bin aber kein Marxist!«
»Dann eben ein Radikaler«, mischte sich Gotoda sichtlich genervt ein. »Also, es kann weitergehen. Und du hältst jetzt mal bitte den Mund, Kleiner!«
Rei missfiel Gotodas Ton sehr, er überlegte es sich dann aber anders und schwieg. Bei dem Alten, der wahrscheinlich keinen Schimmer von der Bewegung der japanischen Systemgegner hatte, wären sowieso alle Erklärungsversuche umsonst.
»Lassen wir die Leiden der Menschen einmal beiseite. Wenn man jetzt annahm, dass auch die Tiere Leid empfinden konnten, dann war es in ihrem Fall schwierig, dies mit der Güte Gottes in Einklang zu bringen. Der Grund ist, dass in der christlichen Überlieferung Tiere keine Sünde begehen können und keine unsterbliche Seele besitzen. Anders gesagt, ihre Schmerzen können kein Ausdruck göttlicher Gerechtigkeit oder göttlichen Segens sein. Mehr noch, abgesehen von Hunger und Krankheit, wurde der größte Teil des tierischen Leids durch das Erbeuten und anschließende Abschlachten bei der Jagd verursacht. Wenn dieses Leid also einfach ein Frevel des Menschen war, bei dem weder Belohnung noch Erlösung auf die Tiere wartete, dann musste das zwangsläufig ungerecht erscheinen. Und wenn ein bedeutender Teil der Welt in dieser Weise ungerecht war, musste das Zweifel an der Allmächtigkeit und Güte Gottes nähren. Diese Frage wurde von den Theologen des 18.Jahrhunderts als ein ernsthaftes Problem anerkannt.«
Wenn der größte Teil des Leids der Tiere von den Menschen herrührte, dann hieß das, dass die Menschen böse waren. Wieso musste überhaupt so viel Theater um die ganze Sache gemacht werden? Es gab noch etwas, weswegen Rei nur schwer an sich halten konnte, aber es schien auch, als ob das die ganze Geschichte nur noch komplizierter machen könnte, und so schwieg er am Ende.
»Man hatte also das Problem umgangen, dass Descartes den Tieren die Fähigkeit zum Leiden abgestritten hatte, aber Louis Racine, ein Anhänger Descartes' im 18.Jahrhundert, nahm sich des Problems direkter an. Er argumentierte, dass wir von unserem Wissen über die Güte Gottes auf die Unbewusstheit der Tiere zurückschließen könnten. Angenommen, die armen Tiere könnten Schmerzen empfinden, dann wäre Gott ungerecht Da wir aber wissen, dass Gott gerecht ist, können wir daraus den Schluss ziehen, dass Tiere nichts empfinden, und folglich können wir sie ohne Zögern erbeuten, schlachten und essen.
»So ein Humbug«, widersetzte sich Rei, der eher verblüfft als verärgert oder erschrocken war. »Das ist verdrehte Logik. Es ist umgekehrt.«
»Die Denker der Aufklärung aus jener Zeit betrachteten ein Bewusstsein bei den Tieren als Tatsache und hegten Zweifel an der Güte Gottes; den voreiligen Schluss von Racine haben sie eben sowenig akzeptiert wie du. Und nicht nur die Aufklärer Es gab Menschen wie Jean Meslier, ein hoher christlicher Würdenträger in Frankreich, der angesichts dieses Problems seinen Glauben verlor und zum Atheisten wurde. Die Lage war also ernst. Ein Theologe kam zu dem Schluss, dass ein gerechter Gott die Tiere für ihre Leiden in dieser Welt im Jenseits entlohnen müsse, und beschrieb eine Vision, in der Milliarden von Haustieren zum Klang von Trompeten wiederauferstanden und aus der Erde aufstiegen. Die meisten Denker, die sich mit dem Problem des Leids der Tiere beschäftigten, erklärten die Leiden der Tiere aber als von Menschen verursacht, um den Verdacht gegen Gott zu entkräften.«
Möglicherweise hatte Rei ein allzu unbeeindrucktes Gesicht gemacht, jedenfalls stellte der Alte Rei eine Frage, als ob er damit Reis Ansichten herausfinden wollte.
»Isst du gerne Fleisch, junger Mann?« Aus irgendeinem Grund verursachte diese Frage Rei Unbehagen. Er erinnerte sich an den Vorfall, als sie sich auf Einladung Gotodas mit Rippenfleisch und Roastbeef vollgestopft und mit den Resten anschließend bei Murasakino noch ein Gelage veranstaltet hatten. Am Ende der Völlerei hatten sie vor lauter Trunkenheit alles wieder erbrochen.
»Geht so«, antwortete Rei unentschieden.
»Nun, auch die Aufklärer, die anerkannten, dass das Leid der Tiere vom Menschen verursacht wird, waren dem Fleischverzehr durchaus nicht abgeneigt. Der junge Benjamin Franklin, der mit dem von den Aufklärern vertretenen ethischen Vegetarismus sympathisierte, hat ein Jahr lang völlig auf Fleisch verzichtet, aber einmal, als die Besatzung eines Schiffes gerade Stücke von einem frisch gefangenen Kabeljau in Öl siedete, dachte er folgendes: der ethische Vegetarismus lehrt, dass der Verzehr jedweden Fisches nicht zu rechtfertigen ist, weil er das Töten von Leben bedeutet. Wenn ein Fisch versucht, uns Schaden zuzufügen, dann ist es gerechtfertigt, ihn zu töten, aber natürlich würde ein Kabeljau mir niemals Schaden zufügen. Aber Franklin aß Fisch für sein Leben gern, insbesondere für frisch gebratenen Kabeljau hatte er eine Schwäche. Als die Seeleute den Kabeljau aufschnitten, und viele kleine Fische aus seinem Magen herausfielen, dachte er, wenn es so ist, dass die Fische sich gegenseitig aufessen, dann kann es auch kein Gesetz geben, das den Menschen vorschreibt, keine Fische zu essen.«
»Ich nehme an, dann hat Franklin reingehauen?« »Das hat er. Er hat sich den Magen vollgeschlagen.« Was für ein scheinheiliger Kerl, dachte Rei.
»Später schrieb Franklin über diese Sache, dass es praktisch sei, ein vernunftbegabtes Wesen zu sein. Es erlaube einem, für alles einen Grund zu finden oder einen solchen zu schaffen.« Für kurze Zeit herrschte Schweigen am Tisch. »Aber nicht nur Franklin, auch andere Aufklärer erkannten, dass Rechtfertigungen eine praktische Sache sind. Voltaire und Rousseau kritisierten den Fleischverzehr, ohne selbst darauf zu verzichten. Pope und Bentham kamen zu dem Schluss, dass das Töten von Tieren zum Fleischverzehr zu rechtfertigen sei, wenn es ohne Leid für das Tier geschehen könne.«
»Sicherlich waren Bentham und Pope ziemlich scheinheilige Gesellen, aber zumindest waren sie noch so aufrichtig, dass sie überhaupt zu dem Schluss kamen, dass es einer Rechtfertigung bedurfte. Das erscheint mir immer noch bedeutend weniger scheinheilig als manche Leute, die es einerseits für selbstverständlich halten, dass es böse ist, einem Tier Leid zuzufügen, andererseits aber solche Unmengen von Rippenfleisch bestellen, dass sie gar nicht alles aufessen können. Oder etwa nicht?« bemerkte Gotoda in einem bitteren Ton.
Rei suchte nach Worten, um etwas darauf erwidern zu können, aber er fand keine. Rei hielt sich selbst für einen logisch denkenden Menschen, aber genau betrachtet schien ihn gar nicht viel von dem klassischen nutzlosen Intellektuellen zu unterscheiden, der zwar in seinem Reden logisch, in seinem Handeln aber unlogisch war und der das zu allem Überfluss noch nicht einmal wahrnahm. Sich für die Logik opfern.. diese Phrase tauchte auf einmal in Reis Kopf auf, aber noch bevor er sie unter die Lupe nehmen konnte, fuhr der Alte bereits mit seiner Erzählung fort.
»Nicht nur die Moralphilosophen dieser Zeit, auch viele andere Menschen hielten die Jagd und den Fleischverzehr für etwas Bedenkliches, das der Rechtfertigung bedurfte. Und diese Skepsis und Zweifel bezüglich des Fleischverzehrs brachten bald Zweifel am Menschsein selbst hervor. Wenn die Jagd und der Fleischverzehr seit alters her unvermeidliche, aber der Ethik widersprechende Tätigkeiten des Menschen waren, dann war auch etwas Wahres an der Jäger-Hypothese. So kam es, dass der Killer-Menschenaffe vom Anfang meiner Erzählung in. der europäischen Literatur des 18.Jahrhunderts auftauchte.
»Gullivers Reisen von Swift dürftest du ja kennen«, sagte
Gotoda zu Rei. »Ja.«
»Hast du's auch gelesen?«
»Als kleines Kind, als Bilderbuch.«
»Es geht um den letzten Teil. Die Wilden, die im Land der menschlichen Pferde wohnen. Kaum der passende Stoff für ein Bilderbuch.«
»Ich bin etwas müde. Dürfte ich auch um einen Schluck bitten?«
Rei zögerte einen Moment, stand dann aber auf und brachte ein Glas vom Getränkewagen, das Gotoda mit Scotch füllte. Der Alte nahm einen winzigen Schluck, schloss die Augen und rührte sich nicht. Über den Menschen zu erzählen war schon ermüdend und vom Menschen in gerechter Weise als Tier zu erzählen wohl noch viel mehr. Da war es verständlich, dass selbst dieser anscheinend stählerne Alte ab und an eine Pause benötigte. Daran dachte Rei vage, während er seine Zigarette rauchte und darauf wartete, dass der alte Mann die Augen öffnete. Er fragte sich, was Gotoda wohl gerade dachte.
Auch nachdem die Zigarette sich in Asche verwandelt hatte, machte der Alte keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Gerade als Rei ein mulmiges Gefühl bekam und aufstehen wollte, um nachzusehen, begann der alte Mann mit geschlossenen Augen zu erzählen:
»Bis in die zweite Hälfte des 18.Jahrhunderts waren die meisten Intellektuellen nicht sehr erbaut, wenn man ihnen erzählte, dass der Mensch wenig mehr als ein Tier sei, noch dazu nicht mal ein besonders gutmütiges. Rousseau, Voltaire, Buffon... Alle scheinen sie den Menschen herabsetzen zu wollen, machte Johann Gottfried von Herder seinem Ärger damals Luft. Die jungen Intellektuellen Deutschlands und Frankreichs empfanden immer mehr Abneigung gegen den Materialismus und Empirismus der Aufklärer, was zur Geburt der romantischen Bewegung führte.«
Der alte Mann öffnete die Augen.
»Die führenden Denker der Aufklärung waren Materialisten, die den Geist als eine Funktion des Körpers sahen. Die Romantiker hingegen nahmen eine Anregung von Kant auf und gingen davon aus, dass die Materie selbst nur ein großes geistiges Phänomen sei. Aber wie haben sie das Verhältnis von Mensch und Tier gesehen? Ihre Haltung gegenüber den Tieren war aus einer rätselhaften Mischung von Zuneigung und Abneigung bestimmt. Wilde Tiere waren für sie minderwertige Bestien, zugleich aber Indikatoren, die auf Gott hindeuteten. Der Mensch war höherwertig und der wilden Bestie überlegen, er bemerkt den hinter der Welt existierenden Geist. Aber wegen seines Bewusstseins von sich selbst kann er nur für einen Augenblick an der Welt teilhaben. Shelleys Lerche ist von einer tiefen, unbewussten Freude erfüllt, die ein Mensch niemals empfinden kann. Die Romantiker verabscheuten die Jagd und den Fleischverzehr und kritisierten, dass die Menschen die Tiere ausbeuten. Aber wieso war das Reich der Tiere, wieso waren die Geschöpfe dieser Welt, in der doch Gottes Güte erkennbar sein müsste, so voller Raubtiere und Parasiten? Raubtiere, die in all ihrer Bosheit geschaffen worden waren, auf dass sie die Abfolge von Fressen und Gefressenwerden fortsetzten? Das konnten die Romantiker nicht verstehen und quälten sich damit. Blake, der das Problem frontal anging, glaubte im Morden in der Natur göttlichen Willen zu spüren. Tennyson beklagte, dass die Natur ein Räuber sei. Niemand, auch Theo logen und Philosophen nicht, konnte eine befriedigende Antwort für dieses Problem finden. Aber tatsächlich gab es Schlimmeres als die Leiden und der Tod des einzelnen Tiers vor den eigenen Augen. Der Fortschritt der Geologie förderte mit zahlreichen Fossilien Beweise dafür zutage, dass auch das Leben ganzer Arten endlich ist und dass fast alle Lebewesen, die früher einmal existierten, heute ausgestorben sind. Die Unbarmherzigkeit Gottes gegenüber seinen eigenen Geschöpfen einschließlich des Menschen war damit offensichtlich.«
»Ein Aufschrei der Natur aus abgerutschten Hängen und herausgeschnittenen Steinen ... Tausende von Arten sind erloschen.
Es interessiert mich nicht, sollen sie doch alle vergeben«, murmelte Gotoda und leerte sein Glas.
»Ich nehme an, du hast mal wieder vergessen, von wem das Zitat stammt?« fragte Rei.
Ja. Und das ist auch besser so«, antwortete Gotoda.
»Um all diese Schmerzen, all dieses Leid, den Tod und das Aussterben mit einem höheren Ziel verbinden zu können, war eine bessere, klarere Rechtfertigung für die Grausamkeit der Natur notwendig. Und diese lieferte schließlich Darwin.«
»Der Fortschrittsglaube war noch relativ jung. Bis zum 17. Jahrhundert herrschte in weiten Teilen Europas ein Geschichtsbild vor, das davon ausging, dass die Welt ebenso wie ihre Menschen von den goldenen Zeiten des Altertums bis in die Gegenwart immer schlechter geworden seien. Die durch die Bibel gefestigte Erzählung vom Garten Eden und vom Sündenfall war ein Teil der göttlichen Geschichte des Judentums und gleichermaßen Teil der christlichen Lehre. Aber diese alte These vom Niedergang des Naturmenschen wurde mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Revolution durch eine optimistischere Vorstellung ersetzt, wonach sich die Dinge im Verlauf der Zeit zum Besseren verändern. Dieser Fortschrittsglaube hatte auch Einfluss auf das Denken über eine höhere Ordnung betreffend der Natur und der Position von uns Menschen in ihr. Die Denker des Christentums hatten die Stufen der Schöpfung als eine riesige scala naturae, eine Leiter der Natur, beschrieben, auf welcher alles von den toten Dingen über die Pflanzen und das Tierreich bis hin zum Territorium der Engel, die als unverfälschte Geistwesen den Gipfel bildeten, existierte. Diese Ordnung war jetzt, genauso wie die gesellschaftliche Ordnung, kein System stillstehender Schichten mehr, sie war in einen fortwährenden historischen Prozess, eine Art Rolltreppe zum Besseren, verwandelt worden. Man dachte, dass alle Wesen auf dieser Leiter nach oben kletterten, um in Richtung Gott zu streben. Niedere Lebewesen strebten danach, höhere zu sein, die Tiere danach, Menschen zu sein und die Menschen danach, ihre Geistigkeit zu erhöhen, um eines Tages ins Reich der Engel zu gelangen. Der visionäre französische Biologe Charles Bonnet beschrieb die Vision einer Erde in ferner Zukunft, auf welcher der Mensch sich zu einem Lebewesen höherer Ordnung entwickelt hat und von den ebenfalls weiterentwickelten wilden Tieren ersetzt wird. Diese Art von mysteriösen Visionen und Phantasien wurde zum Beet, auf dem die biologische Evolutionstheorie heranwuchs. Spekulative Biologen wie Erasmus Darwin oder Lamarck verlautbarten, dass in der Entwicklung von den Vorfahren niederer Ordnung bis zu den heutigen Pflanzen und Tieren ein inneres Prinzip wirksam sei, das zum Streben nach zunehmender Vervollkommnung führe - womit sie aus dem Konzept, das der wissenschaftlichen Fortschrittstheorie zugrunde lag, eine Art pseudowissenschaftliche Erzählung machten. Diese evolutionsartigen Gedanken fanden auch die Unterstützung von Geologen.« Nachdem der alte Mann die Vorgeschichte der Evolutionstheorie kurz und bündig zusammengefasst hatte, wandte er sich an Rei. »Ist es dir recht, wenn ich darauf verzichte, die mechanistische These vom Fortschritt der Arten durch natürliche Auslese, wie sie von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace verkündet wurde, hier darzulegen?«
»Über die Entstehung der Arten hab ich gelesen.« Rei, der durch die Rücksichtnahme des Alten in seinem Stolz verletzt worden war, fragte sich, ob der Alte ihn etwa für einen Mittelschüler hielt. Unter den Aktivisten galt Darwins Über die Entstehung der Arten als eine Pflichtlektüre für die ideologische Weiterbildung. Rei hatte seine Ausgabe beim Antiquar erstanden und unter Flüchen über den schlechten Stil der Übersetzung zu Ende gelesen.
»Darwins grundsätzliche Idee war, die Gestaltungskraft innerhalb der Natur einem blinden Mechanismus zuzuschreiben, der ohne Einwirkung eines göttlichen Plans auskam, besaß also mechanistische Eigentümlichkeiten. Darwin interpretierte zwei sich widersprechende Themen - das von Romantikern erträumte geistige höher streben der Naturwelt und die Grausamkeit und Unbarmherzigkeit derselben, welche die Romantiker so gequält hatte - als einen materiellen Existenzkampf um und erklärte sie zu zwei Aspekten ein und desselben Systems. Andererseits ist die Ähnlichkeit zwischen dem Nichteinmischungsprinzip des Darwinismus und den politisch-ökon0mischen Theorien der viktorianischen Zeit nicht zu übersehen. Der Einfluss der Gesellschaftstheorien von Malthus und Spencer auf Darwin dürfte dabei größer gewesen sein als umgekehrt. Malthus argumentierte in seinem Versuch über ein Bevölkerungsgesetz, dass man die Kinder der Armen dem Hunger überlassen müsse, um die Gesellschaft vor dem Untergang zu bewahren. Spencers Theorie vom Überleben des Anpassungsfähigsten befürwortete das grausame Schicksal der Armen im unkontrollierten Kapitalismus, indem er es mit dem unerbittlichen Naturgesetz der Auslese innerhalb der Arten verglich. Zweifellos haben diese Vorstellungen bei Darwin und Wallace Pate gestanden, als sie die Idee von der natürlichen Auslese hatten.«
Auch Spencer und Malthus waren ein Teil der »kritisch zu lesenden« Pflichtlektüre, aber Rei fehlte es völlig an Interesse für Wirtschaftswissenschaften, und er hatte noch nichts von ihnen gelesen.
»Tatsächlich argumentiert Darwin folgendermaßen: Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Mensch zu so hohem Rang fortgeschritten ist, weil er als Ergebnis seiner rasanten Vermehrung einen Kampf ums Dasein durchlaufen hat. Und wenn der Mensch zu etwas noch höherem fortschreiten will, dann muss er zum Gegenstand eines erbitterten Wettbewerbs werden. Unsere natürliche Vermehrungsrate ist mit vielen offensichtlichen Übeln verbunden, aber sie wird sich unter keinen Umständen wesentlich verringern. Der Überlegenste ist am erfolgreichsten und hinterlässt die meisten Nachfahren, woran ihn weder Gesetze noch Sitten hindern dürfen... Der Keim des Sozialdarwinismus, der später heftig kritisiert wurde, weil er den unmenschlichen Wettlauf der Industrialisierung und die Klassenstruktur der Gesellschaft bejahte, lag also bereits in Darwins Theorien.«
Der alte Mann nippte wieder an seinem Scotch.
»Die Anziehungskraft, die der Darwinismus auf uns ausübt, liegt allerdings darin, dass er das philosophische Problem des Leidens der Tiere beseitigte. Darwin löste die Grausamkeit der Natur nicht einfach nur als etwas Ungewolltes auf, sondern lobte sie vielmehr als treibende Kraft der Evolution. Der erhabene Schluss von Über die Entstehung der Arten fasst die Rechtfertigung des Darwinismus für die Schlechtigkeit der Natur und das Leid der Tiere noch einmal zusammen.«
»So geht aus dem Kampf der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen: die Erzeugung immer höherer und immer vollkommenerer Tiere. Es ist wahrhaftig eine großartige Ansicht des Lebens ...«
Eigentlich hatte Rei das Buch gelesen, aber er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass es mit diesem Satz endete. Aber so war das eben, wenn man ohne Problembewusstsein nur zu Bildungszwecken las. Nicht dass es einen Wert an sich hätte, so etwas auswendig zu wissen. Aber es war sicherlich immer noch besser, sich daran zu erinnern, als es einfach zu vergessen. Rei beschlichen langsam Zweifel, ob in den Köpfen der beiden alles mir rechten Dingen zuging.
»Ein bitterer Pessimismus bezüglich der Grausamkeit der Natur ist Teil der Weltsicht von Darwins Theorie. Das weckt die Erwartung, dass sie gut mit der späteren Jäger-Hypothese zusammenpasst. Und tatsächlich war unter den Thesen, die als Erklärungen zum Ursprung der Menschheit vorgeschlagen wurden, die Jäger-Hypothese die erste, die rein darwinistisch war. Merkwürdigerweise hat Darwin selbst allerdings nicht allzu viel über die Evolution des Menschen gesagt. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1871 äußert er sich ein wenig über seine These, aber darin erklärt er die Besonderheiten des Menschen in keiner Weise als Anpassung an irgend etwas. Dieser Aufsatz war eigentlich undarwinistisch. Darwin dachte, dass die Herrschaft des Menschen über die Natur den Ursprung des Menschen selbstredend erklärte. Aus Sicht seiner eigenen Theorie ist das so, als ob er gar nichts gesagt hätte. Nach seiner These haben sich die Eigentümlichkeiten des Menschen bei Primaten wie den Menschenaffen auf natürliche Weise durch Evolution entwickelt. Aber wenn alle Menschenaffen die Tendenz haben, sich zu Menschen zu entwickeln, weshalb existieren dann immer noch Primaten, die keine Menschen, sondern immer noch Menschenaffen sind? Die Idee einer vorab festgelegten Ausrichtung der menschlichen Evolution hat Clark mit seiner Theorie über die Evolution der Primaten ergänzt. Demnach ist der Grund dafür, dass die anderen existierenden Primaten nicht zu Menschen geworden sind, der, dass ihre Vorfahren sich spezialisierte Gewohnheiten wie das Hangeln an den Händen aneigneten und damit in eine evolutionäre Sackgasse gerieten. Ihre sekundäre Spezialisierung brachte sie damit von der Hauptroute der Evolution ab, die zur Spezies Mensch führte. Einfacher formuliert: Sie waren bei ihrer Entwicklung zum Menschen gescheitert, weil sie sich unterwegs zu sehr mit unnützen Dingen beschäftigt hatten.«
»Erstaunlicherweise stimmten von Darwins Zeiten bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts die meisten Anthropologen mit dieser auf Darwin selbst zurückgehenden undarwinistischen These überein. Die äußerst naheliegende Ansicht, dass sich die Eigentümlichkeiten des Menschen aus Spezialisierungen herleiten, die durch seine charakteristische Lebensweise bedingt sind, wurde, abgesehen von einigen wenigen Hypothesen, noch nicht einmal vernünftig diskutiert. Zu dem Zeitpunkt, als die Anthropologen in der Auseinandersetzung mit Anti darwinistischen Strömungen wie der Spontanmutationstheorie oder der reaktionär-romantischen Evolutionstheorie den Sieg davongetragen hatten, war es nicht mehr möglich, den Menschen einfach nur als das Produkt eines allgemeinen Evolutionsprozesses zu betrachten. Jetzt musste man beim Menschen genau wie bei anderen Tieren der Spur seines Anpassungsprozesses folgen, um zum Ursprung seiner besonderen Eigenschaften zu gelangen. Aber der Grund, weshalb die Anthropologen sich darüber freuten, war ein anderer.«
»Holocaust«, sagte Gotoda muffelig.
»Nach heutigen Maßstäben waren die meisten der Wissenschaftler, die von Darwins Epoche bis zum Beginn des 2. Weltkriegs die menschliche Evolution erforschten, erschreckende Rassisten. Sie glaubten, dass manche der menschlichen Rassen den Menschenaffen ähnlicher seien als andere, und der Ausdruck minderwertige Rassen wurde im Sinne eines biologischen Begriffs gebraucht. Bedauerlicherweise basierte auch dies auf einer bedeutsamen Tradition, die der Darwinismus mit sich gebracht hatte. Der Darwinismus war stets bemüht, die Lücke zwischen Mensch und Tier möglichst zu schließen. Fachleute wie Huxley und viele andere sahen diese sogenannten minderwertige Rassen oder Wilden als verbindendes Glied oder missing link zwischen dem Gorilla und Gentleman. Nach der gleichen Logik wurden die Nürnberger Rassengesetze erlassen und die Vernichtungslager in Auschwitz und anderswo gebaut. Die in der Tradition Ernst Häckels, dem prominentesten Vertreter der Lehren Darwins in Deutschland, ausgebildeten deutschen Anthropologen, die sich mit Eifer an den Plänen der Nazis zur sogenannten Rassensäuberung beteiligten und die ebenso rassistischen Naturanthropologen des englischen Sprachraums ... Sie alle besaßen den Eifer, den Stolz und die Überzeugung, die auch schon jenen Forschern eigen war, die im Descarteschen Rausch ihr Gewissen betäubt und rücksichtslos Tiere bei lebendigem Leibe seziert hatten.«
»Kraniometrie, Eugenik, Kriminalanthropologie ...« murmelte Gotoda erläuternd.
»Immer wenn der Mensch versucht, die menschlichen Fähigkeiten einem biologischen Determinismus zuzuschreiben, wird es praktisch unmöglich, Objektivität und Exaktheit vor dem Eindringen von kulturellen Faktoren wie Vorurteilen und diskriminierenden Gefühlen zu schützen. Die Forscher gaben zwar ihre Überzeugungen nicht sofort nach dem 2. Weltkrieg auf, aber im Schatten, den Auschwitz warf, wurde ihnen zumindest von Seiten der Intellektuellen kein Respekt mehr entgegengebracht. Der gesamte Gedanke einer Abstufung der menschlichen Rassen fand in den anthropologischen Strömungen der Nachkriegszeit keine Anerkennung mehr, ja er wurde zu einem Objekt der Abscheu, das ausgerottet werden musste. Allerdings gab es auch hier wieder ein Problem. Falls die Anthropologen die Einzigartigkeit und Gleichheit der Menschen anerkennen wollten, würden sie nicht umhinkönnen, eine eindeutige Trennlinie zwischen Menschen und Tieren zu ziehen. Tatsächlich vertreten heute eine ganze Reihe von Anthropologen und Sprachwissenschaftlern vehement die Ansicht, dass Sprache, Kultur und Geschichte des Menschen ein Phänomen sind, für das es keine Ähnlichkeit oder Vorläufer im Tierreich gibt. Leslie White etwa behauptet, dass den symbolischen Handlungen des Menschen eine Eigentümlichkeit innewohnt und bestreitet die Existenz einer Zwischenstufe zwischen Mensch und Tier. Noam Chomsky denkt, dass die Sprache durch eine seltsame Spontanmutation in einem Augenblick entstanden sei. Auf der anderen Seite ist die Abgrenzung des Menschen in der Klassifikation der Lebewesen abgeschwächt worden. Unsere primitivsten Verwandten in fossiler Form, der Javamensch und der Pekingmensch, wurden in die Gattung Mensch eingegliedert, der Neandertaler als Homo sapiens akzeptiert.«
»Alles Verwandte, alles Freunde! Die Menschenaffen sind eine Familie, die Welt verbrüdert sich. Klar, der effektive Schaden ist ja auch geringer, wenn man Fossilien zu Verwandten macht, als wenn man Gorillas und Orang-Utans zu Freunden macht«, sagte Gotoda beinahe verzweifelt.
Rei überlegte, ob Gotoda vielleicht schon betrunken sei und schaute ihm ins Gesicht, aber Gotodas Blick war stocknüchtern. »Und die fossilen Überreste eines Australopithecus, den man 1947 in einer Höhle in Transvaal entdeckt hat, ließ die Anthropologen das Wesen des Menschen, dem sie bisher so kritisch gegenübergestanden hatten, in neuem Licht sehen. So wurde die These, dass der Ursprung des Menschen mit seiner Anpassung an die Jagd zu tun hatte, aus wissenschaftlichen und politischen Gründen begrüßt. Die Jäger-Hypothese ging von erheblichen Anpassungsunterschieden zwischen Mensch und Menschenaffen aus, was einerseits die Theorie des Neo Darwinismus und andererseits aber auch die Forderung nach Gleichbehandlung der menschlichen Rassen zufriedenstellte.«
Der alte Mann trank den letzten Schluck aus seinem Glas und lehnte sich dann tief in seinen Stuhl zurück. Die lange Exkursion über die Grenzen zwischen Tier und Mensch näherte sich endlich wieder dem Ausgangspunkt. Es hatte lange, ja geradezu unerträglich lange gedauert, aber Rei hatte immer noch keine Ahnung, worauf der Alte eigentlich hinauswollte. Offen gesagt war der einzige Eindruck, den er dem riesigen Wortschwall des Alten entnahm, der, dass sich hier jemand unverständlicherweise mit großer intellektueller Leidenschaft daran klammerte, dass der Mensch ein Mensch ist.
»Stärker als die vorhergehenden Evolutionstheorien hatte die Jäger-Hypothese eine klare Trennungslinie zwischen Mensch und Tier gezogen. Einige Anthropologen fühlten sich von dem unverbesserlichen Pessimismus und der Misanthropie, die Darts These innewohnte, abgestoßen und kritisierten ihn, aber diese Kritiker begannen ihrerseits nach einem anderen Anpassungsprozess zu suchen, der die Anfänge des Menschenaffen als Mensch abgrenzen könnte. Wir Menschen versuchen unablässig, die Trennung zwischen Natur und Geschichte zu zementieren, um so die Idee der Eigentümlichkeit des Menschen zu stützen und das Menschliche aus den Beschränkungen der Natur herauszunehmen. Ein großes Gehirn, der aufrechte Gang, die Sprache, die Technik. Und zwar weil wir in all diesen Dingen eigentümliche und universale menschliche Eigenschaften sehen wollen, die als Zeichen der Position des Menschen eine mystische Bedeutsamkeit besitzen. Indem wir sie als eigentümliche Eigenschaften des Menschen betrachten, rechtfertigen wir die Herrschaft des Menschen über die Tiere, und indem wir sie für universale Eigenschaften halten, verbieten wir es, eine Herrschaft über den Menschen zu rechtfertigen. Diese Voraussetzungen sollten hilfreich sein, wenn man erklären will, weshalb die Wissenschaftler immer dann ungehalten reagieren, wenn jemand davon ausgeht, dass Gefühle, ein Wille und Begabungen auch in Tieren existieren. Der Delphin mit seinem großen Gehirn, der Schimpanse, der Werkzeuge benutzt, der Gorilla, der mit seinen Händen Zeichen gibt, der Hund, der die Worte seines Herren versteht ...Tiere, die diese charakteristisch menschlichen Eigenschaften besitzen, ängstigen uns, aber um diese Ängste ausräumen zu können, wird von den Wissenschaftlern im großen Maße schöpferische Begabung darauf verwendet, sie neu zu definieren. Funktionen werden eingeführt, um die Gehirngrößen von Menschen und Tieren relativieren zu können, man erklärt, dass das Charakteristikum der Sprache, die Denken und Bewusstsein voraussetzt, nicht ihre Bedeutung, sondern ihre Syntax sei. Selbst Forscher, die den Menschen nur für ein einfaches, dummes Tier halten, tun sich schwer damit, Tiere als dumme Menschen zu betrachten. Wenn Menschen mit Vokabular aus der Tierwelt beschrieben werden, ist das wissenschaftlich, aber wenn von Tieren in den Begriffen des Menschen erzählt wird, gilt das als unwissenschaftliche Vermenschlichung und wird kritisiert und geschmäht.«
Rei hatte plötzlich das Gefühl, dass die auf die Wände gemalten Tiere eine Art Zuhörerschaft für den Alten bei seiner Erzählung von Menschen und Tieren bildeten. Nein, das Wort Zuhörer war nicht ganz korrekt. Vielleicht sollte man sie besser Publikum oder Geschworene nennen. Dann wäre das kein Andachtsraum, wie er das anfangs empfunden hatte, sondern eher ein Gerichtssaal, in dem die Menschen vor Gericht stünden. Aber wenn das so war, konnte der Alte kein Verteidiger sein. Mit einer gefassten aber zugleich unerbittlichen Stimme fuhr der Alte wie ein Staatsanwalt bei seinem Schlussplädoyer fort.
»Unsere Kultur baut ganz wesentlich darauf auf, dass wir eine Person als einer anderen Person überlegen betrachten. Immer wieder haben wir intellektuelle Anstrengungen unternommen, um diese Unterscheidung, oder von mir aus auch Diskriminierung, zu rechtfertigen. Männer und Frauen, Herren und Sklaven, weiße und farbige Rassen. Und weil wir die kognitive Unterteilung zwischen Mensch und Tier, also die Unterscheidung zwischen Geschichte und Natur, nicht aufrechterhalten konnten, sind wir bereits soweit in die Enge getrieben worden, dass wir es nicht mehr schaffen, die Erhabenheit des Menschen zu bewahren. Das würde bedeuten, dass der Mensch aufhören müsste, die Welt außerhalb von sich selbst wie sein Instrument zu gebrauchen. Schon Darwin hat anerkannt, dass es zwischen den geistigen Fähigkeiten der Menschen und denen der höherrangigen Säugetiere keinen grundsätzlichen Unterschied gibt. Wenn wir das akzeptieren und uns für die Rechte der Tiere einsetzen und die Erhabenheit des Menschen auf unsere stummen Verwandten ausdehnen, dann ist - unabhängig davon, ob wir den Menschen als Tier anerkennen - daraus nichts anderes zu folgern, als dass die Tiere in einem gewissen Sinne Mensch sein müssen.«
»Und alles beginnt von vorne«, murmelte Gotoda.
»Um die nun endlich erlangten Einsichten in die Kontinuität zwischen Mensch und Tier mit der mühevoll erlangten Ansicht von den universalen Rechten und der Würde des Menschen in Übereinstimmung bringen zu können, müssten wir die Grundlagen des Daseins der Tiere in der Anerkennung ihrer Rechte und ihrer Würde entdecken. Das freilich ist unmöglich, und zwar unabhängig von der Frage, ob wir die gewohnheitsmäßige Ausbeutung der Tiere, etwa durch Tierversuche, Pelzkleidung und Fleischverzehr, aufgeben, weil der Mensch noch nicht einmal das Wesen seiner eigenen Existenz aufklären kann.«
Während Rei darauf wartete, dass der Alte mit seiner Erzählung fortfuhr, hatte er das merkwürdige und irritierende Gefühl, dass die stummen Tiere an der Wand ihre Blicke auf den Alten gerichtet hatten und die Ohren spitzten, um sich keines seiner Worte entgehen zu lassen.
»Der Mensch hat schon zu viel über den Menschen gesagt.
Das einzige Ergebnis war, dass er es damit nur noch schwieriger gemacht hat, etwas über ihn zu sagen. Er hat sich die Hände schon zu sehr schmutzig gemacht, als dass er jetzt noch etwas über ihn als Tier sagen könnte.« In aller Ruhe setzte der alte Mann seinen Vortrag fort: »Wenn der Mensch über seinen eigenen Ursprung reden will, wird er unweigerlich von einem bösen Schatten verfolgt, unabhängig davon, ob die Jäger-Hypothese wissenschaftlich ist oder nicht. Selbst wenn sie nur eine Ursprungssage wäre, die man sich erträumt hat, um die unsichere Grenze zu rechtfertigen, die zwischen dem Territorium der Menschen und dem unbewussten Reich der Tier gezogen ist, muss es hinter ihr doch eine Wahrheit geben, so wie hinter allen Sagen etwas Wahres existiert.«
»Die Existenz der blutsaugenden Menschenaffen«, sagte Gotoda, um die Schlussfolgerung des Alten zu beschleunigen. »Die Kausalzusammenhänge der Evolution zu erklären, ist schon keine einfache Aufgabe. Und wenn als Schlussfolgerung die Einzigartigkeit des Menschen stehen soll, wird das Ganze gar unmöglich. Der Grund dafür ist, dass, wann immer man etwas erklären will, man es als Beispiel einer Regel, die aus einer Vielzahl anderer Fälle vertraut ist, deutet. Aber wie Hume schon vor langer Zeit hervorgehoben hat, kann die Wissenschaft nichts über individuelle Phänomene sagen, wenn diese sich nicht auf ein größeres, allgemeineres Muster übertragen lassen. Die einzige evolutionäre Veränderung, bei der man auf eine solche Erklärung hoffen kann, ist der sogenannte Parallelismus, also eine wiederholt auftretende Veränderung, die aus den gleichen strukturellen oder Anpassungsgründen mehrmals in unterschiedlichen Stammlinien auftritt.«
Der alte Mann wandte sein Gesicht Rei zu und stellte ihm eine Frage: »Du bist einer der ganz wenigen Menschen die es zweimal gesehen haben. Ich möchte gerne wissen, an was es dich erinnert hat.«
Rei rief sich die Gestalt dieses abscheulichen Monstrums, das er erst vor wenigen Stunden gesehen hatte, ins Gedächtnis zurück. Eine riesige Fledermaus ... eine häßliche, nackte Ratte... Er hatte das Gefühl, dass es auf beides zu passen schien, aber gleichzeitig auch wieder nicht.
»Hast du vielleicht gedacht, dass es einem Menschen ähnelt?« Erschrocken hielt Rei den Atem an und blickte auf. Wenn man ihn so fragte ... Tatsächlich, es hatte zweifellos einem Menschen geähnelt. Natürlich war die Gestalt völlig andersartig, aber den Eindruck, den es auf ihn gemacht hatte, war der eines bösen Menschen, wenn nicht sogar der Eindruck menschlicher Bosheit selbst. Rei war so schockiert von dieser Tatsache, dass er keine Worte fand. Nachdem der alte Mann sich von der Wirkung seiner eigenen Frage überzeugt hatte, wandte er das Gesicht von Rei ab und fuhr fort:
»Angenommen, unsere Urahnen waren Menschenaffen, die sich auf das Jagen von Beute spezialisiert hatten, und angenommen, die anderen entwickelten sich parallel zu uns, um uns als Beute zu nutzen. Dann sollte es wissenschaftlich gesprochen gar nicht überraschend sein, wenn sie uns ähnelten. Sie sind Wesen, die unsere eigene böse Gestalt getreulich wie ein Spiegel abbilden. Das meinte ich, als ich vorhin sagte, dass sie Menschen sind.«
Der alte Mann sprach immer noch in einem ruhigen Ton, aber in Reis Ohren klangen seine Worte irgendwie traurig. Aber vielleicht wollte Rei sich das auch nur einreden.
»Und deshalb zieht ihr durch die Gegend und bringt sie um?« Auch Gotodas Stimme klang nach wie vor gleichgültig, aber sein Gesicht zeigte einen Anflug von Betrübnis, den Rei bis jetzt an ihm nicht hatte entdecken können. Der alte Mann antwortete nicht, aber sein Schweigen war beredt genug, Gotodas Frage zu bejahen.
Zumindest in ihrer Hoffnungslosigkeit bezüglich des Menschen waren diese beiden Männer Gefährten. ließ man Gotoda, der nach außen hin bloß wie das Klischee eines schäbigen Mannes um die Vierzig aussah, einmal beiseite ... Die Tatsache, dass dieser alte Mann, an dessen Wissensreichtum Rei nicht einmal im Traum herankam, an seinem Lebensabend zu dem Schluss gekommen war, dass er seine Zeit damit verbracht hatte, Ebenbilder des Menschen zu zerstören, erschien Rei unsagbar grausam und fürchterlich.
»Wenn das so ist, wieso macht ihr es nicht öffentlich? Mit der Leiche, die ihr eingesackt habt, gäbe es sogar handfeste Beweise!«
»Unsere Aufgabe ist es nicht einfach, die anderen auszulöschen. Sie besteht auch darin, ihre Existenz an sich zu verheimlichen. Das Einsammeln ihrer Leichen ist deshalb eine noch wichtigere Aufgabe als das Töten selbst. Denk doch einmal nach! Darts Behauptung war nicht mehr als eine Hypothese, die auf dürftigen Beweisen fußte, und trotzdem hat sie so heftige Kritik hervorgerufen. Glaubst du, es würde irgendeinen Menschen freuen, Beweise dafür zu sehen, dass das Ebenbild des Menschen seinem Wesen nach ein abscheuliches Monstrum ist? Unsere gegenwärtige Gesellschaft ist auf der Illusion erbaut, dass der Mensch, trotz mannigfaltiger Mängel, seinem Wesen nach gut ist.Was, wenn die Menschen jetzt erführen, dass der Mensch seit dem Beginn der Evolution des Menschenaffen böse war und dass er das Kainsmal auch jetzt noch auf seiner Stirn trägt? Um Missverständnisse zu vermeiden ... Ich fürchte nicht, dass man mich kritisieren könnte oder dass sich eine Panik ausbreiten könnte. Was ich fürchte ist, dass das Gerede vom Niedergang der Menschheit auf diese Weise mit einer ethischen Begründung untermauert werden könnte.«
»Trotzdem! Ist deren Existenz nicht tatsächlich eine Bedrohung für uns? Es ist doch eine Tatsache, dass eine ganze Anzahl Leute ermordet wurden«, protestierte Rei, ohne daran zu denken, dass es letztendlich der alte Mann gewesen war, der ihn davor gerettet hatte, selbst zu diesen Opfern zu zählen.
»Es kommt nur sehr selten vor, dass sie Menschen töten. Das liegt auch auf der Hand, wenn man sich klarmacht, dass es für einen Parasiten praktisch Selbstmord ist, seinen Wirt zu töten. Mehr noch, da sie über eine hochentwickelte Intelligenz verfügen, ist davon auszugehen, dass sie nicht so ineffektiv vorgehen, herumzuziehen und ihre Wirte einfach per Zufall auszuwählen. Zumindest seit der Moderne halten sie sich bevorzugt in dicht besiedelten Gebieten auf und verstehen es sehr geschickt, sich speziell in isolierte Kleingruppen einzuschleichen, deren Mitglieder sie dann ins Visier nehmen. Wir nennen so eine Gruppe einen Harem, aber manche Leute bevorzugen die nüchternere Bezeichnung Futterplatz oder Jagdrevier. Das System des Blutsaugens selbst konnte noch nicht im Einzelnen erklärt werden, aber wie es aussieht, entwickeln die von ihnen befallenen Wirtsmenschen eine hochgradige psychische Abhängigkeit ihnen gegenüber. Sie bieten ihr Blut dann nicht nur freiwillig an, sondern locken auf Befehl auch neue Wirtsobjekte in die Gruppe. Das können sogar Blutsverwandte und Freunde sein.«
»Natürlich, Herrscher und Gefolgsmann.« knurrte Gotoda bewundernd, und Rei musste an Aokis seltsame Veränderung und das intensive Charisma dieses Kariya denken.
»Nüchtern betrachtet ist ihre Fortpflanzungskraft, ähnlich der vieler langlebiger Arten, extrem gering, und ihre absolute Zahl ist nicht annähernd mit der Zahl der Menschen vergleichbar. Man könnte sie durchaus auch als eine seltene Art betrachten. Der Grad der Bedrohung, den sie für den Menschen darstellen, ist, biologisch formuliert, bei weitem nicht so hoch wie etwa der des Influenza-Virus und nur geringfügig höher als der des Weißhais. Wenn sie eine Bedrohung darstellen, dann am ehesten noch, weil ihre Existenz, ähnlich wie bei den Vampiren aus den Legenden, eine moralische Krise für den Menschen mit sich bringt. Wie ich bereits erwähnte, sind Fälle wie der jetzige, bei dem der Harem sozusagen aufgefressen wird, äußerst selten. Vermutlich ist es eine Art Warnung an uns, weil wir uns ihnen unvorsichtigerweise genähert haben. Unsere Aktivitäten in diesem Land stehen noch ganz am Anfang.«
»Der Kerl, ich meine der, der vor Saya abgehauen ist, hat versucht mich auszufragen, was wir über sie wissen.«
»Sie befinden sich in einer Art Krieg mit uns, für sie ist es ein Kampf ums Überleben. Es wird also kaum eine so einseitige Angelegenheit werden wie bei der Ausrottung der Wandertaube oder des Dodo durch den Menschen. Sie besitzen ein Gehirn, das dem unseren ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen ist. Und was ihre körperlichen Fähigkeiten betrifft...«
»... dürften sie die mächtigsten Primaten sein, die je gelebt haben. Und mehr noch, sobald Gefahr droht, benutzen sie ihre Schwingen und nehmen Reißaus.«
Der Alte nahm diese Witzelei Gotodas zum Anlass, sich neu zu positionieren.
»Ich wäre damit am Ende meines Vortrags angekommen.
Jetzt hätte ich einige Fragen an Sie beide.«
Rei spürte, dass in dem ruhigen Tonfall des Alten eine gewisse Schärfe verborgen war und spannte seine Rückenmuskulatur an.
»Bei euch - ich rede von dir, junger Mann, und deinen Freunden - bin ich darüber im Bilde, weshalb ihr euch in unsere Arbeit eingemischt habt. Es war ein unglücklicher Zufall, dass der einzige Augenzeuge bei einem unserer Fänge ausgerechnet einen ihrer Gefolgsmänner zum Freund hatte. Wir haben alles mögliche ausprobiert, euch aus dieser Sache herauszuhalten, aber ...«
»Dann hast du dafür gesorgt, dass Doigaku und Amano verhaftet und wir eingeschüchtert werden?!« Rei hatte zwar schon damit gerechnet, aber im Augenblick, als sich herausstellte, dass es tatsächlich so war, musste er dem Ärger in seiner Brust Luft machen.
»Es geschah zu ihrem eigenen Schutz! Ich möchte nicht bestreiten, dass damit auch eine gewisse Warnung verbunden war, aber es geschah alles aus Sorge um eure Unversehrtheit.« Der alte Mann schien sich nichts aus Reis Erregung zu machen und wandte sich jetzt an Gotoda. »Das Problem war eher, dass es jemanden gab, der die jungen Leute angestiftet und veranlasst hat, dass sie in unserem Umfeld herumschnüffeln. Also, ich möchte jetzt von Ihnen erfahren, wer Sie sind und was Sie alles über uns wissen.«
»Ich bin ein einfacher Beamter.«
»Nach einem Bericht, der mir vorliegt, gibt es im ersten kriminalpolizeilichen Dezernat des Polizeipräsidiums keinen Mitarbeiter namens Gotoda.«
»So was, dann habt ihr es also gewusst?«
Rei drehte sich vor Schreck nach Gotoda um, der seinen Mund verzog und sein bekanntes hyänenartig hämisches Lachen ertönen ließ.
SECHSTER TEIL
Rei war es schon immer so vorgekommen, dass Gotoda für einen Polizisten einfach zu ausgefallen - oder besser gesagt daneben - war. Aber als Gotoda jetzt ohne Umschweife vor Rei zugab, dass er kein echter Polizist war, wurde Reis Innerstes heftig aufgewühlt. Reis Überzeugungen hätten es ihm im Normalfall verboten, mit einem Polizisten zusammenzuarbeiten. Aber wenn Gotoda nicht einmal ein Polizist war, stellte sich die Frage, mit wem sie hier überhaupt gemeinsame Sache machten. Wenn Rei diese Frage jetzt nicht klärte, würde er Murasakino und Nabeta und erst recht Doigaku und Amano niemals wieder ins Gesicht schauen können. In seiner Bestürzung spielte Rei alle denkbaren Varianten durch, von Journalist über Wissenschaftler bis hin zu CIA oder KGB, aber zu Reis großer Verlegenheit schien nichts davon so recht zu dem Mann um die Vierzig vor ihm zu passen.
»Wer bist du?« wiederholte Rei die Frage, die er Gotoda schon bei seiner ersten Begegnung gestellt hatte. »Wofür hast du uns benutzt? Los, antworte!« Als wolle er dem alten Mann die Schau stehlen, ging Rei Gotoda jetzt heftig an, aber ähnlich wie bei diesem zeigte sich Gotoda von Reis Zähne fletschen wenig beeindruckt.
»Nun, da du dir die Mühe gemacht hast, uns hier lang und breit einen Vortrag zu halten, will ich mal nicht so sein und mache einen Vorschlag: Ich rede. Aber unter der Bedingung, dass der Junge unbehelligt nach Hause gehen darf.« Mit unverändert herablassender Haltung und überheblichem Ton ging Gotoda schließlich auf die Frage des Alten ein. »Er ist nur ein kleiner Oberschüler, ein Systemgegner von mir aus, der ein wenig über motiviert ist und eine besondere Begabung fürs Herum diskutieren hat. Der Bursche ist zweifellos arrogant und lässt es an Manieren gegenüber älteren Leuten fehlen, aber er ist nicht so doof, dass er sein ganzes Leben ruiniert, indem er etwas von dem, was du im gerade erzählt hast, auf ein Flugblatt druckt und es vor dem Hauptbahnhof verteilt. Ich finde, dass man ihn gefahrlos laufen lassen könnte, oder etwa nicht?«
»Wie bitte?« brüllte Rei und sprang von seinem Stuhl auf, aber weder Gotoda noch der Alte beachteten ihn überhaupt. So hing Rei mit seinem unausgegorenen Ärger zwischen den beiden Kontrahenten und wusste nicht so recht, was er damit anfangen sollte. Also blieb ihm keine andere Wahl, als sich wieder zu setzen. Sie behandelten ihn wie Luft.
»Ich denke, das wird davon abhängen, ob unser beider Gespräch zu einem akzeptablen Ergebnis kommt. Wie ich eingangs bereits sagte, gehört es zu unseren Grundsätzen, nicht unnötig Blut zu vergießen.«
»Aber wenn's nötig ist schon, was?«
»Die weitere Interpretation überlasse ich Ihnen dir.« Der Alte machte keinerlei Anstalten nachzugeben.
»Na gut, wie unsere Lage aussieht, können wir's uns nicht leisten, wählerisch zu sein.«
»Darf ich das so verstehen, dass Sie es sich anders überlegt haben?«
»Habe ich«, antwortete Gotoda und sah den Alten dabei weiter urverwandt an. »Gerade eben.«
Rei goss sich eine großzügige Menge Scotch ein. Bei der Vorstellung, dass dieser Gotoda gerade sein eigenes Leben in Händen gehalten hatte, verspürte er ein unbändiges Verlangen nach einem Drink. Außerdem konnte er im Moment gar nichts anderes tun, als zu trinken und zuzuhören, was Gotoda zu erzählen hatte. Der Scotch, bei dem Rei sich fragte, ob es vielleicht sein letzter war, schmeckte nach nichts.
»Anfang des 19.Jahrhunderts gab es in Europa, genauer in Frankfurt, eine jüdische Familie, die einen unbedeutenden Gebrauchtwarenhandel mit Wechselstube führte. Nach Jahren harter Arbeit sollten der Vater und seine fünf Söhne endlich zu einem weltumspannenden Familienkonzern aufsteigen, der dank seiner Finanzmacht in der Lage war, die internationale Politik mitzubestimmen.«
Nach Anthropologie waren jetzt scheinbar Wirtschaftswissenschaften das Thema. Rei haderte mit seinem Schicksal, das ihn zwang, sich heute Abend einen Intensivkurs nach dem anderen anhören zu müssen. Beide Dozenten waren mehr oder weniger allwissend, außerdem fehlte das Wort »Ermüdung« offenbar in ihren Wortschätzen.
»Als Firmennamen verwendete die Familie einen Begriff, den sie aus ihrem seit Generationen überlieferten Familienwappen ableitete, das einen roten Schild zeigt. Später benutzten sie den Namen Rothschild auch als Familiennamen, der in leichten Abwandlungen bald in den wichtigsten europäischen Ländern Einzug hielt.«
Der Mund des schweigend lauschenden Alten verzog sich ein ganz klein wenig, wobei der Blick, mit dem er Gotoda ansah, etwas an Schärfe gewann. Unverwandt erwiderte Gotoda den Blick des Alten und fuhr fort:
»Am Anfang stand ein Postnetz, das nach dem Vorbild des Postwesens geschaffen wurde, das in Deutschland bestanden hatte, bevor das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in den Napoleonischen Kriegen auseinanderbrach. Die Rothschilds brachten dieses System auf Vordermann, wie man sagt, indem sie das Haus Thurn und Taxis, in dessen erblichen Besitz es sich befand, mit Finanzmitteln ausstatteten und bei der Erlangung freier Wegerechte innerhalb des Reichs unterstützten. Sie verfügten über Schnellboote, Postpferde, Brieftauben und gelegentlich setzten sie sogar das Jiddische zur Verschlüsselung von Nachrichten ein. Spezielle zweistöckige Pferdekutschen, an denen die als Rothschildfarben bekannte Flagge in den Farben Gelb und Grün flatterte, fuhren in ganz Europa herum. Bald befassten die Rothschilds sich auch mit Auslandsdiskontwechseln und internationalen Anleihen und dehnten ihre Geschäfte auf den Im-und Export von Baumwollwaren aus. Die Gewinne aus dem florierenden Postgeschäft investierten sie in Aktien und Anleihen. Sie etablierten ein weitreichendes und schnelles Informationsnetz, für das sie zudem Spezialisten ausbildeten. Am Anfang des 19.Jahrhunderts hatten sie bereits ein internationales Finanzsystem aufgebaut, das über die Grenzen der europäischen Länder hinweg operierte und das sie mit aller höchstem Geschick einzusetzen verstanden.«
Gotoda legte eine Pause ein.
»Zigarette bitte«, sagte er knapp zu Rei.
Mit sichtlichem Genuss zündete er sich die Long Peace, die ihm Rei gegeben hatte, an. Gotoda, der ähnlich wie der alte Mann und Rei zweifellos ein gesprächiger Mensch war, zeigte zum ersten Mal seit er diesen Raum betreten hatte, einen lebendigen Ausdruck auf seinem Gesicht.
»Die Geschichte dieser Familie ist auch Teil der europäischen Geschichte. Zu Zeiten der Kontinentalsperre unter der Herrschaft Napoleons machten sie riesige Profite,indem sie englische Waren auf den Kontinent schmuggelten. Das europäische Netzwerk der Rothschilds wurde so, wie es war, zum Informationsnetz und zur Lebensader der Front gegen Napoleon. Die Rothschilds finanzierten die Kriegsausgaben der gegen Napoleon gerichteten Koalition, transportierten unter abenteuerlichen Umständen die Kriegskasse Wellingtons und betätigten sich auf vielfältige Weise als Hintermänner der Front gegen Napoleon. Natürlich vergaßen sie darüber ihre Geschäfte nicht. Bei der Schlacht von Waterloo, die über das Schicksal Napoleons entscheiden sollte, ließen sie die Kurse der Staatsanleihen an der Londoner Börse absichtlich zusammenbrechen, um die Anleihen daraufhin aufzukaufen und so ein Vermögen zu verdienen. Als nach dem Krieg auf dem Aachener Kongress die alten Kräfte Europas über die Verteilung der französischen Entschädigungszahlungen entschieden, schafften die Rothschilds es, den Kurs der französischen Staatsanleihen abstürzen zu lassen, womit sie Bestrebungen der alten Kräfte vereitelten, die neu aufstrebenden Kräfte aus dem Weg zu räumen.Trotz ihrer gesellschaftlich benachteiligten Stellung als Juden gelang es den Rothschilds, sich die Position der Bank der Heiligen Allianz und die des Hauses Habsburg zu sichern. Fortan mussten sie allerdings damit leben, als Metternichs Wucherer oder Bankiers der Reaktion diffamiert zu werden. In der Folgezeit nutzten sie geschickt die Möglichkeiten des Wiener Systems und machten die Ausgabe von Staatsanleihen zur Unterstützung von Staatsunternehmungen zu einem ihrer Hauptgeschäftszweige. Als in der Folge der Julirevolution von 1830 in Frankreich das Wiener System herausgefordert wurde und Interventionskriege Metternichs drohten, wurde das vom gesamten Haus Rothschild als eine Gefahr für die Stabilität der Staatsanleihen der unterschiedlichen Länder erkannt. Mit der Weigerung, Kriegsanleihen auszugeben und unter geschicktem Einsatz ihres Informationsnetzes zu Lobbyzwecken gelang es ihnen, diese Gefahr zu bannen. Auf diese Weise intervenierte die Finanzkraft des Hauses Rothschild bei Kriegen und Revolutionen in ganz Europa und schrieb so mit an der Geschichte des Kontinents. Schließlich wandten sich die Zeitläufte aber gegen die Rothschilds. Mit dem Zusammenbruch des Wiener Systems, inmitten allgemein lauter werdender Forderungen nach Nationalstaaten, zeigten die Wunderkräfte der Rothschilds allmählich Anzeichen von Schwäche. Es kam zu Konflikten zwischen ihrem grenzübergreifenden Unternehmen und den auf die Wahrung ihrer Souveränität bedachten Nationalstaaten, was dazu führte, dass die Zweighäuser der Rothschilds in den einzelnen Ländern gezwungen waren, ihre Geschäfte stärker auf nationaler Ebene voranzutreiben. Sie hatten nur eine Wahl, nämlich in die Kolonien vorzurücken, was über die Ausgabe von Staatsanleihen für die Inbesitznahme von Kolonien geschah. Das Londoner Zweighaus beteiligte sich direkt und indirekt an den imperialistischen Bestrebungen Englands, das Pariser Zweighaus unterstützte Frankreich, das sich hitzig um den Erwerb von Kolonien bemühte. Doch der Gegenwind der Geschichte wurde stärker. Der allgemeine Ausbau der Nachrichtennetze erschwerte die Monopolisierung von Informationen, das Risiko der Ausgabe von Staatsanleihen im Kriegsfall wurde zum unüberschaubaren Risiko, die Etablierung von Steuersystemen - insbesondere in England erschwerte eine horrende Erbschaftssteuer die Erhaltung von Vermögen - tat ein übriges. Mit dem Aufstieg von Nazi-Deutschland schließlich waren Glanz und Ruhm für immer verloren. Von den einstmals fünf Standorten der Familie in Europa gingen das Zweighaus in Neapel, das Haupthaus in Frankfurt und das in Wien unter, übrigblieben nur die Zweighäuser in London und Paris. Bei aller Schwächung, welche das Haus Rothschild erfahren hat, existiert die Familie als solche natürlich noch immer. Ihre Geschäfte sind vielfältig, erstrecken sich über die Finanzwelt, Gold, Diamanten, die Freizeitindustrie und anderes. Sogar in der Weinproduktion ist die Familie tätig. Chateau Lafite, ein berühmter roter Bordeaux und Premier Cru gehört dem Pariser Zweighaus, der nicht minder berühmte Chateau Mouton ist das Markenzeichen der Londoner Rothschilds.«
Rei verstand nicht, wieso der Alte wortlos Gotodas Vortrag über Aufstieg und Fall einer Familie zuhörte, aber als er den Namen Lafite hörte, kapierte er es endlich. Und jetzt verstand er auch, dass die Sache mit dem Herausschmecken des Weins wohl ein Bluff von Gotoda gewesen war.
»In der Tat herrscht in dieser Familie kein Mangel an Anekdoten. Man sagt sogar, die Rothschilds hätten über die Frau von Lord Carnarvon, der Sponsor von Howard Carter war, die Entdeckung und Freilegung des Grabes von Tutanchamun unterstützt.«
»Sicherlich eine exzentrische Familie. Aber ich würde es begrüßen, wenn Sie langsam zur Sache kommen könnten«, übte der Alte sanften Druck aus.
»Es gab eine recht kuriose Tradition in dieser Familie. Der erste Rothschild hinterließ bei seinem Tod Instruktionen, die den Zusammenhalt des Hauses stärken sollten und nebenbei wohl auch den praktischen Nutzen hatten, zu verhindern, dass sich das Vermögen in alle vier Winde zerstreute. Jedenfalls gab es bei den Rothschilds relativ viele Ehen zwischen nahen Verwandten. Von den achtzehn Enkeln des Gründers haben doch tatsächlich sechzehn einen Cousin beziehungsweise eine Cousine geheiratet. Viele der Rothschilds hatten relativ wenige Kinder, und viele von ihnen waren Exzentriker. Das könnte das ungewollte Ergebnis der Heirat zwischen Verwandten sein, aber lassen wir das. Was ich interessant finde, ist, dass die meisten Mitglieder der Familie unter einer Art Sammelmanie leiden, was sie dank ihrer Finanzkraft zu Sammlern allererster Güte macht. Ein gewisser Walther aus dem Londoner Zweighaus war ein großer Gartenliebhaber, der ganz verrückt nach Orchideen, Rhododendron und Azaleen war. In seinem riesigen Landschaftsgarten Exbury Garden züchtete er in dreißig Gewächshäusern mit Hilfe von 200 Gärtnern und ohne Rücksicht auf die Kosten Pflanzen, welche Pflanzensucher für ihn in Amerika, China, Japan, Indien, Nepal und vielen anderen Orten der Welt sammelten. Durch Züchtung schuf er 1200 neue Arten. Sein Enkel Walther war ein großer Tierfreund und schuf ein Museum von Weltformat, in dem 2000 Säugetiere, 2400 Vögel und 600 Reptilien in ausgestopfter Form ausgestellt wurden. In den Regalen des angegliederten Labors finden sich noch einmal die Häute von 1400 Säugetieren und 300.000 Vögeln, Eier von 200.000 Vögeln sowie Exemplare von 2.250.000 Insekten und 300.000 Käfern. Daneben scheint es noch 295.000Vogelpräparate gegeben zu haben, die er später an ein amerikanisches Museum verkauft hat. Sein jüngerer Bruder Charles war ein Banker, aber ebenso wie sein älterer Bruder auch ein Naturkundler. Er gründete in England eine Gesellschaft zur Förderung des Naturschutzes und war eine Art Wegbereiter der Naturschutzbewegung. Seine älteste Tochter Miriam ist übrigens ebenfalls eine Naturkundlerin.«
»Und?«
»Ich denke, man kann sagen, dass die Sammelleidenschaft der Rothschilds bei weitem den Rahmen eines Hobbys oder einer Liebhaberei unter vermögenden Leuten übersteigt, oder etwa nicht?«
»Es ist verständlich, dass Sie das für seltsam halten, aber ist es nicht so, dass die Leidenschaft und das Kapital, welche die Königshäuser, Adelshäuser und die Bourgeoisie in Europa damals auf ihre Hobbys verwendeten, auch die Wissenschaften und Künste in hohem Maße gefördert hat? Auch wenn dies bisweilen, wie etwa bei dem verrückten König Friedrich, ungewöhnliche Blüten getrieben haben mag.
»Ich muss zugeben, dass die nun folgenden Überlegungen reine Spekulation sind«, leitete Gotoda seine weiteren Ausführungen ein. »Ich denke, dass die Pflanzensucher, welche die Rothschilds in alle Welt ausgeschickt hatten, mehr als nur seltene Pflanzen und Tiere mit nach Hause brachten. Und ich meine damit auch nicht unbedingt Informationen über Politik und Wirtschaft, also Dinge, die ihre Geschäfte betrafen.«
»Wieso drücken Sie sich nicht klarer aus?« Wieder übte der alte Mann Druck aus, und Gotoda fuhr mit leiser Stimme fort:
»Blumen, Gräser, Samen, Vogeleier, ausgestopfte Tiere und präparierte Insekten, Fossilien und Steinwerkzeuge und andere archäologisch wertvolle Ausgrabungsgegenstände ... Das alles müssen sie mit nach Hause gebracht haben. Und ich frage mich, ob sich darunter nicht auch Menschen befunden haben könnten.«
»Interessant«, murmelte der Alte und sah Gotoda dabei Unverwandt an. »Eine wirklich interessante Theorie... Aber haben Sie auch Beweise?«
»Wie gesagt, ich stelle mir das nur so vor«, antwortete Gotoda und grinste dabei abstoßend. »Allerdings wäre da etwas ... Ich weiß nicht, ob man das einen Beweis nennen könnte, aber es ist zumindest ein interessantes Indiz. Ich nehme an, du kennst einen gewissen Maurice?«
»Den Maurice?«
»Genau den. Der Maurice, den sie das schwarze Schaf der Familie nennen, weil er die Spaltung des Pariser Zweighauses herbeigeführt hat.« Gotoda streckte seine Hand in Richtung Rei aus und machte mit Zeige- und Mittelfinger eine Bewegung, die eine Schere andeutete. Rei gab ihm eine seiner letzten Zigaretten, aber Gotoda nahm sie nicht in den Mund, sondern begann, mit ihr zwischen seinen Fingern zu spielen.
»Er war der zweite Sohn des Wohltäters Baron Edmond de Rothschild, der die Kolonisten in Israel unterstützte und als ernsthafter und redlicher Menschenfreund galt. Sein Sohn war ein unverbesserlicher Lebemann, der von der ganzen Familie gemieden wurde. Nach dem ersten Weltkrieg und der Demobilisierung strebte er eine Karriere als Politiker an. Unter eigenmächtiger Verwendung des Familiennamens sammelte er eine große Menge Kapital an, das er in eine Immobilienfirma investierte. Als die Sache aufflog, wurde er von der Familie verstoßen. Seitdem lebte er ein Leben als Einzelgänger mit Mittelpunkt in Genf. Ironischerweise waren die Geschäfte, in die er investierte, äußerst erfolgreich und er erbte von einer Verwandten, die ohne Nachkommen gestorben war, ein riesiges Vermögen, was ihn zur reichsten Person der Familie machte. Während des zweiten Weltkriegs floh er vor den Nazis nach Amerika. Während dieser Zeit mehrte er sein Vermögen durch kühne Spekulationen noch weiter. Er starb 1957 und sein Vermögen wurde zwischen seinem einzigen Sohn und einer Reihe von Stiftungen aufgeteilt. Ich interessiere mich in erster Linie für den Inhalt seines Nachlasses.«
Gotoda hörte auf, mit der Zigarette zu spielen.
»Wie ihr Familienmotto Nicht reden! schon andeutet, sind die Rothschilds eine äußerst verschwiegene Familie. So war die Veröffentlichung von internen Dokumenten bis in das Jahr 1918 streng verboten. Wie dem auch sei, aus irgendeinem Grund ist eine Auflistung des Besitzes von Maurice Rothschild in die Hände eines Forschers gelangt. Es handelt sich um eine gewaltige Liste, an deren Ende folgendes geschrieben steht ... «
Gotoda nahm die Zigarette zwischen die Lippen, tauchte den frei gewordenen Zeigefinger in sein Glas und begann, mit dem Scotch etwas auf die Tischplatte zu schreiben. Rei beugte sich vor, um den Bewegungen von Gotodas Hand besser folgen zu können.
»S... A. .. Y. .. A«, las Rei.
Als Rei bemerkte, was das zu bedeuten hatte, hob er den Kopf und sah Gotoda an. Der entzündete seine Zigarette und nahm einen tiefen Zug. Mit einem maskenhaften Gesichtsausdruck, aus dem alle Gefühle verbannt waren, blickte der alte Mann Gotoda an.
»Wer... sind Sie?« Seine Stimme klang beinahe gequält. »Der besagte Forscher scheint einige Mühe darauf verwendet zu haben, herauszufinden, was SAYA zu bedeuten hat. Und dann ist er plötzlich gestorben.Wie man hört, bei einem Autounfall.«
»Wer sind Sie?« wiederholte der alte Mann.
»Wie schon gesagt, ich bin eine Art Beamter. Allerdings kein Gemeindebeamter. Ich bin ein Beamter des kleinsten Staates der Welt.«
Die Miene des Alten, der seine Stirn verwundert in Falten gelegt hatte, veränderte sich ganz langsam und verzog sich schließlich zu einem Ausdruck von Fassungslosigkeit. Für den Alten, der sich bisher wie die Intelligenz in Person gebärdet hatte, war das eine überraschende Wandlung. »Unmöglich! Wieso sollte der Vatikan sich in diesen Fall einmischen?!«
Als der Alte das Wort »Vatikan« aussprach, überkam Rei ein heftiges Unwohlsein. Die Geschichte dieser Familie, die hinter den Kulissen die Geschicke des modernen Europa mitbestimmt hatte, schien sich mühelos mit dem Eindruck zu überlagern, den der alte Mann vor ihm machte. Und dann war da noch dieser kuriose Raum, der ganz wunderbar zu einer Familie passte, die eine ganze Reihe von Sammlern und Naturkundlern hervorgebracht hatte. Aber dann ... Gotoda! Wie um alles in der Welt sollte ausgerechnet dieser Mann um die Vierzig, der sich in einer schäbigen Yakiniku-Kneipe mit Kimchi, Bier und Billigzigaretten begnügt hatte und ihn um eine Zigarette nach der anderen anschnorrte, etwas mit dem Vatikan zu tun haben? Der Kerl sah ja nach allem möglichen aus, mit etwas gutem Willen sogar nach einem Priester der japanischen Niederlassung irgendeiner Voodoo-Kirche, aber nach einem frommen Katholiken?
Gotoda rauchte, ohne den Worten des Alten auch nur zu widersprechen, weiter seine Zigarette und zeigte die gleiche herablassende Haltung wie sonst.
»Ich glaube, ich muss deinem Gedächtnis etwas nachhelfen.
Seit Papst Gregor IX. im Jahr 1231 die Inquisition etabliert hat, besaß Rom so etwas wie das Monopol auf diese Angelegenheit. Gregor IX. äußerte sich seinerzeit wie folgt: Diese Monstren müssen, ohne Ansicht ihres Alters oder ihres Geschlechts, von der Erde getilgt werden. Denn es ist gewiss, dass sie einen Pakt mit Luzifer eingegangen sind und die Erde beschmutzen. Deshalb muss es die Pflicht aller Christen sein, diese Ketzer zu verfolgen.«
»Ich denke, Sie sind derjenige, dessen Gedächtnis Nachhilfe braucht. Seit Rom dieses Privileg etabliert hat, hat es jedwede Gelegenheit ergriffen, das Dogma der religiösen Intoleranz zu predigen. Freiheit und religiöse Wahrheit vertragen sich nun mal nicht. Wahrheit sollte nach Möglichkeit vom Staat vertreten werden, basierend auf den Weisungen der Kirche. Die Intoleranz selbst war für sie die größte aller Tugenden.« Der Alte hatte sich offenbar von seiner kurzfristigen Fassungslosigkeit erholt, und sein Blick war wieder vom Ausdruck unbeugsamer Willenskraft erfüllt. »Auf der Basis dieses Geistes der Intoleranz hat die Kirche die Menschen, Katholiken ebenso wie Nichtkatholiken, ihrer grundlegenden Rechte beraubt. Man trat diese Rechte mit Füßen und ging einen Weg drastischer Gewalt. Als Werkzeug dafür benötigte Rom eine kleine aber unbarmherzige Gruppe von Männern, die im Namen des Papstes den in der Geschichte der Menschheit bis dato grausamsten Angriff auf die Würde des Menschen ausführen würde, eine Vorhut des Terrors im Auftrag der Kirche. Die Inquisition!«
Der alte Mann spuckte dieses Wort mehr, als dass er es aussprach, um Gotoda darauf unverwandt anzublicken.
»Einen Grundsatz, den die Inquisitoren sich selbst auferlegt hatten, war es, lieber Hunderte Unschuldige zu töten, als auch nur einen einzigen Ketzer entkommen zu lassen. Dieses Prinzip war äußerst einfach, und die Inquisitoren herrschten zudem mit der absoluten Autorität der Unfehlbarkeit, was das Begehen von Irrtümern oder Freveltaten betraf. Es fällt daher nicht schwer, sich vorzustellen, mit welcher Heftigkeit diese Gerechtigkeitsjünger wüteten, nachdem Papst Innozenz IV. ihnen in einer päpstlichen Bulle den Gebrauch der Folter erlaubt hatte. Sie führten ihren heiligen Auftrag mit großer Leidenschaft aus. Ihre Waffen waren Verleumdung und Falschaussage, die aus allerlei abscheulichen menschlichen Gefühlen wie Eifersucht, Missgunst und Hass herrührten. Entweihung, Gotteslästerung, Magie, Sodomie, Nichtbezahlen von Kirchensteuer, Lesen der Bibel, Flucht aus der Gemeinde, all das wurde zu ketzerischen Taten erklärt, die den Tod verdienten. So kam es, dass die Lakaien des Teufels plötzlich überall waren. Niemand hatte jemals ihre Gestalt gesehen, was aber nur bedeuten konnte, dass sie eine unberechenbare Bedrohung waren. Und sie bedrohten nicht nur die Lebenden. Die Kirche vertrat die Ansicht, dass sie selbst Tote vom wahren Glauben abbringen konnten, weshalb die Inquisitoren auch Gräber aufbrachen, die Leichname der Inquisition unterzogen und sie anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannten. Wenn keine Knochen mehr zu finden waren, brachte man als Ersatz Puppen vor die Inquisition! Und dies alles ist nicht bloß eine Geschichte aus dem finsteren, unaufgeklärten Mittelalter. Die Römische Inquisition führte ihre barbarischen Aktivitäten selbst im 19.Jahrhundert noch in aller Seelenruhe fort. In Spanien wurde die Inquisition erst 1813 verboten, wobei in der Praxis noch weitere zwanzig Jahre lang gefoltert wurde. Obwohl er zumindest das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen als illegal erklärte, verkündete Papst Pius IX. im Jahr 1856 in einer päpstlichen Bulle die Anerkennung von Exkommunikation, Ausschluss, lebenslanger Kerkerhaft und heimlicher Hinrichtung. Kein einziges Mal kam es vor, dass die Inquisitoren eine Niederlage erlitten, obwohl es ihnen letztlich nicht gelang, einen entscheidenden Sieg über ihren Gegner davonzutragen. Der Grund dafür war, dass die Mittel, die sie sich ausgedacht hatten, ihren Gegner zu vernichten, also Folter und Furcht, diesen im Gegenteil nur mehrten und stärkten.«
Noch einmal, wie zuvor schon im Zusammenhang mit dem Tierreich, führte der alte Mann in seiner Rede den Beweis der Grausamkeit und Intoleranz des Menschen und klagte ihn zugleich an.
»Die Aktivitäten der Inquisitoren erstreckten sich selbstverständlich nicht nur auf den Menschen selbst, sondern auch auf die Welt des Wortes. Eine 1571 in Rom eingerichtete sogenannte Indexkongregation gab über Jahrhunderte ein in regelmäßigen Abständen aktualisiertes Verzeichnis verbotener Bücher heraus, das erschreckender weise erst 400 Jahre später, während des Pontifikats von Paulus VI. im Jahr 1966 abgeschafft wurde. Das ist also gerade erst drei Jahre her. Rom war schon immer begabter darin, Dispute im Keim zu ersticken, als auf sie zu antworten.«
Das Plädoyer des alten Mannes ging ohne Pause weiter.
Mehr noch, es schien, dass er bei der Darstellung seiner Sicht der Dinge immer mehr Leidenschaft entwickelte. Mit Schaudern stellte Rei sich vor, wie viel Zorn und Verzweiflung über die Menschheit sich hinter dem wissenden Blick und dem friedfertigen Gesichtsausdruck des Alten verbergen mussten.
»Rom war über mehr als sechs Jahrhunderte hinweg der Erzfeind fundamentaler Gerechtigkeit für die Menschheit, aber die schlimmste Sünde, welche die Kirche in unserem Jahrhundert begangen hat, war ... die Judenverfolgung.«
Im Blick des Alten lag jetzt zum ersten Mal so etwas wie Hass.
»Eine Bulle von Papst Paul IV. aus dem Jahr 1555 war eine epochemachende antisemitische Schrift. In der Folge heizten praktisch alle Päpste die seit alters her bestehenden Vorurteile gegen die Juden immer weiter an. Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Gregor XVI., Pius IX ... Was den Antisemitismus betraf, waren sie alle Musterschüler von Paul IV.. Im Gebiet des Vatikans wurden die Juden erstmals in besondere Wohngebiete gezwungen. Es ist offensichtlich dass die Nazis in einer gewissen Tradition und Kontinuität vieler Papst-Generationen standen, als sie mit einer ähnlichen Maßnahme die Juden in die Ghetto genannten Viertel verbannten. Die Ähnlichkeiten zwischen den Enzykliken von Innozenz III. und Paul IV. einerseits und den Nürnberger Rassegesetzen der Nazis andererseits ist schwerlich zu übersehen. Unterster Pöbel, Verpester der Erde, Gottesmörder ... Man stempelte die Juden zu einer Rasse von Kriminellen ab, um ihre Häuser und ihre Grundstücke zu enteignen, ihre Friedhöfe zu schänden, die Menschen zu deportieren und sie massenhaft zu ermorden. Die stillschweigende Anerkennung der Rassenverfolgung im Faschismus durch die Kirche begann im Jahr 1932 während des Pontifikats von Papst Pius XII. Auch als im Jahr 1942 der Erzbischof von Canterbury als Vertreter der Anglikanischen Kirche und nichtstaatlicher Kirchengruppen den Massenmord der Nazis an den Juden bekanntmachte, hüllte sich der Nachfolger des Heiligen Petrus in Rom weiter in Schweigen.«
»Es gab nur einen Menschen auf der Welt, dessen Wort Hitler fürchtete. Und zwar deshalb, weil in seinen Armeen zahllose Katholiken kämpften. Aber dieser eine Mensch hat letztlich niemals seine Stimme erhoben. Einer der Anführer des verzweifelten Aufstandes der polnischen Juden im Warschauer Ghetto 1943 beklagte mit folgenden Worten das Schweigen der politischen Führer in aller Welt: Die Welt schweigt. Die Welt weiß es. Es ist unmöglich, dass die Welt es nicht weiß. Und trotzdem schweigt sie ... Der Vertreter Gottes im Vatikan schwieg.«
Als der alte Mann das sagte, klang es beinahe wie ein Vorwurf an Gotoda, der die ganze Zeit geschwiegen hatte.
»Wieso schweigen Sie? muss es nicht so sein, dass ein Inquisitor unter keinen Umständen Widerspruch bei seinem Opfer duldet?«
»Die Inquisitoren, von denen du erzählst, existieren nicht mehr. Aus dem ältesten römischen Glaubensgericht wurde 1908 das Heilige Offizium, aus seinen Kerkern Archive. Und vor zwei Jahren änderte sich der Name schließlich in Kongregation der Glaubenslehre.«
»Es ist genau wie bei der sowjetischen Geheimpolizei.
Egal, wie oft sie ihren Namen ändert, es ändert nichts an dem, was sie tut. Ihre Grausamkeiten mögen vielleicht im Verborgenen geschehen, aber ihre Geschäfte werden fortgeführt. Und es hat sich auch nichts daran geändert, dass ihr Leiter, der oberste Inquisitor, seit alters her der amtierende Papst selbst ist.«
»Sicherlich haben zahlreiche Päpste erschreckende Fehler begangen, aber der Vatikan hat diese niemals anerkannt. Das ist eine Tatsache. Aber die Familie, der du dienst, hat sich auch ihre Hände schmutzig gemacht. Ich rede von dem Mädchen, von dieser Saya.«
Der alte Mann kniff die Augen ein wenig zusammen und blickte Gotoda lauernd an.
»Du hast zwar lange und breit über den Ursprung dieses Monsters und über die moralische Krise, in die es uns stürzt, erzählt, aber über das Wesentliche hast du kein einziges Wort verloren.« Gotoda warf den bis auf den Filter heruntergebrannten Zigarettenstummel in den Aschenbecher. »Von alters her gibt es eine Vielzahl von Methoden, um Vampire aufzuspüren. Man streut Asche um Gräber und folgt den Fußspuren, man öffnet Gräber, auf denen verbogene Kreuze stehen ... Im Glauben, dass Tiere die Vampire wittern könnten, ließ man Pferde über Gräber gehen. Aber ich habe da meine eigene Meinung. Wenn man den Aufenthaltsort eines Vampirs aufspüren will, ist es das Beste, einen anderen Vampir zu fragen.«
»Nicht doch...« Genau diesen Verdacht hatte Rei insgeheim gehabt. Sayas animalische Augen. Böse, so hatte Abe diese Augen bezeichnet. Und diese Augen erschienen Rei wie geschaffen für die Jagd auf Menschen. dass Rei diesen Verdacht nicht hatte aussprechen können, kam vielleicht daher, dass er sich die Möglichkeit nicht eingestehen wollte, dass Saya sich mittels einer Metamorphose in ein abstoßendes Monster verwandeln könnte.
»Wenn mich meine Vorstellungskraft nicht trügt, gehört doch auch diese Saya dazu. Ich meine, zur Verwandtschaft der Vampire.«
»Zur Verwandtschaft?«
»Platt formuliert ist sie ein Zwischending aus Vampir und Mensch. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehört sie jener Subspezies an, die künstlich gezeugt wurde. Nicht dass das eine besonders extravagante Idee wäre. Wer Pflanzen und Tiere sammelt, ist meistens auch ein Züchter, der nach neuen Arten strebt. Wie schon erwähnt, haben die Gartenbauer der Familie eine Unzahl von Arten geschaffen. Und die Zweighäuser in Paris und London haben als namhafte Pferdebesitzer zahllose Vollblüter in die Welt hinausgeschickt.«
»Es war seinerzeit das einzige Mittel, um zu beweisen, dass sie Menschen sind und der gleichen Spezies wie wir angehören.«
Zum ersten Mal seit das Gespräch auf Saya gekommen war, hatte der alte Mann etwas gesagt.
»Man hat sie gekreuzt.«
Als Rei das Wort »gekreuzt« aus Gotodas Mund hörte, überkam ihn ein Gefühl von Abscheu und er verzog sein Gesicht.
»Nun, es war einer der wenigen erfolgreichen Fälle. Ich denke, ich habe erwähnt, dass die Blutsauger nur eine schwache Fortpflanzungsfähigkeit besitzen und ihre Geburtenrate gering ist. Die meisten Fälle endeten mit einer Früh- oder einer Totgeburt. Insofern ist es beinahe ein Wunder, dass Saya zu einem Wesen herangewachsen ist, das den Körper eines Menschen, aber das Bedrohungspotential und die Langlebigkeit der Blutsauger besitzt. Die Personen, die seinerzeit an dem Plan beteiligt waren, sollen Saya ein verwunschenes Juwel genannt haben.«
Rei schien es fast, als ob in den Worten des Alten eine Art von Reue mitklang, aber vielleicht entsprang dieser Eindruck auch nur seinem Wunschdenken. Wenn Rei sich von irgend etwas in Sayas Blick angezogen fühlte, dann konnte das nur eine Wut sein, die tief hinter ihrer Bösartigkeit verborgen lag - eine unbändige Wut, die von ihrem Hass auf das eigene Blut herrührte.
»Ein verwunschenes Juwel. .. Ich verstehe nicht, wieso sie euch nicht schon längst umgebracht hat.«
»Gewiss, sie hasst uns. Zumindest seit sie weiß, was sie eigentlich ist. Sie arbeitet nur deshalb mit uns zusammen, weil sie auf unsere Macht angewiesen ist, um die anderen vernichten zu können. Und ich bin mir sicher, dass sie niemals verzeihen wird. Weder jenen, mit denen sie verwandt ist, noch den Menschen, die ihr dieses Schicksal aufgezwungen haben.«
Gotoda antworte darauf in einem leisen, aber sehr bestimmten Tonfall:
»Auch der Vatikan wird niemals vergeben. Insbesondere euch nicht, die ihr sie zum Leben erweckt habt. Denn der Teufel zielt darauf, den Menschen zu verderben, indem er die Pforten seines Geschlechts beschmutzt. Die Erbsünde des Menschen kann nur durch Sex auf die folgende Generation übertragen werden. Und diese Sünde wird niemals vergeben werden.«
Der alte Mann und Gotoda starrten sich wortlos an. Dahinter lauerte die Geschichte eines langen und blutigen Kampfes, den jemand wie Rei nicht begreifen konnte. Es war ein auswegloser Kampf, in dem zwei Parteien, die beide unverzeihliche Sünden begangen hatten und von denen keine der anderen verzeihen konnte, sich gegenseitig anklagten. Rei erschien es, als ob die Konfrontation der beiden ewig dauern würde. Als erster ergriff der Alte das Wort.
»Wie mir scheint, ist unser Gespräch gescheitert.«
Als Rei diese Worte hörte, die für ihn einem Todesurteil gleichkamen, überlief ein Frösteln seinen ganzen Körper. Widerwillig zwar, aber nach besten Kräften hatte er sich bemüht, diesem Gespräch zu folgen. Jetzt sollte er wegen einer Feindschaft sterben, deren Ursprünge irgendwo in ferner Vergangenheit, lange vor seiner Geburt lagen. Als Rei verzweifelt versuchte, sich die Gründe für seine Situation auszumalen, sagte der Alte plötzlich etwas völlig Unerwartetes:
»Wir haben zu viel geredet. Bitte gehen Sie jetzt. Meine beiden Leute werden sie zurückfahren.«
Wortlos erhob sich Gotoda von seinem Platz. Rei, den die unerwartete Entwicklung der Situation irritierte, folgte seinem Beispiel. Als der in kaltem Schweiß gebadete Rei sich schon auf dem Weg zur Tür befand, rief ihm der alte Mann noch etwas nach:
»Rei Miwa? So heißt du doch, oder? Ich soll dir etwas von Saya ausrichten. Wenn sie dich das nächste Mal trifft, wird sie dich töten.«
Diese Worte trafen Rei wie ein Schwerthieb und für einen Augenblick kam er ins Straucheln, aber irgendwie schaffte er es, hinter Gotoda den Ausgang zu erreichen. Als er sich umwandte, sah er, dass der Alte noch genauso wie zuvor mit leicht nach vorne geneigtem Kopf starr und unbeweglich auf seinem Stuhl saß. In diesem Moment erschien seine Gestalt Rei wie ein von lauter Tieren umringtes menschliches Präparat.
GEWALT
Bewaffneter Kampf
ERSTER TEIL
Bewaffneter Kampf
ERSTER TEIL
Rei ging wieder zur Schule. Amano und Doigaku, die man unter dem Vorwand des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und Behinderung einer Amtshandlung festgenommen hatte, waren wie erwartet freigekommen, ohne dass Anklage erhoben worden war. Aber da man auch sie, genau wie Rei, für drei Wochen vom Unterricht suspendiert hatte, saßen sie jetzt zu Hause unter Arrest. Murasakino und Nabeta starteten eine Solidaritätsaktion für die Aufhebung ihrer Suspendierung, aber da der Grund der Festnahme - fahren zu zweit auf einem Zweirad ohne Beifahrersitz - kein politischer (und zudem eine unbestreitbare Tatsache) war,stand die Aktion von Anfang an unter keinem guten Stern und endete sang und klanglos. Aoki war tatsächlich von einer Ambulanz ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden, nachdem irgend jemand einen Notruf getätigt hatte. Mit mehreren gebrochenen Rippen und einem zertrümmertem Schlüsselbein war er relativ schwer verletzt. Es hieß, dass die vollständige Heilung gut zwei Monate in Anspruch nehmen würde, aber seine Genesung verlief so gut, dass er noch im Krankenzimmer von der Polizei befragt werden konnte. Murasakino, der ihn besucht hatte, berichtete, dass er völlig verändert wirkte, als ob eine Art von Besessenheit von ihm abgefallen sei. Abgesehen davon, dass er sich an die Ereignisse der letzten acht Wochen nur vage erinnern konnte, machte sein Heilungsprozess gute Fortschritte.
Der wilde Kampf in dem besetzten Haus auf dem Gelände der M-Universität hatte mehr als zwanzig Schwer- und Leichtverletzte gefordert und wurde von den Medien als »gewalttätige Auseinandersetzung innerhalb einer radikalen politischen Gruppierung« dargestellt. Da keine Täter zu ermitteln waren und die SR-Fraktion effektiv aufgehört hatte, zu existieren, war die Angelegenheit damit abgeschlossen.
Vor seiner Rückkehr in die Schule machte Rei ein Gedanke am meisten Angst, nämlich der, dass er dort auf Saya treffen könnte. Aber wie er selbst schon geahnt hatte, war Saya seit jenem Tag spurlos verschwunden. Unter Reis Mitschülern hieß es, der Klassenlehrer habe einfach nur mitgeteilt, dass sie die Schule gewechselt habe, ohne ein Wort über ihre Gründe oder das Ziel ihres Wechsels zu verlieren.
Rei hatte Gotoda nicht mehr gesehen, seit sie an jenem Abend von den beiden Helfern des Alten in einen Wagen gesetzt und frühmorgens in Shinjuku abgesetzt worden waren. Da Gotoda sich nicht mehr meldete, entschied Murasakino den Pakt mit ihm aufzulösen. Des weiteren kam er zu dem Urteil, dass mit dem Verschwinden von Saya und der Zerschlagung der SR Fraktion Aokis persönliche Gefährdung vorüber sei und verkündete die Einstellung der Ermittlungsaktivitäten. Tatsächlich gab es jetzt nicht einmal mehr einen konkreten Gegenstand für Ermittlungen. Für weitere Aktivitäten fehlte ihnen der nötige Spielraum, ebenso wie ein vernünftiger Grund.
Nach der Demonstration neulich hatte die Einheitsfront aus Parteien und Bürgergruppen den Erfolg ihrer Strategie verkündet und mit Aktivitäten in Hinblick auf die nächste Großdemo der Einheitsfront begonnen, aber Reis Gruppe, in der von sechs Mitgliedern eines schwer verletzt und drei vorübergehend verhaftet worden waren, war vollkommen erschöpft. Selbst wenn man von Reis ungerechtfertigter Verhaftung absah, hatten ihre Ermittlungen letztlich weder Aufschluss über die genaue Identität des Gegners noch über seine Ziele bringen können. Statt dessen blieb unter dem Strich nur die Verhaftung von Amano und Doigaku und der Krankenhausaufenthalt Aokis. Und dieses unrühmliche Resultat der Affäre fügte der Gruppe um Murasakino unermesslichen Schaden zu.
Rei, der im Gegensatz zum Rest die Wahrheit kannte, hatte von Anfang an der Mut gefehlt, diese auch zu beichten. Jetzt, da er ein noch größeres Geheimnis mit sich herumtrug, steckte er in einer aussichtslosen Klemme, was ihm schwer zu schaffen machte. Trotzdem hielt Rei sein Schweigen durch. Die Tatsache, dass dieser Gotoda, der nicht einmal wie ein Kripobeamter aussah, ausgerechnet ein Agent des Vatikans, ein Inquisitor, sein sollte, war für sich allein schon schwer genug zu glauben. Wer würde ihm da allen Ernstes abnehmen, dass hinter den Männern, die Saya lenkten, eine einflussreiche und historisch bedeutsame jüdische Großfamilie aus Europa stand, und dass darüber hinaus beide Parteien sich auf der Jagd nach nichts anderem als den Nachfahren blutsaugender Menschenaffen, nämlich Vampiren, befanden, von denen einer sich vor Reis Augen verwandelt hatte und davongeflogen war?
Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Rei deprimiert war. Nachdem Gotoda den Kontakt zu ihnen abgebrochen hatte, wurde er von Murasakino als »Verräter«, als »Machiavellist«, der sie nur benutzt habe und als »Werkzeug der Mächtigen« kritisiert, geschmäht und mit Racheschwüren belegt. Sicher hatte Murasakino zum Teil recht, mit dem was er über Gotoda sagte. Der hatte zweifellos wissen müssen, dass Aoki ein »Gefolgsmann« von Kariya war, und folglich auch, dass Sayas Ziel nicht Aoki selbst, sondern der hinter ihm verborgene Kariya war. Trotzdem hatte Gotoda Rei und seine Freunde mobilisiert und zwischen die Fronten geschickt, um damit beide Parteien herauszufordern und die Entwicklung der Situation zu beobachten. Und so wie von Gotoda erwartet, hatte Kariya auf das Erscheinen einer dritten Kraft nervös reagiert und versucht, Rei mit Hilfe von Aoki eine Falle zu stellen. Der beste Beweis dafür war, dass er Rei überwacht hatte und ihm dann heimlich in das besetzte Haus auf dem Gelände der M-Universität gefolgt war.
Aber Gotoda war nicht der einzige, der sie benutzt hatte.
Kurz nachdem Rei Kariya in die Falle gegangen war, hatte Saya ihren Angriff auf das besetzte Haus gestartet. Das konnte kaum Zufall gewesen sein. Saya und ihre Leute hatten wie in einem Spionagefilm ihre Beschatter Doigaku und Amano verhaften lassen, um Rei in eine Krise zu stürzen. Dann hatten sie gewartet, bis Rei in Kariyas Falle ging und waren ihm gefolgt. Vermutlich wussten sie schon längst, dass der Stützpunkt der SR-Fraktion ein einziges Vampir Nest war, sahen in dieser Methode aber die einzige Möglichkeit, Kariya dort festzunageln.
Jedenfalls hatten sowohl Gotoda als auch Sayas Leute sie gründlich ausgenutzt. Rei und die anderen waren hilflos herumgeirrt, hatten Seelenqualen ausgestanden und ihre Rolle gespielt, genau wie man das von ihnen erwartet hatte. Leute wie Sayas Hintermänner oder Gotoda lachten doch allenfalls darüber, wenn ein paar jugendliche Politaktivisten Ermittlungen anstellten und dabei den Verlust ihres Selbstbestimmungsrechts und die Zerstörung ihrer Familien riskierten. Für die waren sie doch bloß Objekte,die man benutzte, um einen Auftrag zu erledigen. Reis Position an jenem Abend, als er zwischen Gotoda und dem Alten hing und von den beiden wie Luft behandelt wurde, war der deutliche Beweis dafür.
Sie mochten sich selbst für noch so tolle Kerle halten, am Ende waren sie ziemlich dumme Oberschüler, die ein noch dümmeres Ding drehten und plötzlich feststellten, dass alle, die etwas Grips hatten, sich schon längst aus dem Staub gemacht hatten, während es unter ihnen Verletzte und Verhaftete gegeben hatte. Dieses Gefühl war es, was Rei mehr als alles andere entmutigte und hoffnungslos deprimierte. Die Gruppe der parteilosen Aktivisten an der Städtischen K-Oberschule hatte Schiffbruch erlitten. Als dieses Gerücht an der Schule die Runde machte, waren die Lehrer die einzigen, die sich darüber freuten. Sollte das etwa schon alles gewesen sein? Nein, das konnte nicht alles gewesen sein. Das dachte Rei, als er mit einer Mischung aus heimlichem Groll und Angst vor drohender Gefahr in die Schule zurückkehrte.
Nein, es war noch nicht alles gewesen. Das wusste Rei, als er an jenem Tag von der Schule nach Hause kam und den Notizzettel sah, den seine Mutter an die Tür seines Zimmers geklebt hatte. Die Notiz lautete wie folgt:
K-Buchhandlung
»Unter dem achteckigen Turm« von Eiichi Kariya, 2200 Yen Letzte Lieferung, Auflage läuft aus
Falls kein Interesse, geht Buch an anderen Vorbesteller
ZWEITER TEIL
Falls kein Interesse, geht Buch an anderen Vorbesteller
ZWEITER TEIL
Der achteckige Turm war ein Symbol aus der Zeit der alten Präfekturschule. In Wirklichkeit war es nicht einmal ein echter Turm, sondern nur die kuppelförmige Decke welche die dreigeschossige Vorhalle des alten Schulgebäudes bedeckte, aber die Art, wie diese Konstruktion aus dem Flachdach der Schule herausragte, erinnerte aus der Ferne tatsächlich ein klein wenig an einen klassischen Spitzturm. Aufgrund des undefinierbaren Geschmacks seines Architekten war der Bau als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt worden, zeigte aber bereits schwere Alterserscheinungen, und ein Anlehnen war wegen möglicher Einsturzgefahr strengstens verboten. dass Rei und die anderen trotzdem mit Vorliebe dagegen traten oder daran hochkletterten, war auch eine Demonstration ihrer Macht.
Jetzt kauerte Rei an der Seite dieses achteckigen Turms und ließ seinen Blick über das in Dunkelheit getauchte Flachdach schweifen, welches sich, ausgehend vom Turm in der Mitte, nach rechts und links über die beiden im rechten Winkel angeordneten Flügel des Gebäudes erstreckte. Aber außer dem Dachhäuschen, das den Ausgang des Treppenhauses beherbergte und sich auf dem von Rei aus betrachtet rechten Flügel befand, war nichts zu sehen. Der Mond war von einer dünnen Wolkendecke verhangen und leuchtete fahl.
Rei war ohne eine Waffe hergekommen. Er hat daran gedacht, ein Stahlrohr oder eine Holzlatte mitzunehmen, aber damit könnte er gegen diese Monster ohnehin nichts ausrichten. Wenn Saya, die zweifellos noch auftauchen würde, mit ihrem Schwert auf ihn losginge, wäre sowieso jeder Widerstand zwecklos. Kurzum, Rei war nicht mehr als ein Köder, und das war ihm durchaus Klar. Wenn Kariya Rei an diesen Ort lockte, würde er so auch Saya anlocken, die sich dann, dessen durchaus bewusst, einem Duell stellen würde. Wenn man annahm, dass keiner von beiden über den Aufenthalt des anderen Bescheid wusste, hatten sie keine andere Wahl, als Rei zu benutzen, wenn sie ein Treffen herbeiführen wollten. Und Rei hatte keine andere Wahl als zu warten.
Natürlich hätte er sich davor drücken können, aber die Formulierung »falls kein Interesse, geht Buch an anderen Vorbesteller« ließ ihn zögern. Für Rei, der die Wahrheit schon kannte, würde es schlimm genug werden. Murasakino oder Nabeta, die von der ganzen Wahrheit nichts ahnten, dieser Gefahr auszusetzen, erschien ihm völlig unverantwortlich. Außerdem dachte Rei, dass er sowieso keine Möglichkeit hätte, sich dieser Affäre auf Dauer zu entziehen. Also musste die Sache heute Nacht endlich zu einem Ende gebracht werden.
Beide Seiten hatten sich bisher einen Kampf im Dunkeln geliefert. Wenn sie mit dem Aufeinandertreffen heute eine endgültige Entscheidung in diesem Kampf suchten, dann war Reis Erscheinen die einzige Möglichkeit, die ganze Affäre ein für allemal hinter sich zu lassen. Rei hätte lügen müssen, wenn er behaupten wollte, dass er keine Angst hatte. Aber nachdem die anderen ihn so nach Lust und Laune ausgenutzt und an der Nase herumgeführt hatten, war sein Erscheinen hier der einzige Weg für diesen dummen Jungen von Oberschüler, noch einmal Flagge zu zeigen.
Und da war noch etwas ... Heute Nacht war seine letzte Chance, Saya noch einmal zu treffen. Als Rei dieser Gedanke kam, geriet er über seine ihm selbst unerklärlichen Gefühle in Verlegenheit. Sayas Kunstfertigkeit im Umgang mit dem Schwert war einfach göttlich. Das hatte er in dem besetzten Haus mit eigenen Augen gesehen. Und wer weiß, vielleicht war das Wort teuflisch für ihre Künste sogar noch passender. Aber trotz allem hatte Kariya es geschafft, Sayas Klinge um Haaresbreite zu entkommen. Und selbst wenn sie es schaffen würde, ihn zu besiegen, war es äußerst fraglich, ob sie Rei am Leben lassen würde. Wieso wollte er Saya unbedingt noch einmal sehen? Konnte es sein, dass er gerade dabei war, eine riesengroße Dummheit zu begehen? Gerade als Rei sich diese Frage stellte, erschien ein Schatten auf dem Dach und rief Rei an:
»Hi, wie geht's?« Die Stimme gehörte einem Mann, dessen Kommen Rei zwar entfernt in Betracht gezogen hatte, von dessen Anwesenheit er sich allerdings nicht allzu viel Hilfe erhoffte. Schön, dass du hier bist. Soviel Haltung verdient Respekt«, sagte Gotoda in einem lockeren Tonfall, als er mit zusammengerolltem Mantel unter dem Arm aufRei zukam.
»Spare dir die Sprüche! Dann hast du mich also die ganze Zeit beschattet!«
»Hab mir Sorgen gemacht, dass du dich wieder in deinem Zimmer einschließt und tot stellst.«
»Was ist das?«
Mit einer fragenden Kopfbewegung deutete Rei auf den zusammengerollten Mantel unter Gotodas Arm. Der öffnete das Paket und streckte die zum Vorschein gekommenen Waffen Rei entgegen. Es war eine Schrotflinte, aber keine Jagdwaffe, sondern eine sogenannte Pumpgun, wie sie des Öfteren in amerikanischen Kinofilmen zu sehen war.
»Was um alles in der Welt...« Rei war so perplex, dass ihm die Luft wegblieb und er nur noch auf dieses äußerst tödlich wirkende Ding starren konnte. Wenn Gotoda an so einem gefährlichen Ort auftauchte, war damit zu rechnen, dass er eine Pistole bei sich trug, aber niemals hätte Rei sich träumen lassen, dass er mit so mörderischen Werkzeug hier aufkreuzen würde.
»Ich dachte, es gehört zu deinen Grundsätzen, nach Möglichkeit auf das Tragen von Waffen zu verzichten?«
»So ist es, nach Möglichkeit ... Und ich bin nicht so lebensmüde, hier unbewaffnet aufzutauchen. Eine Remington mit Double-0-Back-Munition ist zwar keine Lebensversicherung aber ich konnte ja schlecht eine Flak mitbringen.«
Gotoda legte seine Hand um den Schaft, schob ihn leicht nach oben und dann wieder zurück. Ein metallisch schnappendes Geräusch verkündete, dass das Gewehr jetzt geladen war. Daraufhin demonstrierte Gotoda den Nachladevorgang, indem er eine Patrone aus seiner Tasche holte und sie in das rohrförmige Magazin legte. Seine Bewegungen wirkten erprobt.
»Darf ich was fragen?« »Nur zu.«
»Bist du wirklich Christ?«
Gotoda zeigte ein säuerliches Lächeln und antwortete: »Lassen wir mal die Frage beiseite, ob ich gläubiger Christ bin.
Hast du schon mal die Schweizergarde des Vatikans gesehen?« »Na ja, auf Fotos. Das sind doch die Kerle mit den Zirkusklamotten.«
»Die sehen vielleicht nach Zirkus aus, aber unter dieser Verkleidung stecken professionelle Soldaten. Unter diesen affektierten Klamotten tragen sie echte Handfeuerwaffen. Hör mal zu, Papst Paul VI. hat seinerzeit alle militärischen Rangabzeichen und das offene Tragen von Waffen verboten, aber der Vatikan hat niemals die Bewaffnung an sich abgeschafft. Und ich rede nicht von so was Niedlichem wie einfachen Gewehren. Auch heute noch lagern irgendwo in einem Magazin des Petersdoms für den Fall der Fälle einsatzbereite Maschinenpistolen.« Mit seiner freien rechten Hand griff Gotoda unter das Jackett seines schäbigen Anzugs, holte eine automatische Pistole hervor und drückte sie Rei in die Hand. »Nur damit wir uns verstehen. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Hast du schon mal geschossen?«
»Natürlich nicht.« Rei konnte die große und schwere Automatik nur zögerlich umgreifen. Ein klein wenig wusste er über Handfeuerwaffen Bescheid und erkannte daher, dass es sich um eine M1911A1, die Militärversion einer Colt Gouvernement, handelte. »Und das soll etwas gegen diese Monster ausrichten?«
»Hol mal das Magazin raus.«
Rei tat wie ihm gesagt wurde und holte das Magazin aus dem Griff der Waffe. Es war mit Patronen des Kaliber 45 geladen. Die bleifarbenen Geschossköpfe der Patronen waren an der Spitze abgeflacht und wiesen eine leichte Vertiefung auf.
»Das sind aber keine Silberkugeln.«
»Nein, das ist was Besseres. Das sind Hohlspitzgeschosse.
Diese Projektile sind so ausgelegt, dass sie das Ziel nicht durchschlagen, sondern im Körperinneren aufplatzen. Mit einem einzigen Schuss kannst du sogar einen heranstürmenden Berggorilla augenblicklich kampfunfähig machen. Vorausgesetzt, du triffst.«
»Aber der Gegner gehört zu den mächtigsten Primaten, die jemals auf der Erde gelebt haben...«
»Mach dir lieber Sorgen, ob du ihn überhaupt triffst. Steck jetzt das Magazin wieder ein und lade sie.«
Rei steckte das Magazin in den Griff zurück und zog dann kurz den Schlitten nach hinten, wie er das schon in Filmen gesehen hatte. Mit einem satten Geräusch schloss sich das Patronenlager. Das Aufstellen des Hahns wirkte unheimlich und machte Rei eher Angst, als dass es ihn auf den Kampf einstimmte.
»Halte sie beidhändig und bleib dabei schön locker, die Handgelenke müssen entspannt sein.«
Rei hielt die Pistole so, wie Gotoda es ihm sagte:
»Strecke die Arme und beuge die Ellbogen ganz leicht. Den Kopf gerade halten, beide Augen aufhalten und den Rücken durchstrecken. Du schaust nicht auf die Kimme, sondern nur auf das Korn. Lass die Schultern ganz locker und zieh ganz locker mit dem Zeigefinger den Abzug durch. He, Schultern locker lassen. Du bist doch kein Gorilla!«
»Ich hab so was zum ersten Mal in der Hand, also mach mich nicht gleich so an!« brüllte Rei, bei dem alle Gemütsruhe mit einem Mal wie weggeblasen war.
»Na ja, was soll's, wenn du zielst, triffst du sowieso nicht Also zieh halt einfach ab, wenn du ihn direkt vor dir hast!, sagte Gotoda und gab seine Rolle als Trainer für den Schnellkurs im Pistolenschießen kurzerhand auf.
Während Rei mit seiner rechten Hand die Griffsicherung umklammert hielt, ergriff er mit der linken Hand den Hahn und zog ganz vorsichtig und sachte am Abzug, um den Hahn in seine Ausgangsposition zurückzubringen. Dann senkte er den Lauf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Rei verabscheute Waffen keineswegs. Man konnte sogar sagen, dass er Waffen liebte. Aber er hätte sich niemals träumen lassen, dass er an so einem Ort und in so einer Situation mit einer Pistole schießen würde.
»Da fällt mir was ein...« »Was denn?«
»Glaubst du, das geht gut, wenn wir hier einfach so herumballern?« Es war zwar Nacht - nein, gerade weil es Nacht war, konnte es nicht folgenlos bleiben, wenn man auf einem Schulgelände eine Schießerei veranstaltete. »Ich meine, wir sind hier nicht in einem einsamen Haus irgendwo in der Wildnis. Die Schule hat einen Hausmeister, und drum herum gibt es jede Menge Wohnhäuser und Geschäfte. Drüben, auf der anderen Seite der Schienen ist sogar eine Polizeiwache.«
Es war sonnenklar, dass eine Schießerei die Nachbarschaft in helle Aufregung versetzen und in kürzester Zeit Streifenwagen anrücken lassen würde.
»Der Hausmeister ist wegen einer dringenden Angelegenheit abwesend, und die Polizisten von der Wache sind alle auf Patrouille. Wir haben gut fünf Minuten, um alles zu entscheiden. Soviel Zeit vergeht zwischen dem ersten Anruf eines besorgten Nachbarn und dem Anrücken des zuständigen Streifenwagens. Die Devise heißt also ballern, was das Zeug hält und dann nichts wie weg. Du gehst doch hier zu Schule, also kennst du dich in der Gegend auch aus.«
Gotoda war fahrlässig genug, einem Oberschüler ohne Vorwarnung eine Pistole in die Hand zu drücken, aber seine ganze Strategie war nicht minder blauäugig. Selbst wenn sie die Sache überlebten, würde man sie wegen illegalen Waffenbesitzes dran kriegen, wenn sie nicht rechtzeitig das Weite suchten.
»Und wer räumt danach hier auf?«
»Ich fürchte, der größte Skandal der Schulgeschichte wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Hast du ein Problem damit?« »Nein«, antwortete Rei nach kurzem Nachdenken. »Eigentlich nicht. Also los.«
Rei nahm noch einmal allen Mut zusammen und packte die Pistole fest zwischen seine Hände. Im selben Augenblick legte Gotoda seinen Zeigefinger an die Lippen. Rei schärfte seine Ohren, um nach Geräuschen am Himmel über ihm zu lauschen. Er glaubte, das leise Geräusch eines im Wind flatternden Segels zu hören, und schon im nächsten Moment strich etwas über seinen Kopf. Ein schwarzer Schatten mit riesigen Schwingen ließ sich flatternd auf dem Geländer am einen Ende des Flachdachs nieder. Wie ein Vogel, der sich auf einem Ast niedergelassen hatte, klappte er seine Flughäute ein und ging in die Hocke. Dann landete links von ihm ein ähnlicher Schatten, und kurz darauf rechts noch einer.
»Verdammt! Gleich drei auf einmal«, kommentierte Rei leise knurrend die unerwartete Entwicklung der Situation. Er war davon ausgegangen, dass sie selbst zu zweit mit diesem Monster von Kariya schon genug Schwierigkeiten haben würden Jetzt waren seine Annahmen auf denkbar schlimmste Weist über den Haufen geworfen worden, und Rei musste sich heftig zusammenreißen, um angesichts der schockierenden Lagt nicht in Tränen auszubrechen. Allerdings schienen die drei Ungeheuer von Rei und Gotoda keinerlei Notiz zu nehmen Statt dessen drehten sie ständig ihre Köpfe in alle Richtungen, als ob sie die Witterung von etwas aufnehmen wollten. Ihn Gestalt hatte gerade eben noch menschliche Formen, aber ihre Bewegungen waren die eines wilden Tieres, von dem nichts Gutes zu erwarten war.
»Sie benutzen ihren Ultraschall, um Saya aufzuspüren.«
Rei erinnerte sich daran, wie Kariya an dem Tag, als Rei ihm in die Falle gegangen war, schon zum Blutsaugen ansetzen wollte und plötzlich in seiner Bewegung innehielt, als ob er nach etwas Entferntem lauschte. Und nicht nur Kariya. Von seinem Versteck im besetzten Haus hatte Rei ein ähnliches Verhalten auch bei Saya beobachten können. Vielleicht war es ja so, dass ihre so unheimlich flackernden Augen zwar Bewegungen gut wahrnehmen konnten, an sich aber keine hohe Sehkraft besaßen, so dass sie sich vor allem auf Ultraschall verließen Bei diesem Gedanken erstarrte Rei unwillkürlich zu einer Salzsäule. Er verfluchte insgeheim Saya, die immer noch nicht erscheinen wollte und beobachtete mit angehaltenem Atem die Aktivitäten der drei Ungeheuer. Dann stoppten ihre Bewegungen plötzlich. Das Monster in der Mitte breitete seine Schwingen aus und hielt sich bereit. Rei dachte, dass Saya jetzt kommen müsse, und unwillkürlich klammerten sich seine Hände fester an die Pistole, aber im gleichen Moment begann Gotoda mit geradezu aufreizender Lässigkeit loszulaufen.
»Du bleibst hier und gibst mir Deckung!'« rief Gotoda, während er sich den Ungeheuern so näherte, dass die Dachaufbauten mit dem Ausgang des Treppenhauses zwischen ihnen lagen.
»Veni Sancti Spiritus! Vade retro satanis!«
Die auf dem Geländer in Bereitschaftsstellung ausharrenden Bestien flogen mit einem Mal hoch auf, um von den Dachbauten wegzukommen. Das war genau die Reaktion, auf die Gotoda gewartet hatte. Eine Pumpgun ist am wirkungsvollsten, wenn sie auf sehr kurze Distanz eingesetzt wird. Um das Ziel möglichst im Streukreis der Schrotkugeln zu halten, ist es wünschenswert, die Bewegungsachse des Ziels mit der Schusslinie übereinstimmen zu lassen. dass Gotoda so scheinbar sorglos direkt von vorne auf sie zugelaufen war, hatte dem Zweck gedient, eine entsprechende Bewegung zu provozieren. Außerdem waren die eng nebeneinander wartenden Bestien gezwungen, für einen Moment ihren ganzen Körper schutzlos dem Lauf des Gewehrs darzubieten, wenn sie das Dachhäuschen überwinden wollten. Genau auf diesen optimalen Augenblick hatte es Gotoda abgesehen, als er die erste Double-O-Back abfeuerte. Die Stille wurde von einem mächtigen Donnerschlag zerrissen, dessen Echo von den Schulgebäuden widerhallte.
Aber die Ladung mit neun Schrotkugeln verfehlte die erhoffte Wirkung. Anstatt die Brustknochen der Bestie zu durchlöchern und große Mengen Blut und Fleisch in der Gegend zu verteilen, zerriss sie lediglich die Flughaut ihres rechten Flügels und verpuffte am Himmel. Die Bestie hatte ihren Körper im Augenblick, als sie über das Dachhäuschen aufgestiegen war, stark verdreht und es so verhindern können, dass Gotodas erster Schuss ein Volltreffer war. Mit zerfetzter Flughaut segelte das Monster noch ein Stück weiter und fiel schließlich vor Rei zu Boden.
Gotoda blickte sich hastig um, lud nach und legte das Gewehr an die Schulter, wurde aber noch im selben Moment gewahr dass Rei sich in seiner Schusslinie befand und wandte den Lauf erschrocken ab. Im Hintergrund war das unheilverkündende Flügelschlagen der beiden übrigen Bestien zu hören, die wild durcheinander flatternd aufgeflogen waren. Und auf einmal waren die Angreifer in der Defensive.
Das Monster war Gotoda zwar auf den Leim gegangen, konnte seiner ersten Schrotladung aber knapp ausweichen und war jetzt genau zwischen Rei und Gotoda gelandet, womit es beiden die Möglichkeit zum Schießen nahm. Während Gotoda sich hastig umwandte, hatten die beiden übrigen Monster sich in seinem Rücken aufgebaut, während das verletzte Exemplar Rei den Weg versperrte.
»Schieß!« rief Gotoda, während er sich für das linke der bei den Monster, die jetzt von zwei Seiten auf ihn zukamen, entschied und einen großen Ausfallschritt nach vorne machte. Selbstverständlich bedeutete dies, dass er dem zweiten Monster seinen ungeschützten Rücken zuwenden musste, aber ihn blieb jetzt keine andere Wahl.
Während er versuchte, aus dem Augenwinkel die Gestalt de, Monsters, das sich hinter seinem Rücken bewegte, im Auge zu behalten, richtete er den Lauf seiner Flinte auf das Exemplar direkt vor ihm. Just in diesem Moment schnellte etwas am dem Schatten hervor, den das Dachhäuschen auf dem Flachdach warf. Gleichzeitig mit dem Krachen von Gotodas Gewehr sprang der Schatten mit einem großen Satz nach vorne und kreuzte den Weg der Bestie, die im Rücken Gotodas gerade zum Angriff ansetzte. Der eine Flügel der Bestie wurde in die Luft gerissen und eine Fontäne von Blutspritzern regnete wie ein plötzlicher Schauer auf den Beton nieder. Der kurz nach dem Monster wieder auf dem Dach gelandete Schatten wandte sich mit lebhaft flatterndem Rock um. Es war Saya. Mit einem einzigen Satz überwand sie die Distanz zu dem Monster, riss die tief über dem Boden hängende Spitze ihres Schwerts hoch und zerschlitzte so die Flanke des Monsters. Dann wirbelte sie herum, winkelte die Ellbogen an, drehte die Spitze des jetzt in der Überkopfhaltung befindlichen Schwerts um 180 Grad und zerfetzte mit einem Stoß nach hinten die Halsschlagader ihres Opfers, das schnell große Mengen Blut verlor. Durch den schlagartigen Blutverlust begann das Monster am ganzen Körper zu rocken. Der Anblick hatte jetzt nur noch wenig mit einem Kampf gemein. Das Wort »Schlacht« wurde dieser Szene schon eher gerecht.
Gotoda hatte mit seinem zweiten Schuss die Flanke des Monsters aufgerissen. Während er mit einer flinken Bewegung nachlud und das vor ihm zu Boden gegangenen Monster in Schach hielt, wandte er sich zu Rei um und rief ihm zu.
»Worauf wartest du, schieß schon!«
Ein dritter Schuss Gotodas folgte, dann ein vierter, um das vom Druck der Ladung durch die Luft geschleuderte Monster in. die Ecke zu treiben. Gotoda lud das Gewehr für seinen fünften Schuss. Als das fürchterliche Krachen der schnell aufeinanderfolgenden Schüsse des Schrotgewehrs Rei endlich wieder zur Besinnung brachte, sah er die furchtbare Gestalt des mit gebleckten Zähnen auf ihn zukommenden Monsters und stieß einen Hilfeschrei aus.
Er streckte die Pistole nach vorne und zog den Abzug, aber sowohl der Knall als auch der Rückstoß blieben aus. Rei gefror das Blut in den Adern. Als er ungläubig auf die Pistole in seinen Händen sah, bemerkte er, dass der Hahn nicht gespannt gewesen war. Eine Colt Gouvernement besaß keinen so raffinierten Mechanismus wie eine Double Action. Selbst wenn sich eine Patrone in der Patronenkammer befand, musste man für den ersten Schuss den Hahn spannen!
Aber Rei blieb keine Zeit, seine eigene Nachlässigkeit zu verfluchen, das Monster war schon so nahe bei ihm, dass es schien, als ob er es mit ausgestrecktem Arm fast berühren könnte. Mit zitternden Fingern suchte Rei nach dem Hahn und streckte dem Monster die Pistole entgegen, während er mit einer Angst kämpfte, die ihm alle Haare zu Bergen stehen ließ.
Dann erschien vor Reis Augen ein riesiger Feuerball, während zugleich etwas in seiner Hand explodierte. Die Bestie schwankte ganz leicht. Glücklicherweise hatte Reis erster Schuss die Brust des Monsters durchbohrt. Noch ein Schuss, noch einer... Während das Monster wie ein wildes Tier schrie, betätigte Rei wie in Trance immer wieder den Abzug. Da er den Lauf nicht richtig unter Kontrolle bekam, flogen die meisten Kugeln entweder in den Nachthimmel oder prallten auf den Boden, aber einige wenige durchdrangen den Hals und die Flanke seines Ziels, um mit Fontänen aus Blut und Fleisch aus der Rückseite des Opfers wieder auszutreten. Schließlich hatte Rei das Magazin komplett leer geschossen. Der Schlitten stoppte in der rückwärtigen Position und die Patronenkammer öffnete sich.
Als Rei halb betend, halb hoffend die Augen öffnete, sah er, wie das Monster, an dem die zerfetzte Flughaut wie Lumpen herunterhing, gerade mit einem Arm zum Schlag auf ihn ausholte. Um mit so einem Monster fertig zu werden, würde man sich wenigstens eine Bazooka oder einen Granatwerfer, zumindest aber ein schweres Maschinengewehr wünschen, dachte sich Rei. Im selben Moment trennte sich der hoch erhobene Arm von der Schulter und flog in den Himmel. Der Kopf des Monsters, das die Balance verloren hatte und heftig ins Schlingern gekommen war, verschwand wie von Zauberhand.
Ein dumpfes Krachen und das auf ihn herabregnende Blut brachten Rei wieder zur Besinnung. Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und sank zu Boden. Das Monster lag wie ein umgestürzter Haufen Gepäck vor ihm. Und hinter ihm stand Saya. Ohne den Kadaver der Bestie vor ihr eines Blicke zu würdigen, hob sie das Schwert und suchte seine Klinge nach Scharten ab.
Das gesamte Flachdach hatte sich in ein Meer von Blut verwandelt. Alles war genauso in jener Nacht, als er zum Augenzeugen wurde. Als Rei sah, wie Gotoda mit müden Schritten und der lässig aus seiner Hand baumelnden Pumpgun zu ihm zurückkam, musste er an die Worte des Alten denken Wenn sie dich das nächste Mal trifft, wird sie dich töten... Geradezu apathisch blickte Rei zu Saya auf. Ein bleiches Gesicht und Augen wie bläulich flackernde Flammen. Die Augen eines wilden Tiers, dachte Rei. Die Augen eines schauderhaft schönen Raubtiers...
Rei konnte sich kaum daran erinnern, welche Route sie auf ihrer Flucht genommen hatten. Er erinnerte sich undeutlich daran, wie Gotoda die Pistole und die Schrotflinte in irgendeinen Abwasserkanal geworfen hatte, aber ihm fehlte jede Erinnerung daran, wo er sich seiner blutbesudelten Kleider entledigt hatte. Unterwegs waren sie einem ausrückenden Feuerwehrauto mit Sirenen begegnet, und als Rei sich umschaute, konnte er über den Häusern einen roten Schein erkennen, der von den Wolken reflektiert wurde. Zeit gewonnen und Beweise vernichtet... Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du machst keine halben Sachen, was? Rei wusste noch, wie Gotoda das gemurmelt hatte. Aber er konnte sich nicht ins Gedächtnis rufen, dass er Sayas Gestalt von hinten gesehen hatte, obwohl sie doch vor ihm kehrtgemacht haben musste.
Als Rei wieder zu sich kam, hockte er vor dem Fahrkarten Schalter irgendeines Bahnhofs. Hinter dem unbemannten Einlass zum Bahnsteig erschallte in der Feme eine Ansage, welche die Bereitstellung eines Zuges auf irgendeinem Gleis ankündigte. Als er aufsah, hockte Gotoda vor ihm und streckte ihm eine Fahrkarte entgegen.
»Ich gebe dir einen Tipp. Geh jetzt irgendwo hin, wo was los ist, und stelle irgendwas an. Such dir einen Vorwand und fang Streit mit einem x-beliebigen Oberschüler an, der unsicher wirkt. Verpasse ihm zwei oder drei Schläge, das wäre schon perfekt. Vielleicht werden sie dich über Nacht einbuchten, aber das ist immer noch besser, als Verdächtiger in einem Fall von Brandstiftung zu sein.«
Wortlos nahm Rei den Fahrschein. Dieser pfirsichfarbene Fahrschein strahlte so eine Wärme aus, dass er sich damit am liebsten über die Wange gestrichen hätte.
»Vergiss am besten möglichst schnell, was heute Nacht passiert ist. Und vergiss auch dieses Mädchen. Es bringt überhaupt nichts, wenn du sie in Erinnerung behältst.«
Es schien, als ob Gotoda noch etwas sagen wollte, aber offenbar fiel ihm nichts mehr ein, und er erhob sich.
»Und du? Was wirst du tun?«
Gotoda, der schon dabei war zu gehen, wandte sich noch einmal um. Er zeigte sein bekanntes hyänenartiges Grinsen und antwortete:
»Morieris ut canis.«
Dann wandte er sich ab und ging mit schnellen Schritten davon. Es war das letzte Mal, dass Rei Gotoda sah.
FAZIT
30 Jahre sind seit alldem vergangen. Rei und seine Freunde hatten auch nach dem Zwischenfall ihre Reibereien mit der Schule, aber nicht zuletzt weil die Schule sie wohl möglichst schnell loswerden wollte, haben sie am Ende alle unerwartet einfach ihren Abschluss bekommen.
Murasakino heiratete eine Angestellte, die in einem der Apartments seiner Eltern zur Miete wohnte, und beide eröffneten gemeinsam eine kleine Snack-Bar. Nabeta bekam anfangs keinen Studienplatz und verbrachte ein Jahr als Ronin, bevor er doch noch an einer privaten Universität aufgenommen wurde. Eine Weile war er ziemlich aktiv in einem literarischen Zirkel, der eine eigene Zeitschrift herausgab, aber nach seinem Uni
Abschluss kehrte er in seine Heimat zurück, wo er eine Stelle in der Verwaltung antrat und so als Jüngster die Beamtentradition in seiner Familie fortsetzte. Amano erbte die Baufirma seines Vaters. Reis Kontakt zu Doigaku riss ab, als der anfing, zu studieren. Aoki hat Rei nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kein einziges Mal mehr gesehen. Gerüchte besagten, dass er gezwungen wurde, auf ein Internat irgendwo auf dem Land zu gehen, wo er anschließend wohl auch studierte.
Rei hatte darauf verzichtet, sich auf die Eintrittsprüfungen der Unis vorzubereiten, aber wie durch ein Wunder schaffte er die Prüfung für eine staatliche Uni mit Semester System, womit er alle, die ihn kannten, verblüffte. Die Zeit an der Uni war ziemlich langweilig, aber nach zwei Extrajahren schaffte er schließlich auch seinen Abschluss. Er heiratete und wurde Vater. Mit Hilfe eines Kredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren erwarb er ein kleines Fertighaus, ließ sich später scheiden und zahlte Unterhalt. Er beging so ziemlich alle Dummheiten, die man als Mensch begehen kann. Er heiratete dann noch einmal und lebt zur Zeit mit seiner zweiten Frau, zwei Hunden und einer Katze. Seine Arbeitsstelle wechselte er unzählige Male und arbeitete dabei in einer ganzen Reihe von Redeaktionsjobs, bevor er sich vor einigen Jahren als Schriftsteller selbständig machte und einige Bücher über Filme schrieb, ein Thema, das er schon immer mochte. Da er nach wie vor gerne trinkt, ist er in letzter Zeit dicker geworden. Aber abgesehen davon ist er ein stattlicher Mann mittleren Alters ohne größere Sorgen.
Es war schon nach Mittag, als Rei in der U-Bahn Richtung Stadtzentrum fuhr. Das Abteil war leer. Ein Verlag, mit dem er schon seit längerem zu tun hatte, plante die Herausgabe einer neuen Kino- und Theaterzeitschrift. Rei war gebeten worden, eine Kolumne in der Zeitschrift zu übernehmen und war jetzt auf dem Weg zu einer Besprechung.
Der Zug glitt in einen Bahnhof und Rei, der in einem Entwurf der Zeitschrift blätterte, blickte auf und vergewisserte sich, wie die Station hieß. An der nächsten Haltestelle musste er aussteigen. Die Tür öffnete sich, und eine Oberschülerin nahm ihm gegenüber Platz. Rei, dem die jungen Leute in letzter Zeit furchtbar auf die Nerven gingen, runzelte die Stirn. Am wenigsten konnte er die Spezies der dick und bis zur Unkenntlichkeit des Alters geschminkten Mädchen leiden.
Immer wenn er eines von diesen sonderbaren Mädchen sah, musste er mit Mühe ein heftiges inneres Verlangen unterdrücken, sie zu packen und aus dem Fenster zu werfen. Schlecht gelaunt beäugte Rei die Oberschülerin, als sich plötzlich ein Ausdruck von Überraschung in seinem Gesicht breitmachte.
Das Mädchen vor ihm hatte schulterlanges, in der Mitte gescheiteltes Haar, ein bleiches, ungeschminktes Gesicht und trug diese Art von dunkelblauen Schuluniformen, die man bei Oberschülerinnen heutzutage eigentlich kaum noch sah. Rei fragte sich, ob sie vielleicht Design oder so etwas studierte, weil sie eine lange Pappröhre in den Armen hielt. Aber mehr als alles andere irritierten Rei die Augen des Mädchens.
Diese weit geöffneten Augen, die aus einem leicht gesenkten Kopf irgendwo suchend in die Ferne schweiften und sich nicht im geringsten an den aufdringlichen Blicken des Mannes gegenüber zu stören schienen, kamen Rei bekannt vor. Der Zug schien sich dem nächsten Bahnhof genähert zu haben, denn er bremste sehr stark und für einen kurzen Moment fiel die Beleuchtung im Wagen aus. Und kein Zweifel, in diesem Augenblick der Finsternis leuchteten die Augen des Mädchens geheimnisvoll auf.
Die Beleuchtung im Wagen flackerte kurz und brannte dann wieder normal. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein und hielt, die Türen öffneten sich. Hastig stand Rei von seinem Sitz auf und stolperte halb aus dem Zug auf den Bahnsteig. Er kämpfte, um seinen heftig rasenden Puls zu unterdrücken, nahm dann allen Mut zusammen und wandte sich noch einmal um. Für ihn und das Mädchen, das ihn durch die Scheibe betrachtete, war es ein Wiedersehen nach dreißig Jahren. Es war Saya. Sie war es, und nichts hatte sich geändert. Wenn sich etwas verändert hatte, dann allerhöchstens Rei, wie er sich in ihren Augen spiegelte. Ganz sicher spiegelte sich dort der Mann, zu dem der einstmals getriebene, zornige, schreiende Oberschüler nach Jahren der Veränderung, in denen er manches hatte aufgeben und anderes hatte akzeptieren müssen, geworden war. Wie mochte seine Gestalt in den Augen dieses Mädchens erscheinen, dem es nicht erlaubt war, sich zu verändern? Rei hatte das Gefühl, dass er zum ersten Mal ein klein wenig verstand, weshalb Saya ihn in jener Nacht nicht getötet hatte. In diesem .Moment lebten diese unwiederbringlichen, diese albernen und zugleich kostbaren Tage zusammen mit einem Gefühl tiefer Reue in seinem Inneren auf. Eine Ansage kündigte die Abfuhrt des Zuges an, und die Türen schlossen sich.
Mit einem heftigen Gefühl von Verlust kämpfend, blieb Rei stehen. Als er Saya im abfahrenden Zug nachsah, schien es so, als ob sie ein ganz klein wenig lächelte. Aber vielleicht waren es auch nur die vergangenen dreißig Jahre, die seiner Wahrnehmung hier einen Streich spielten. Die U-Bahn, in der das Mädchen mit den Raubtieraugen saß, fuhr erst langsam und dann immer schneller aus der Station aus, um schließlich von der Dunkelheit verschluckt zu werden.